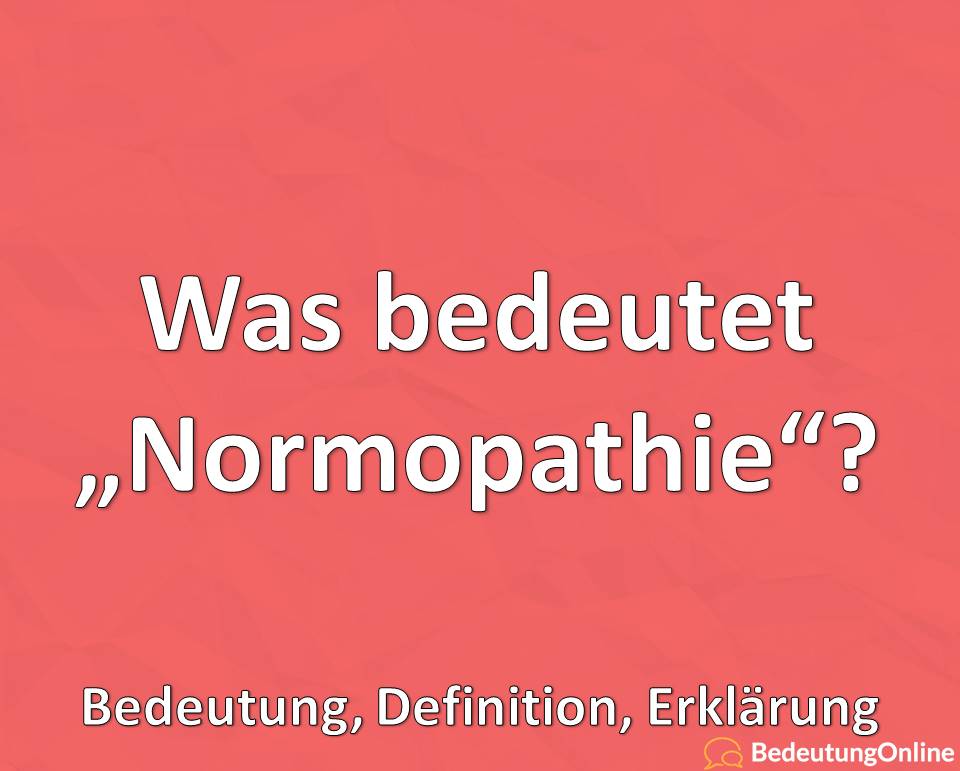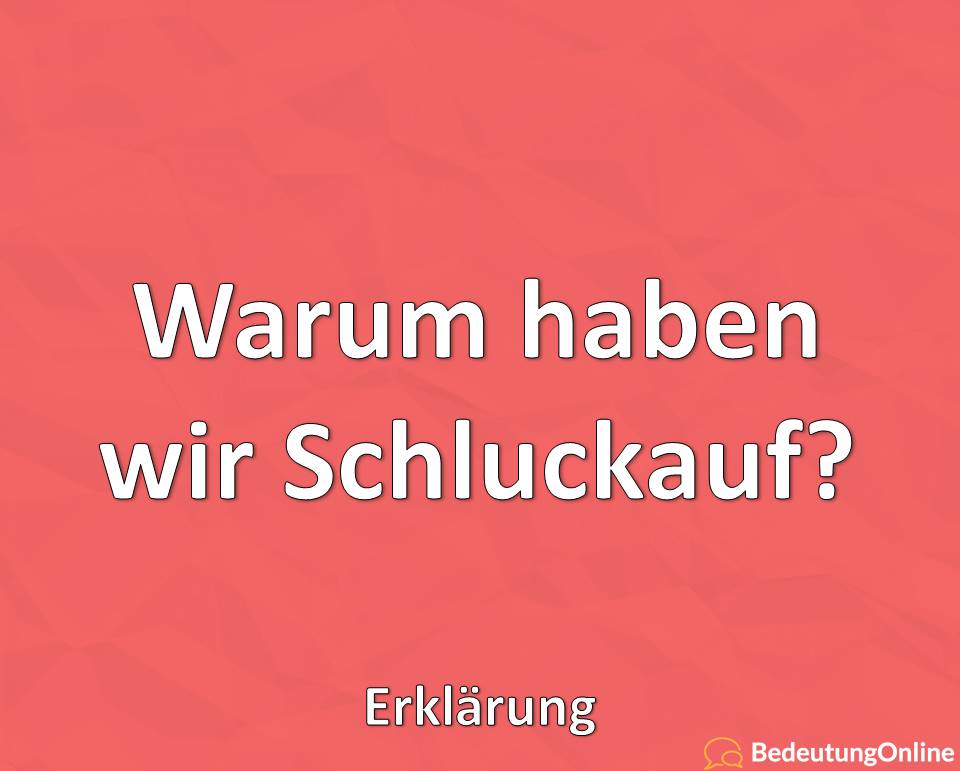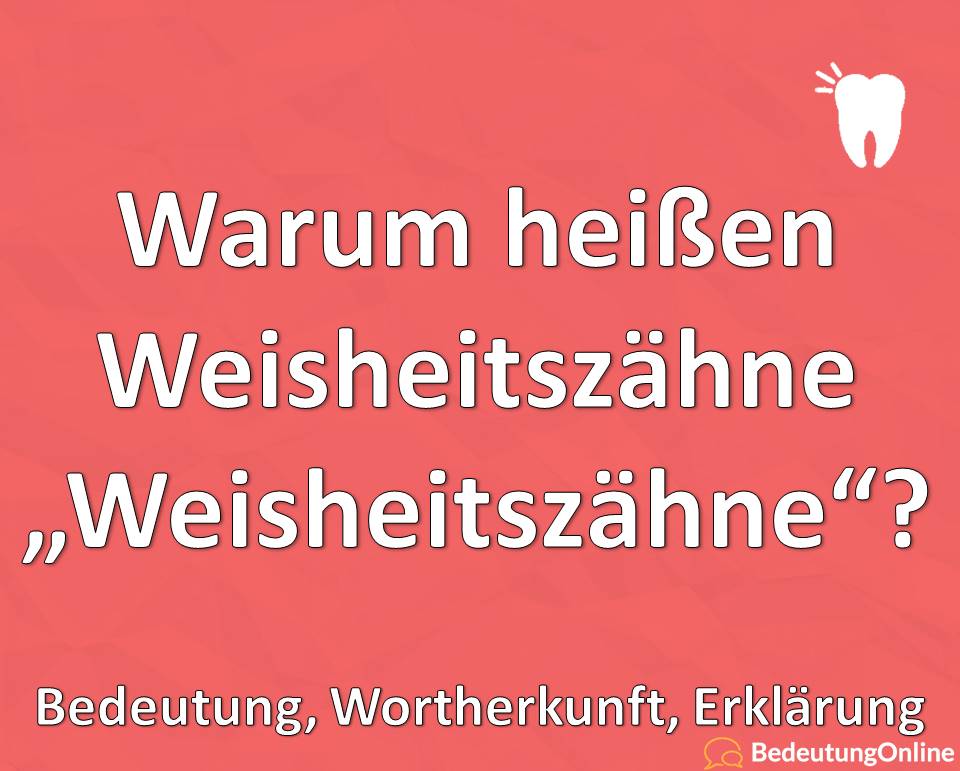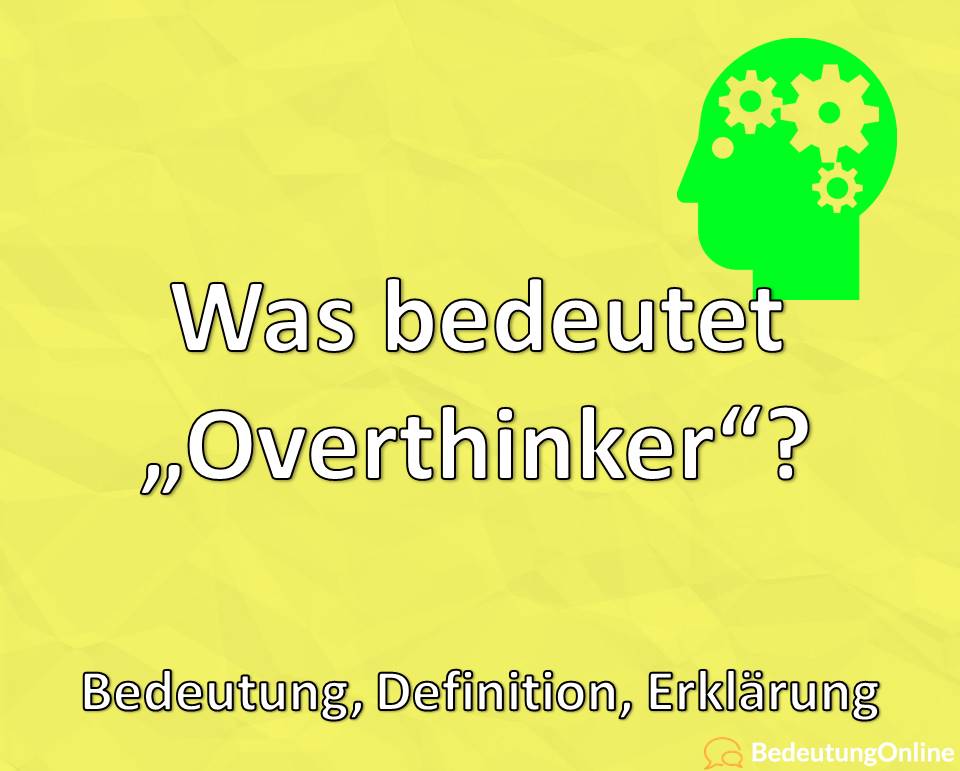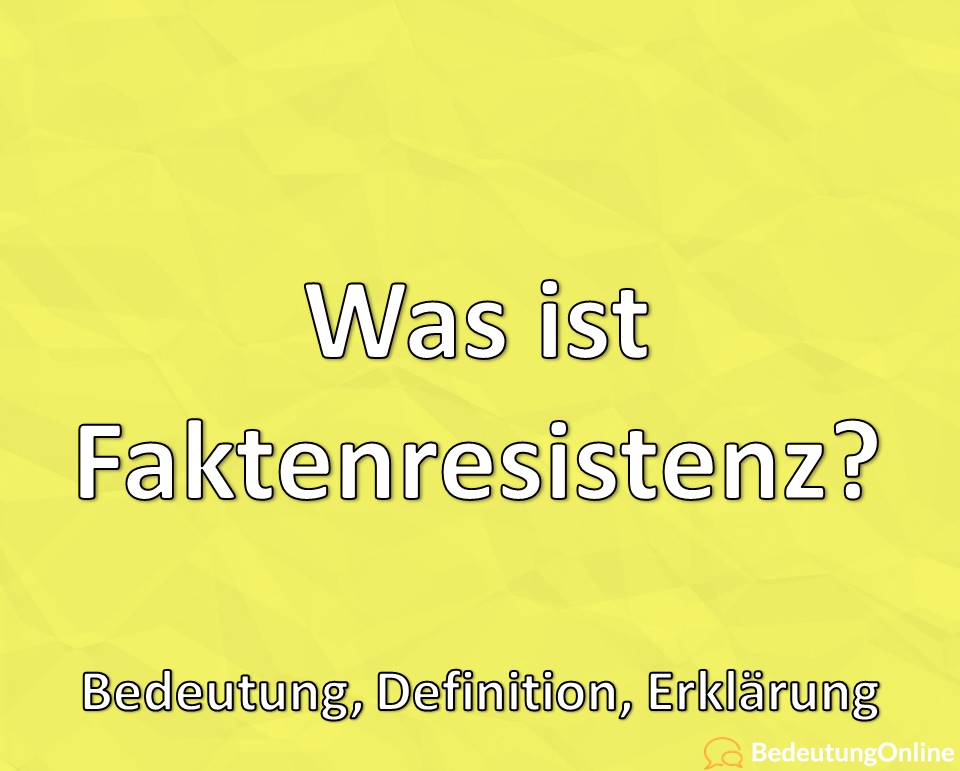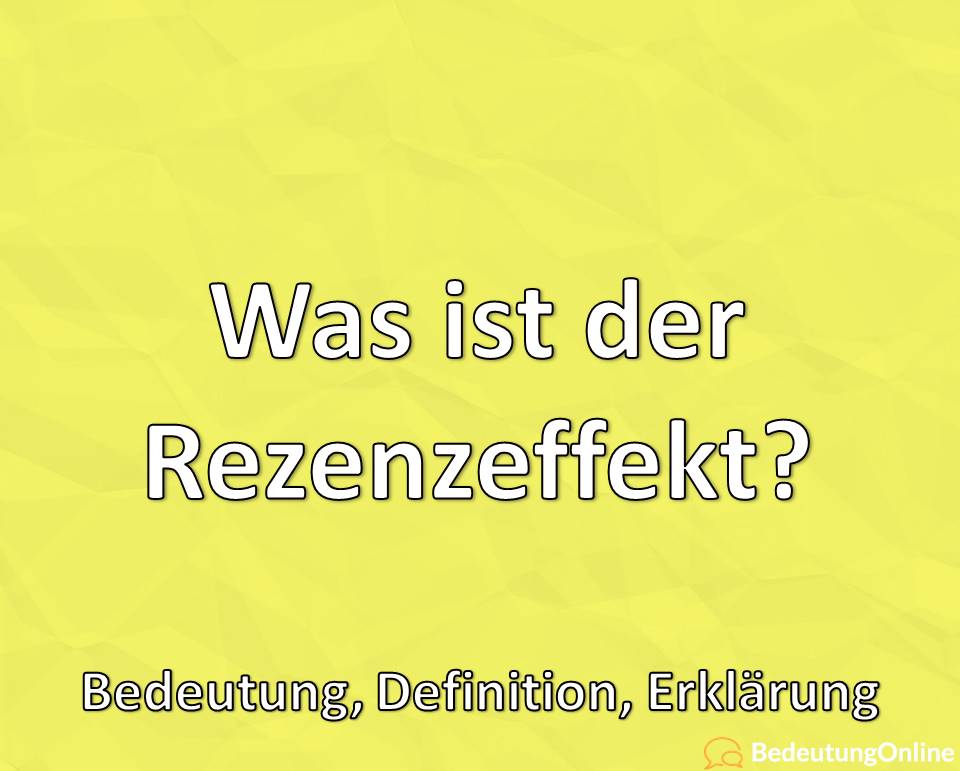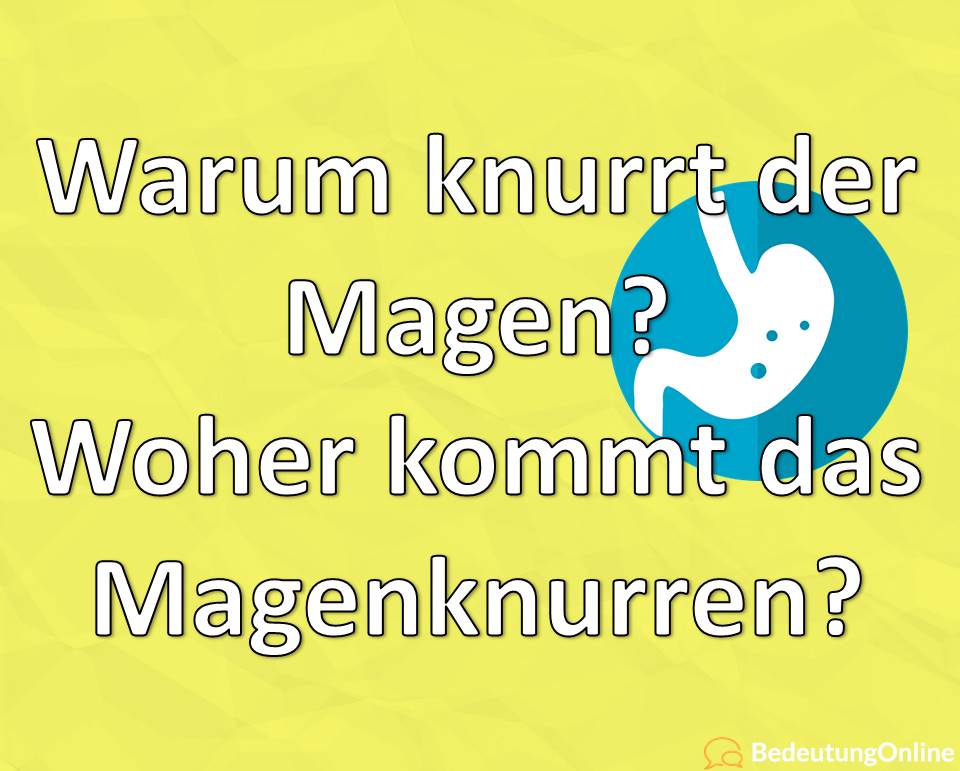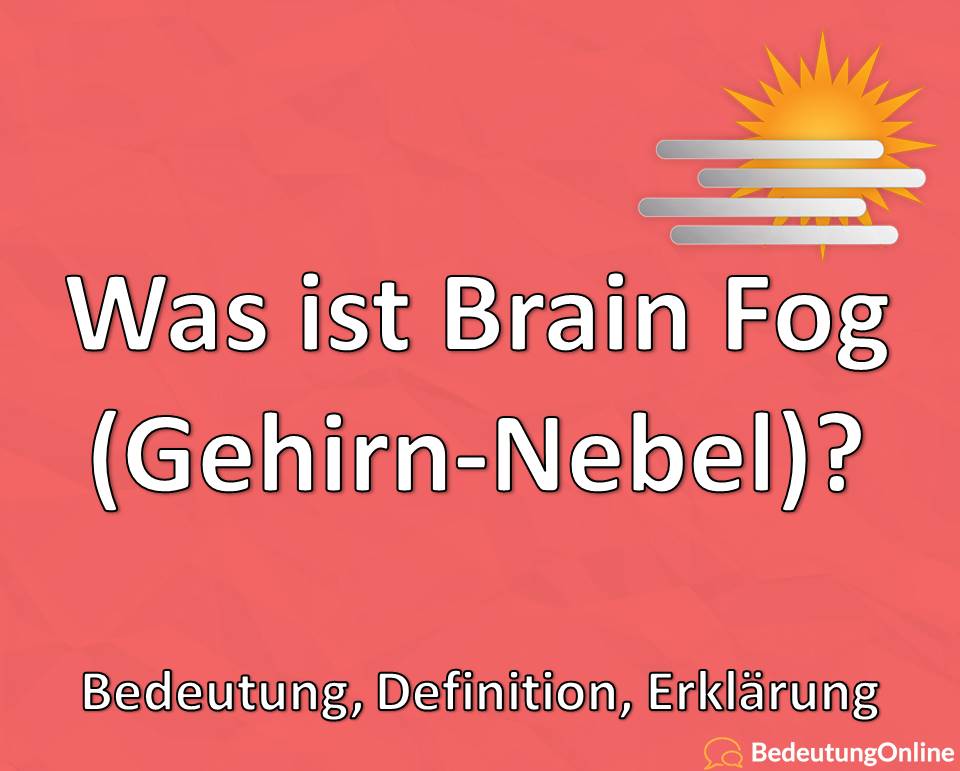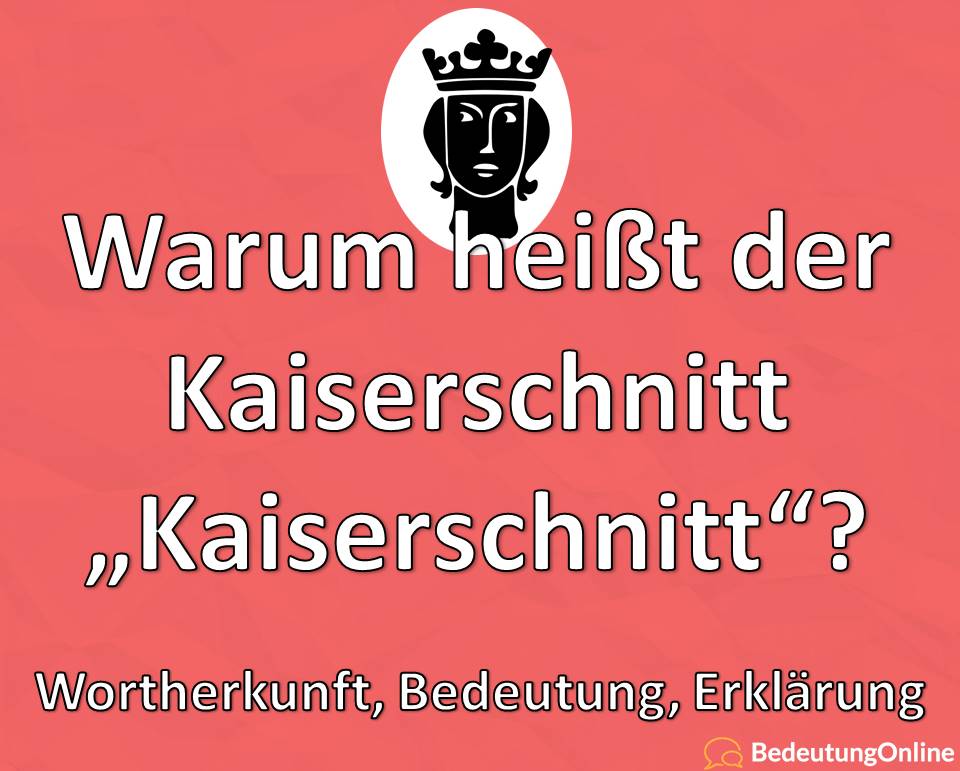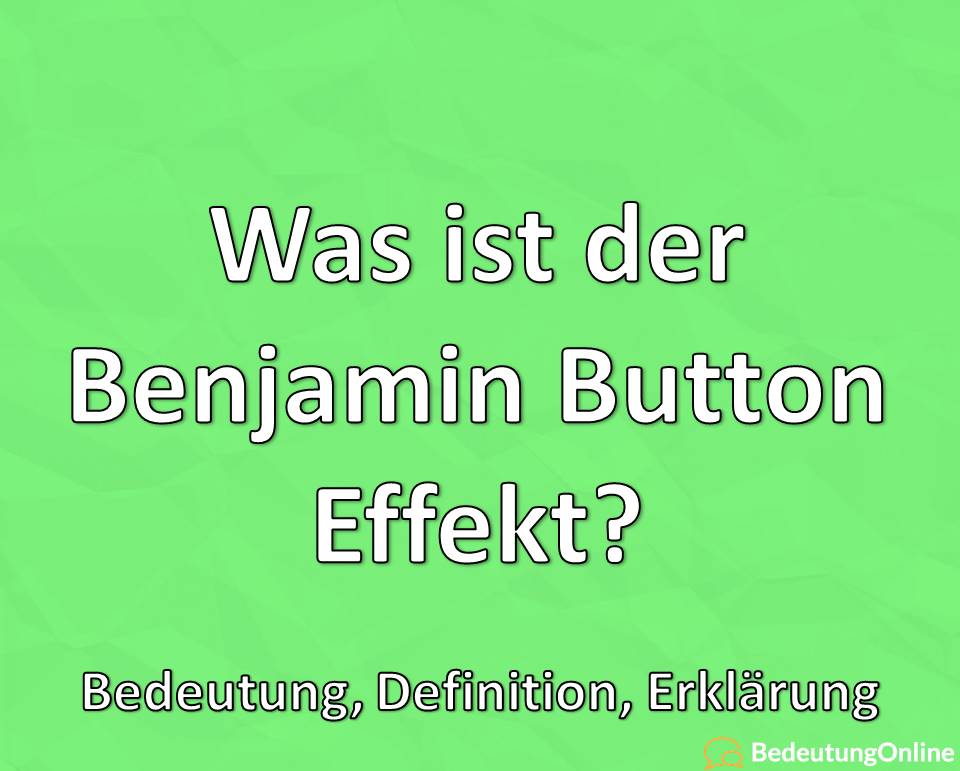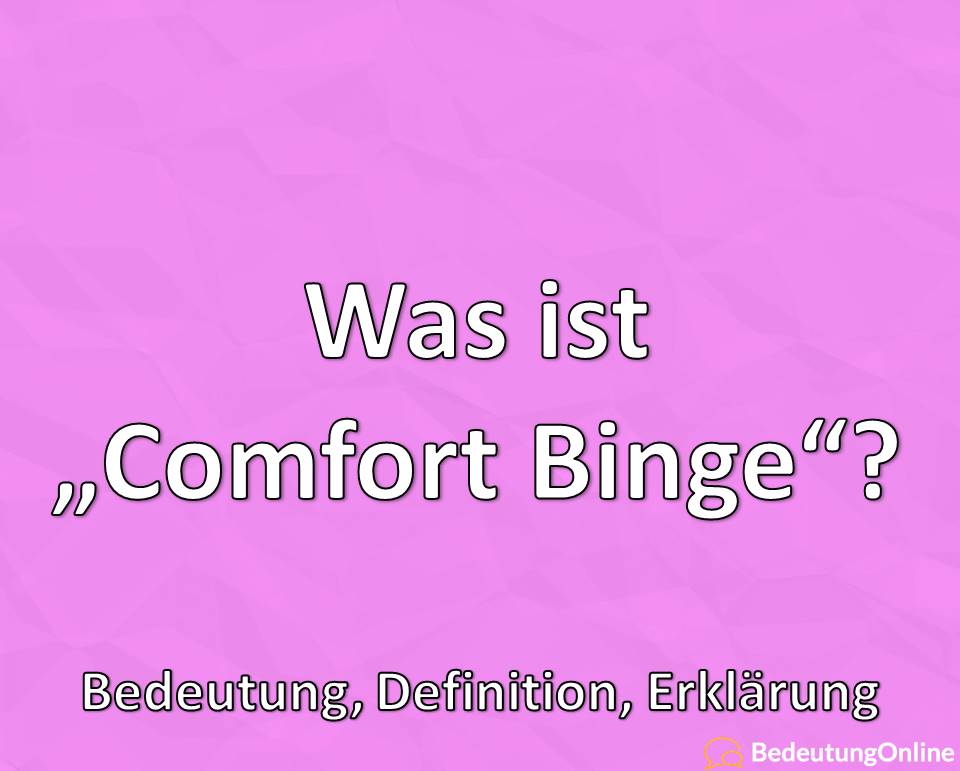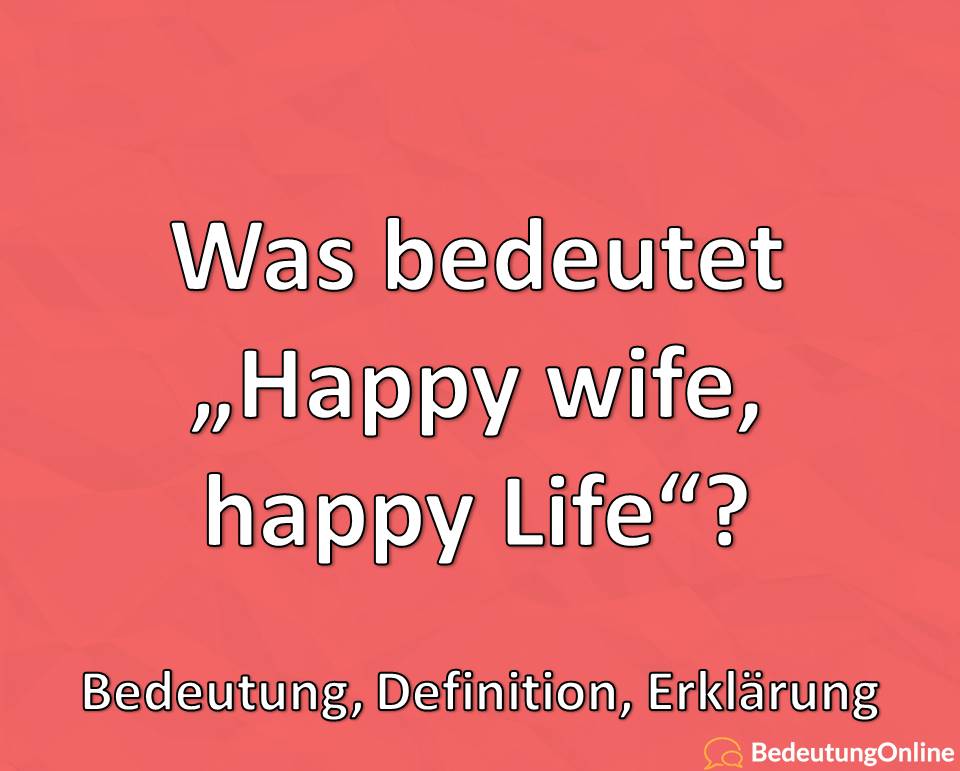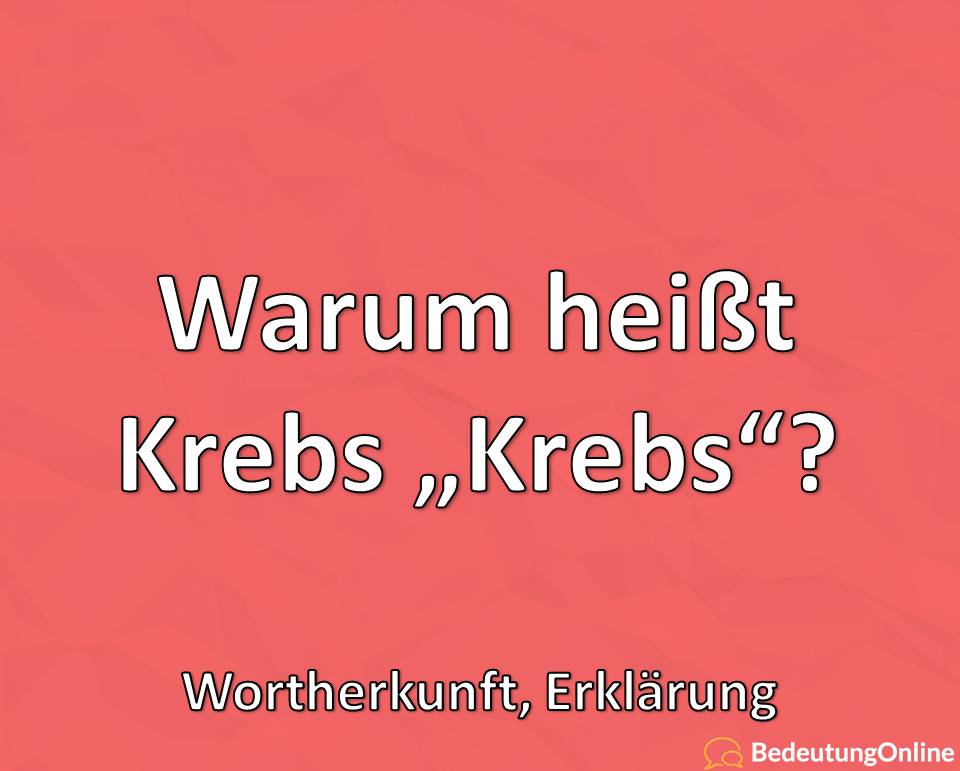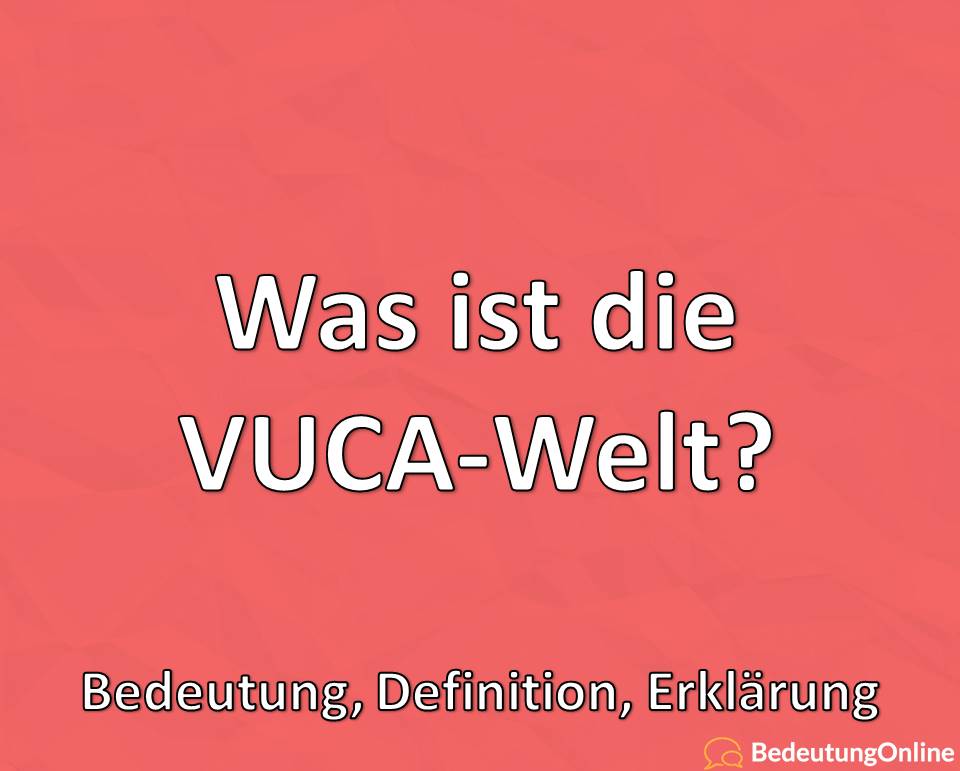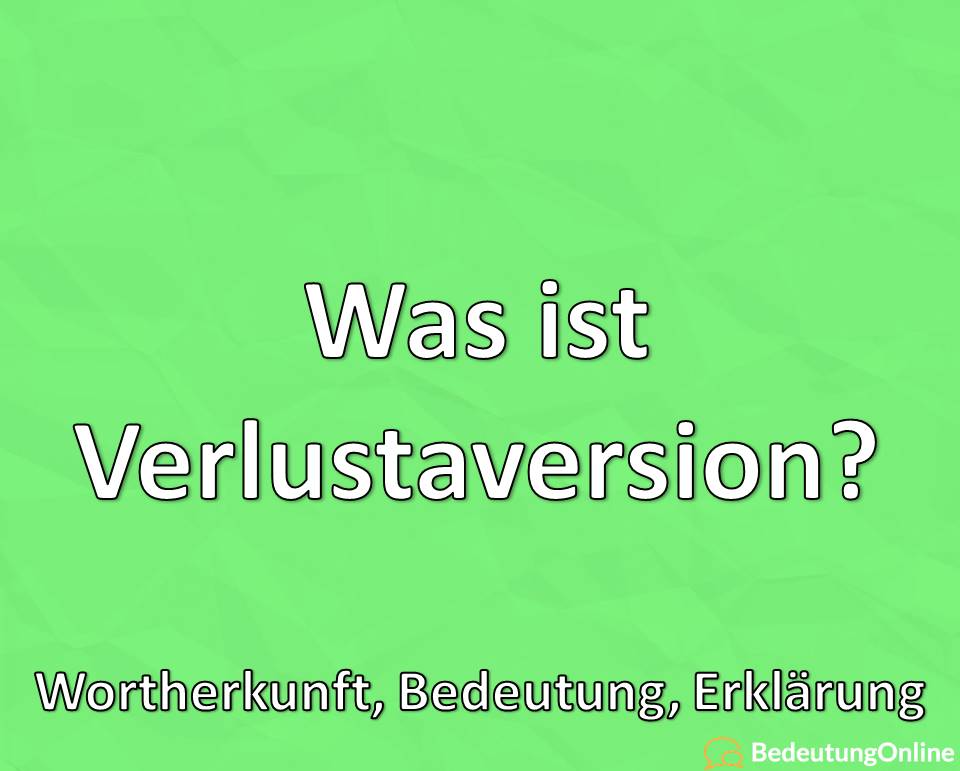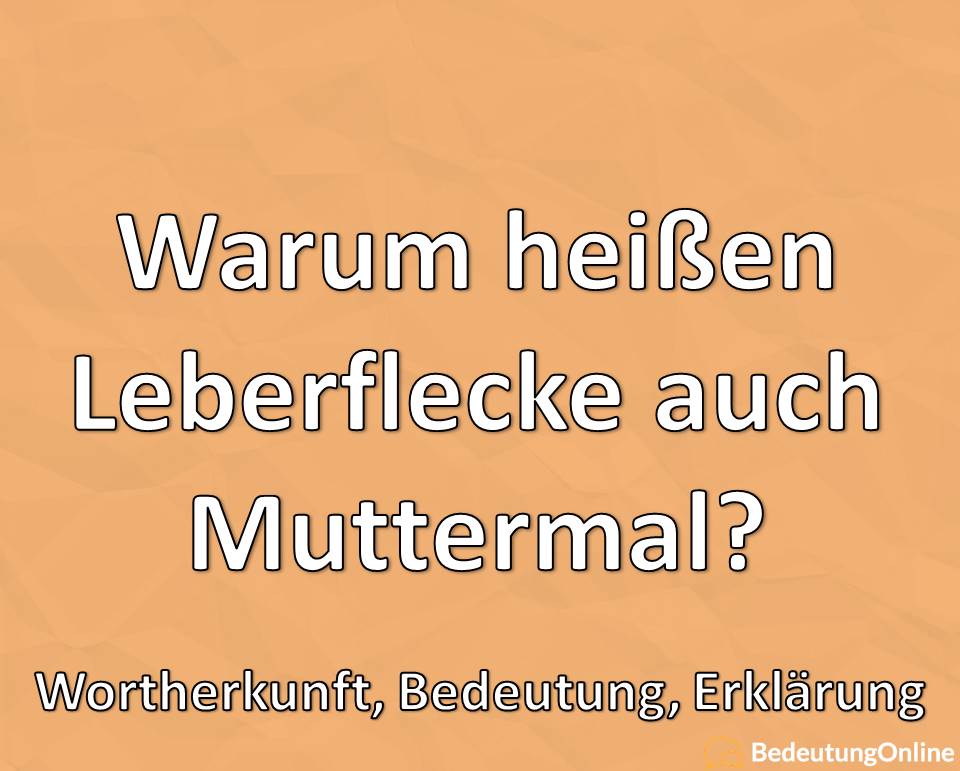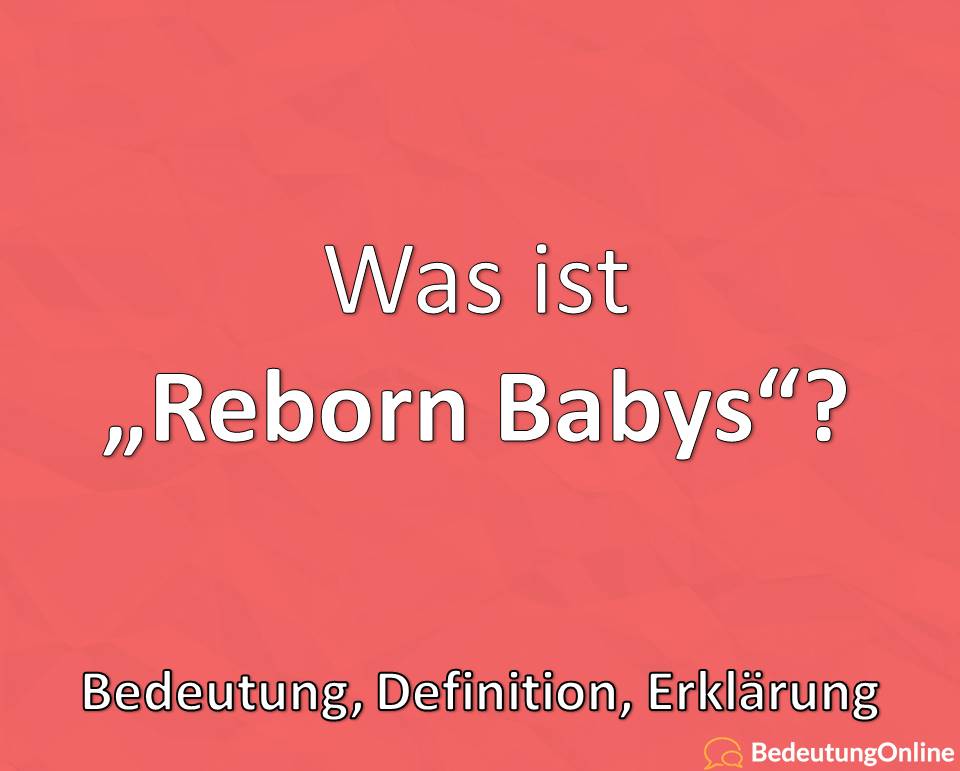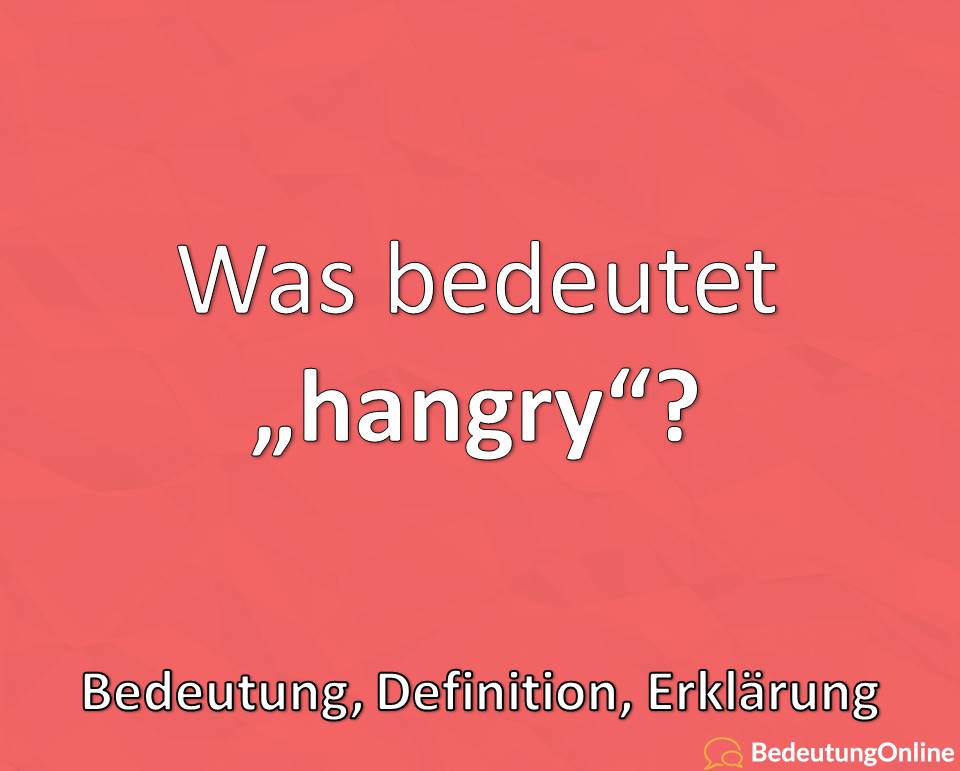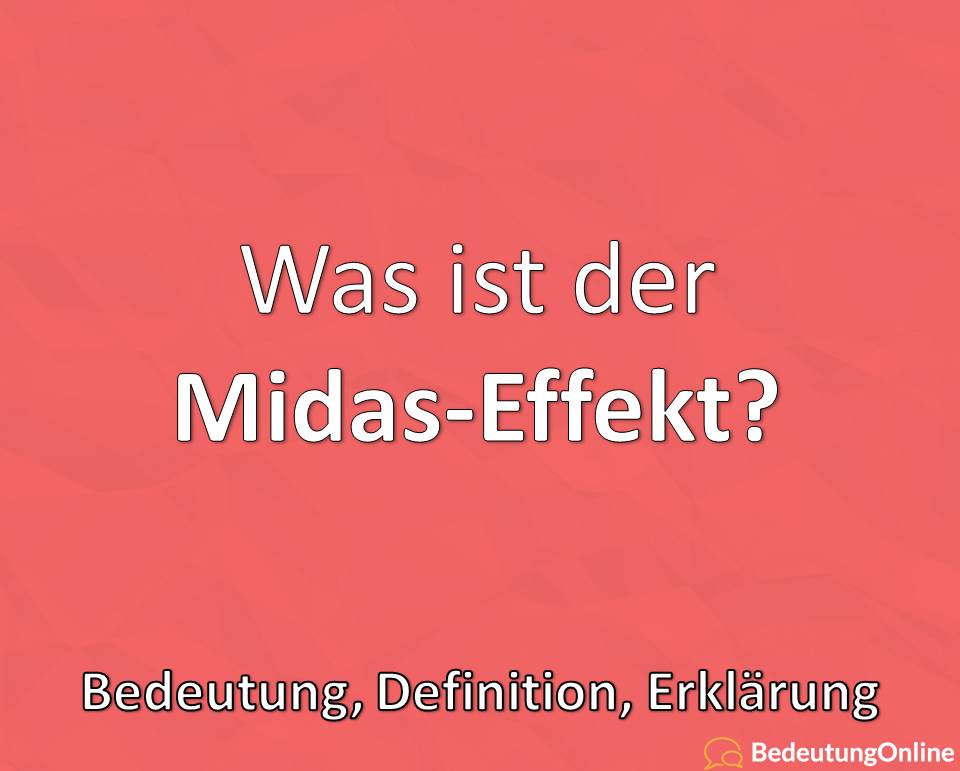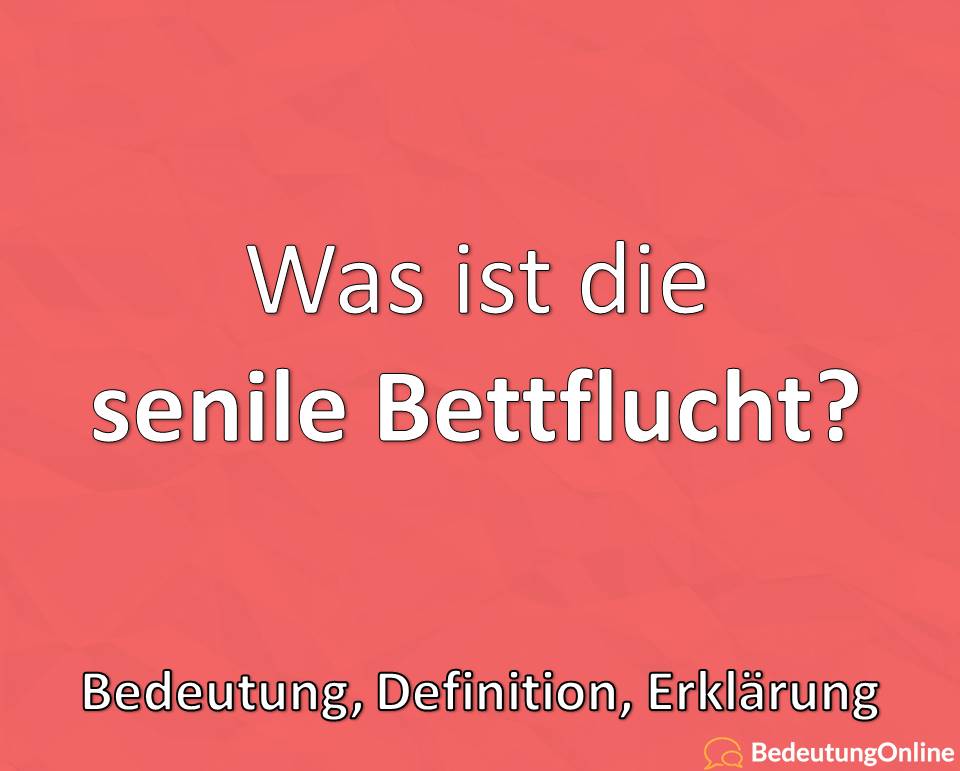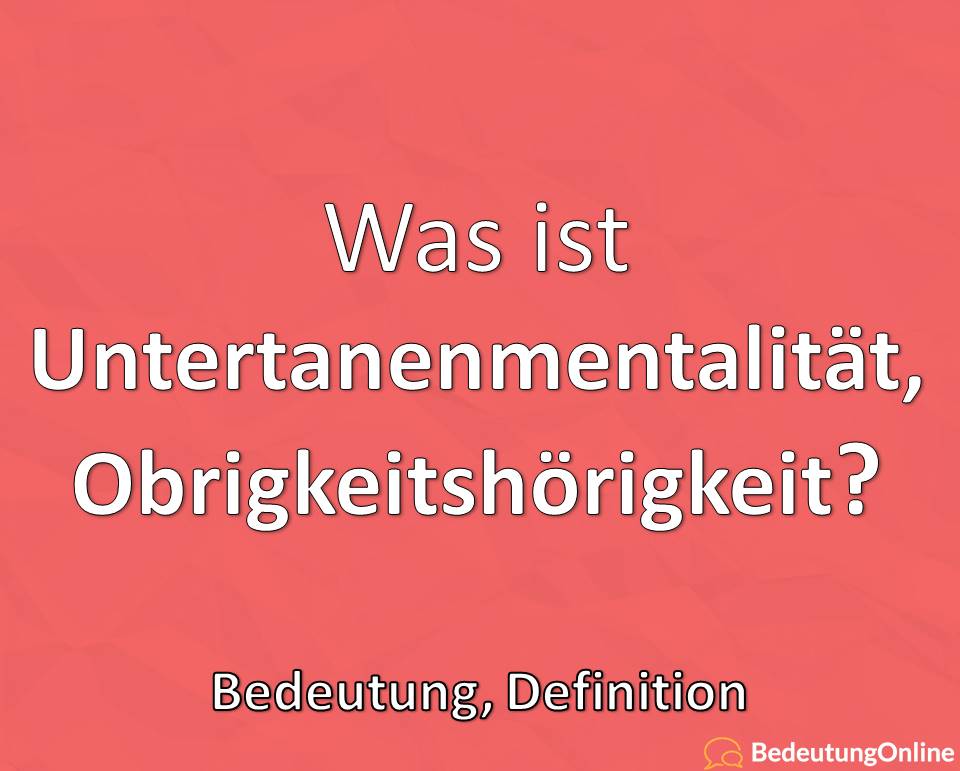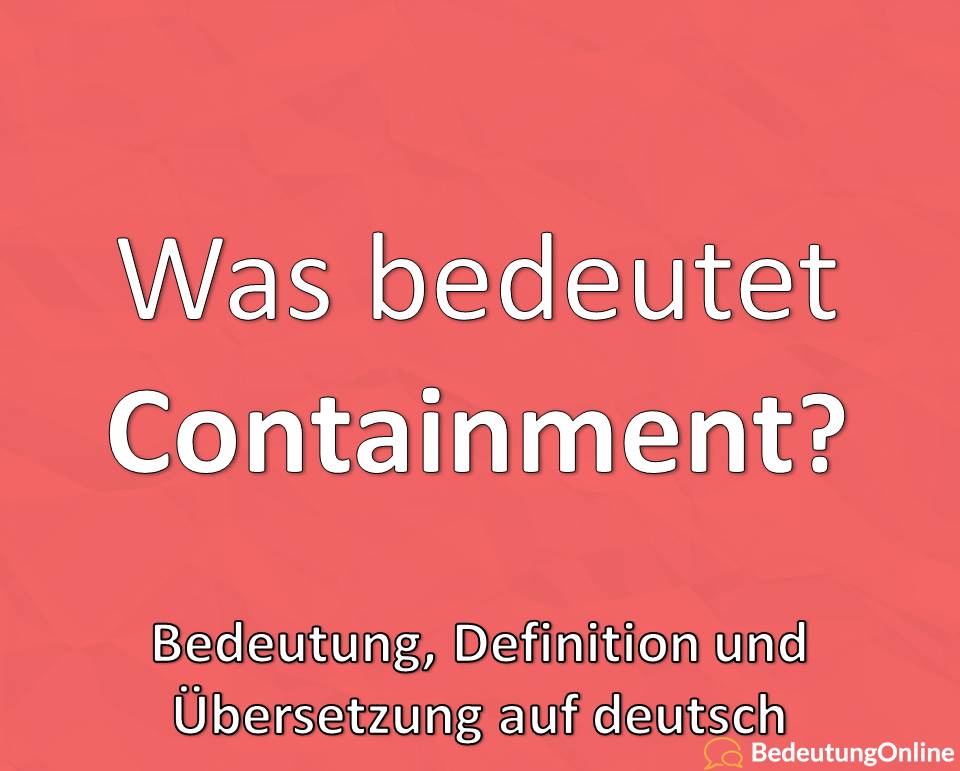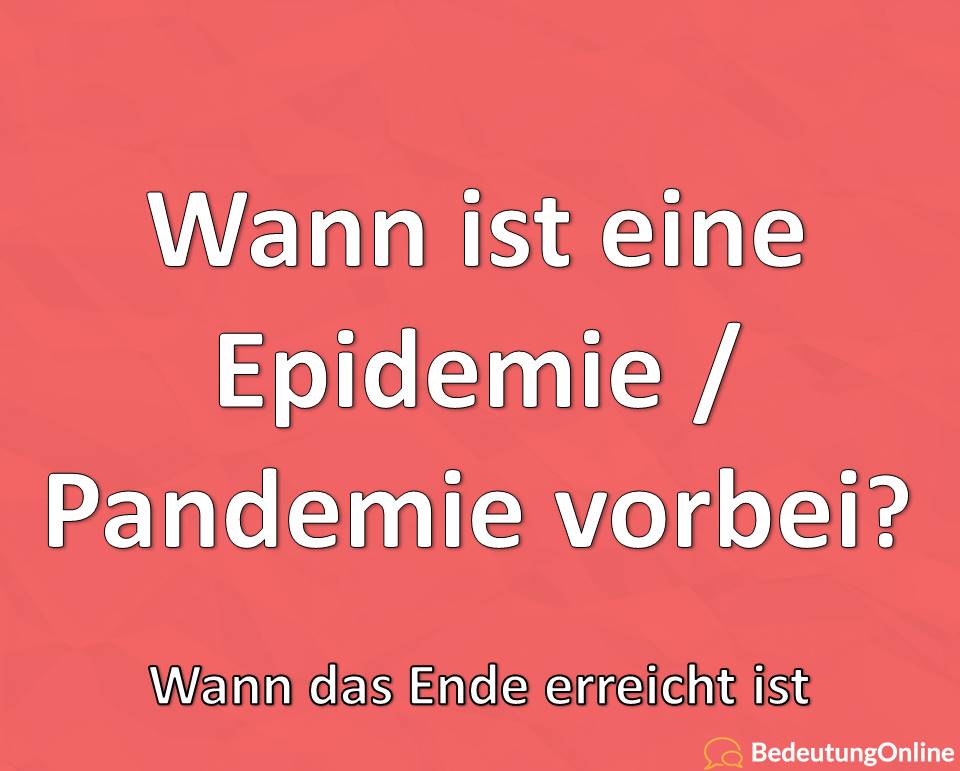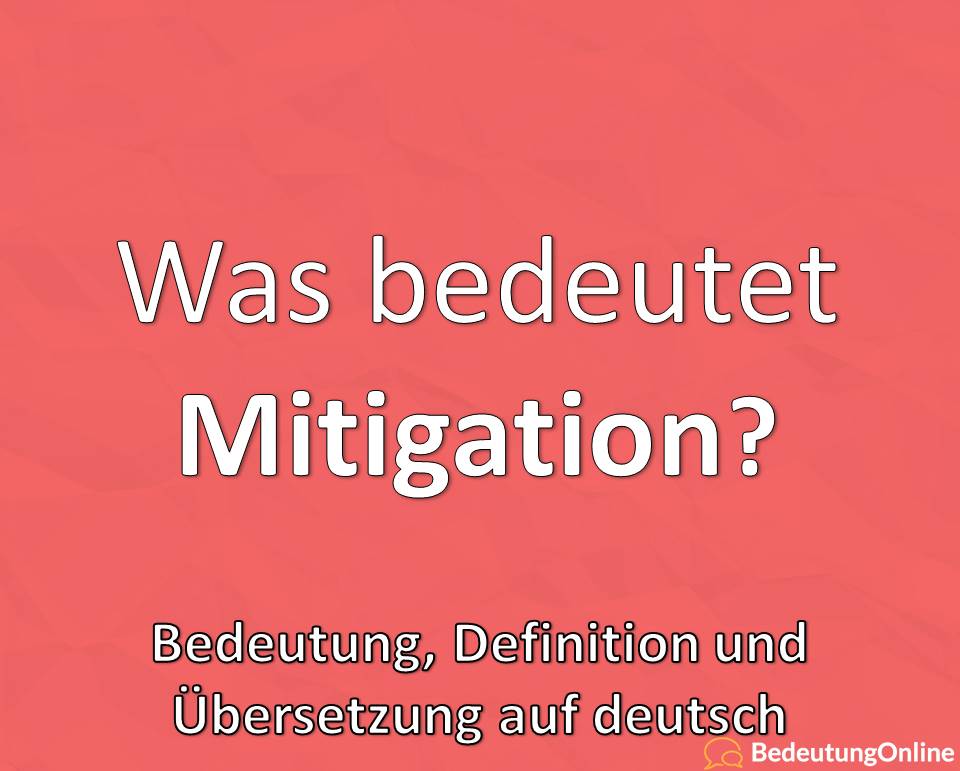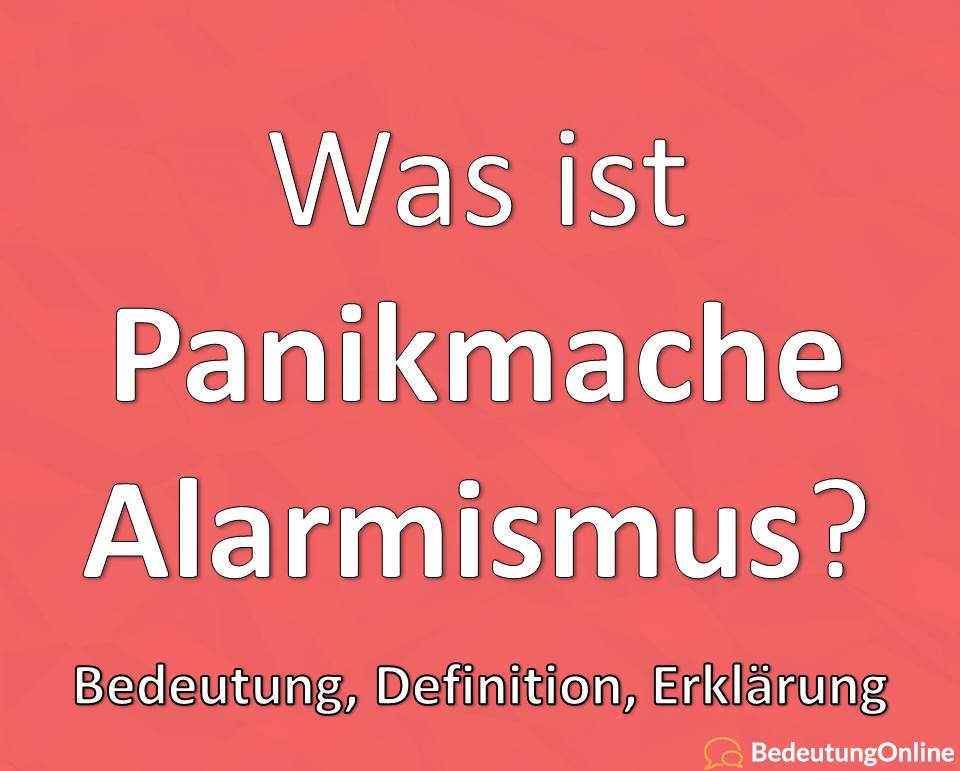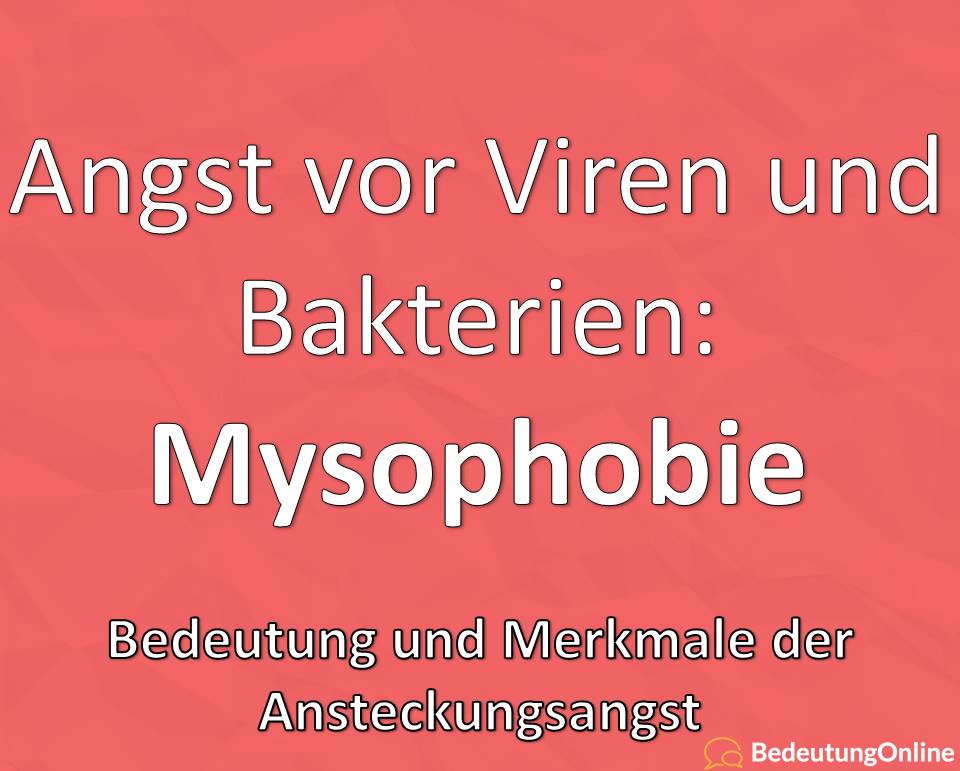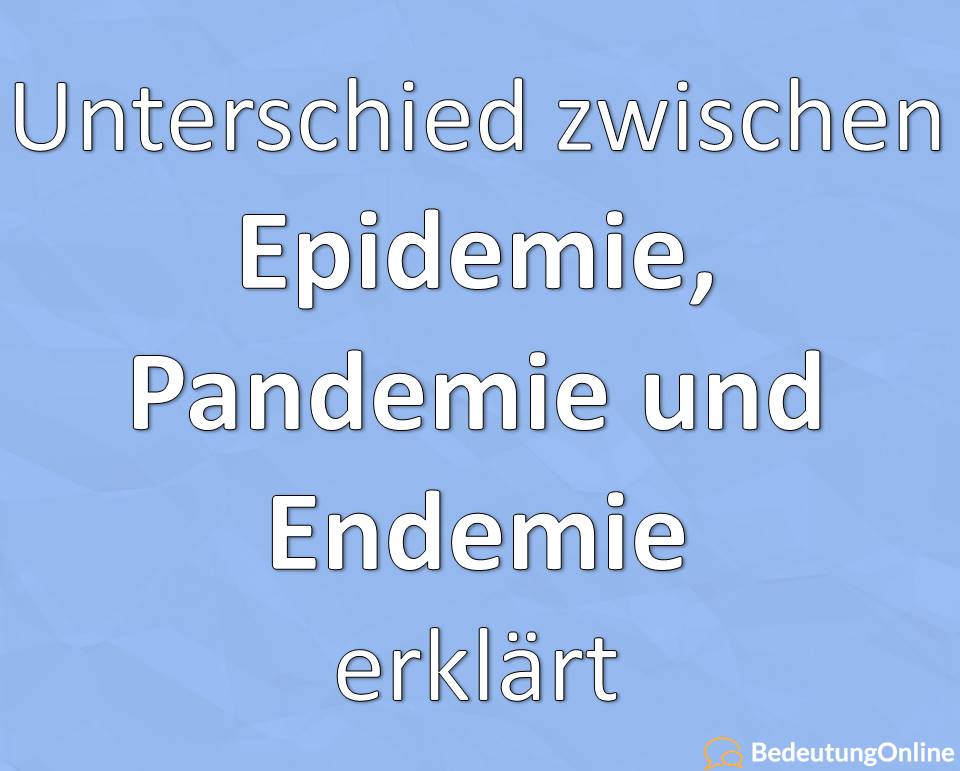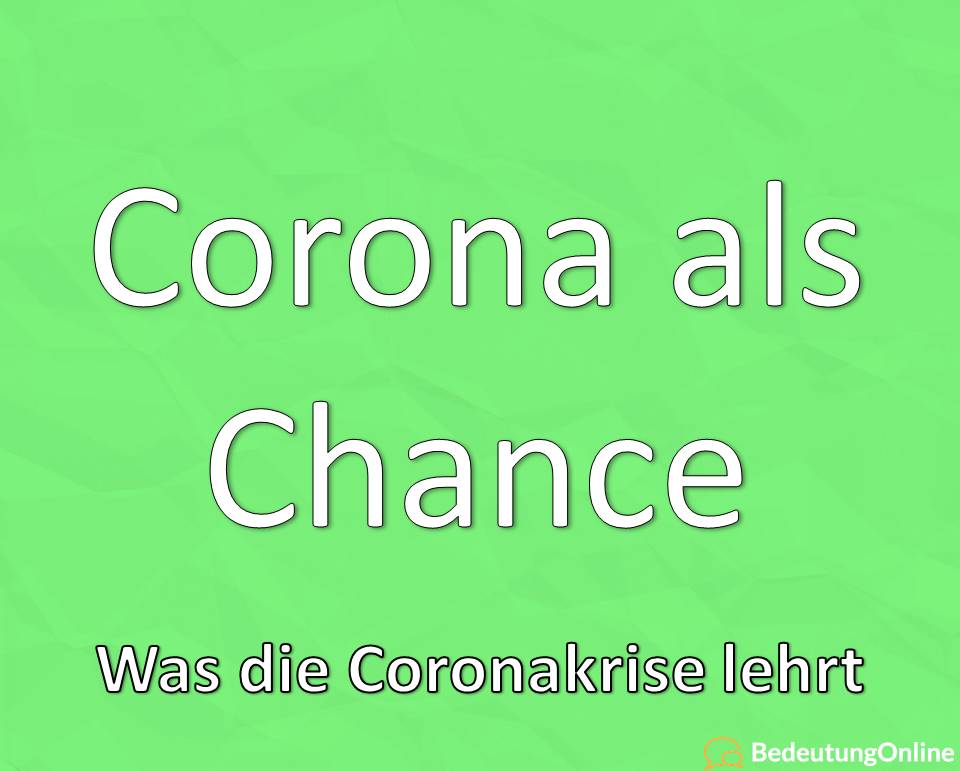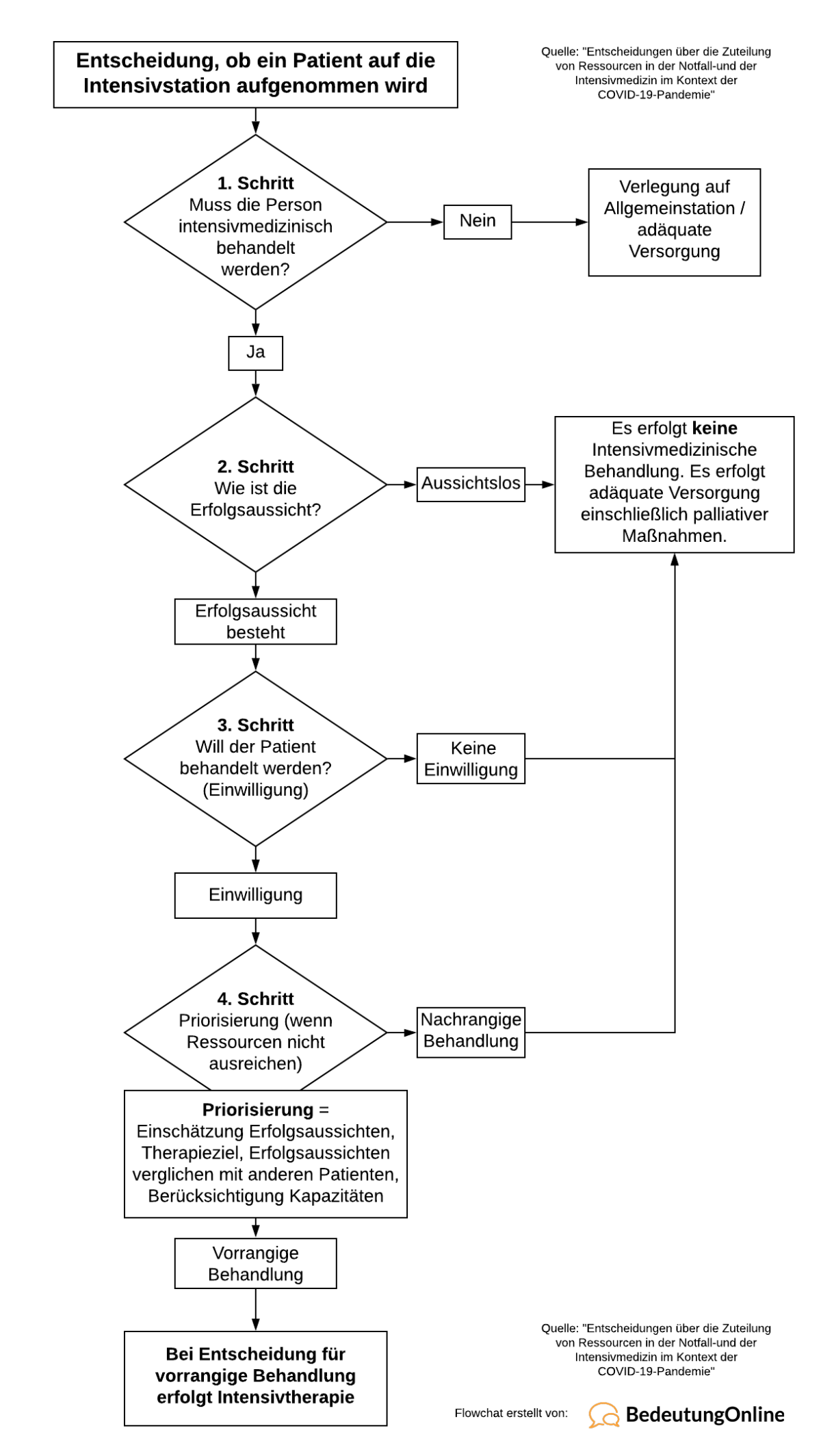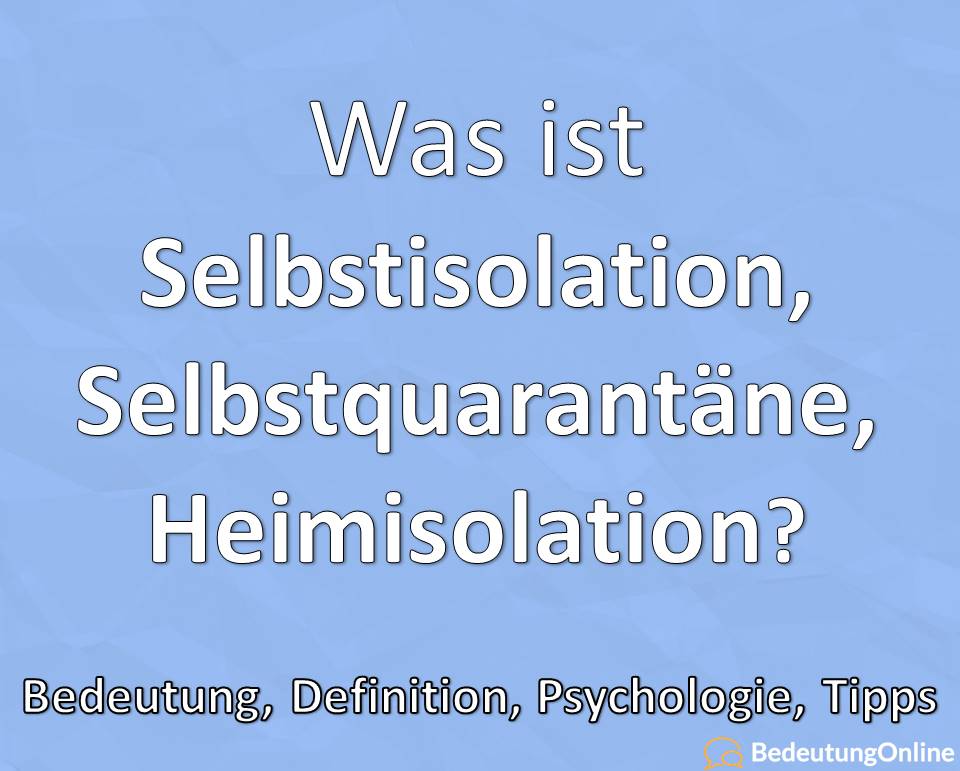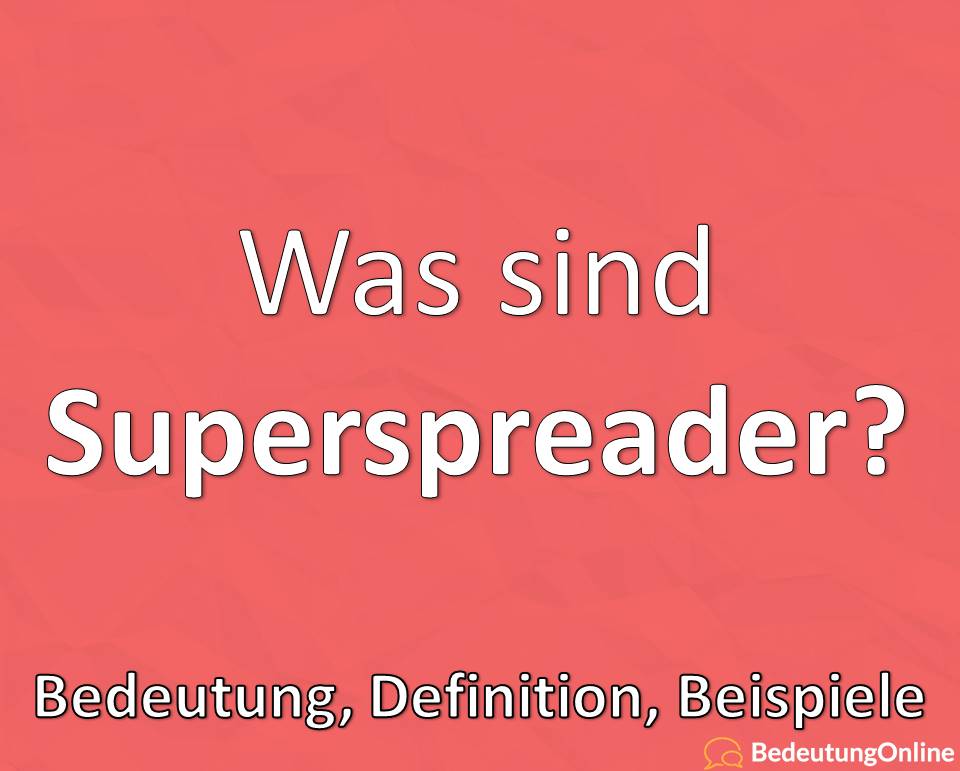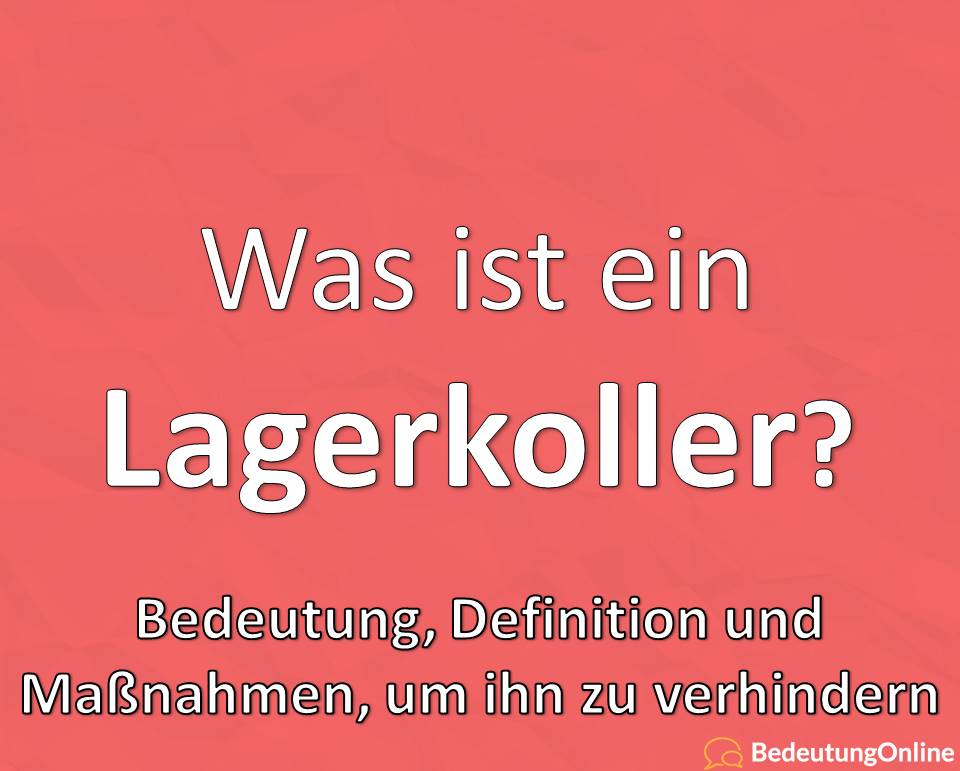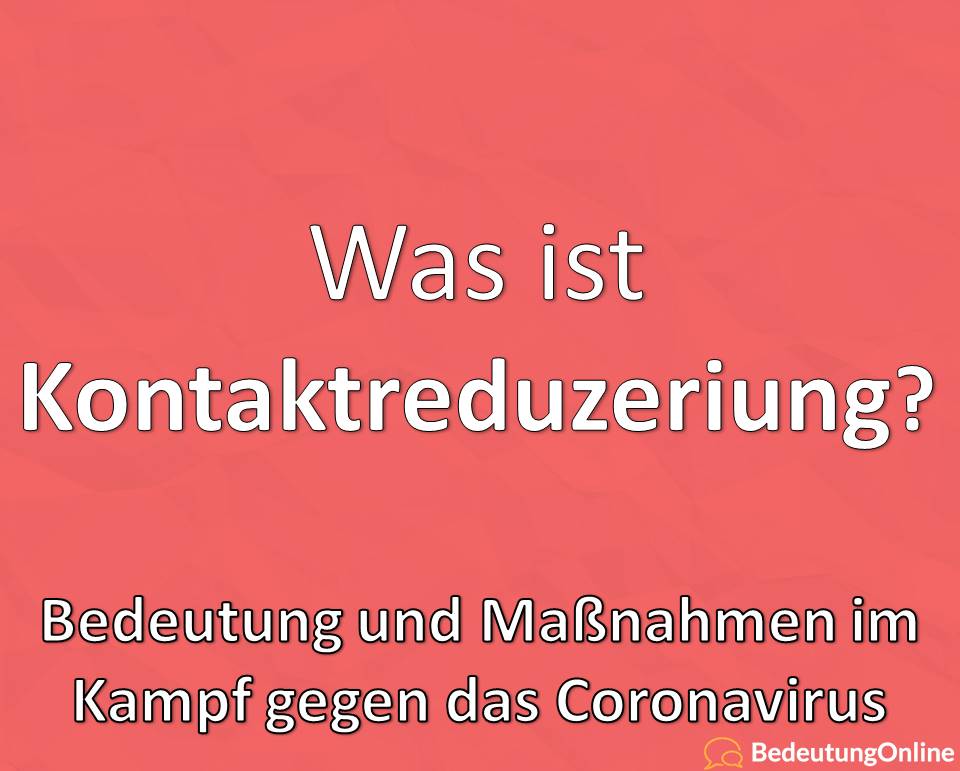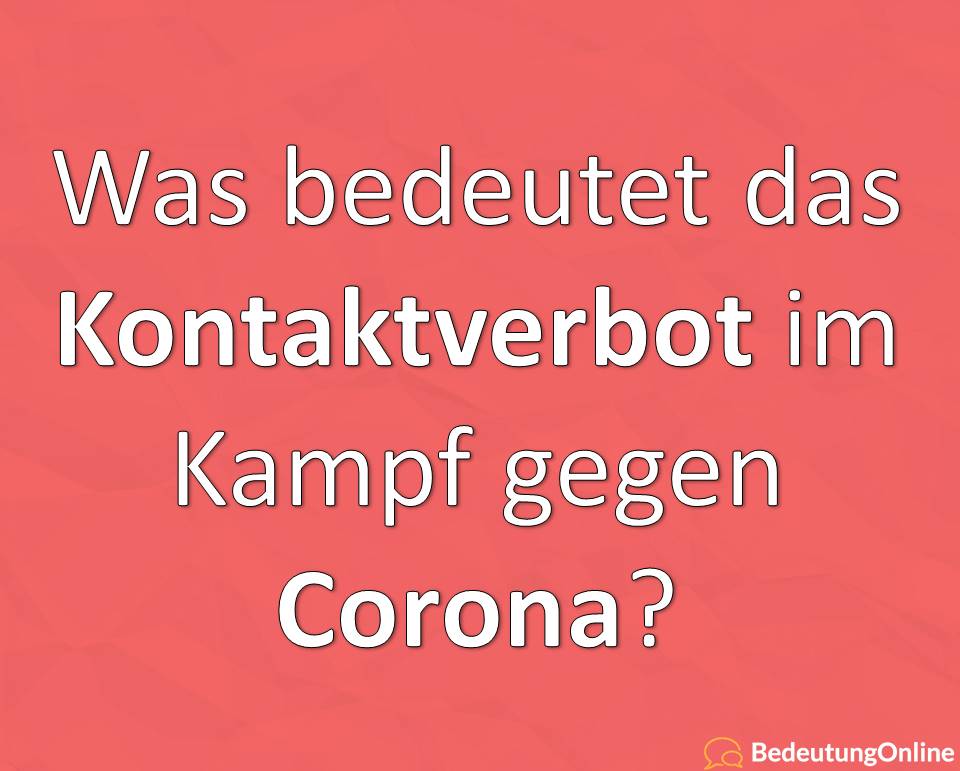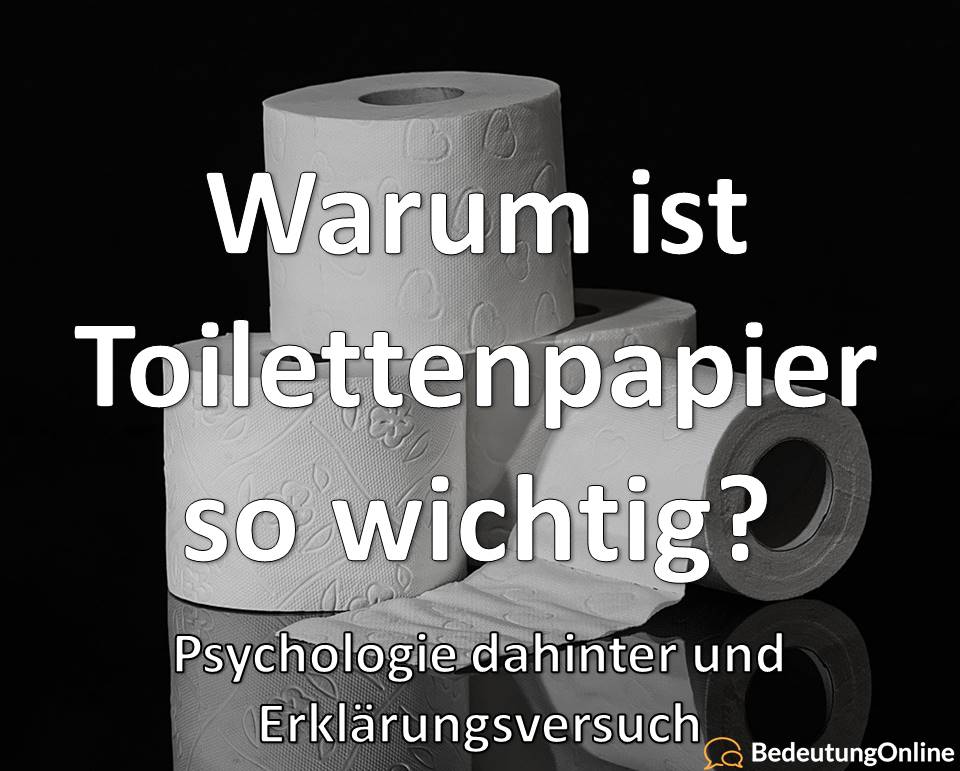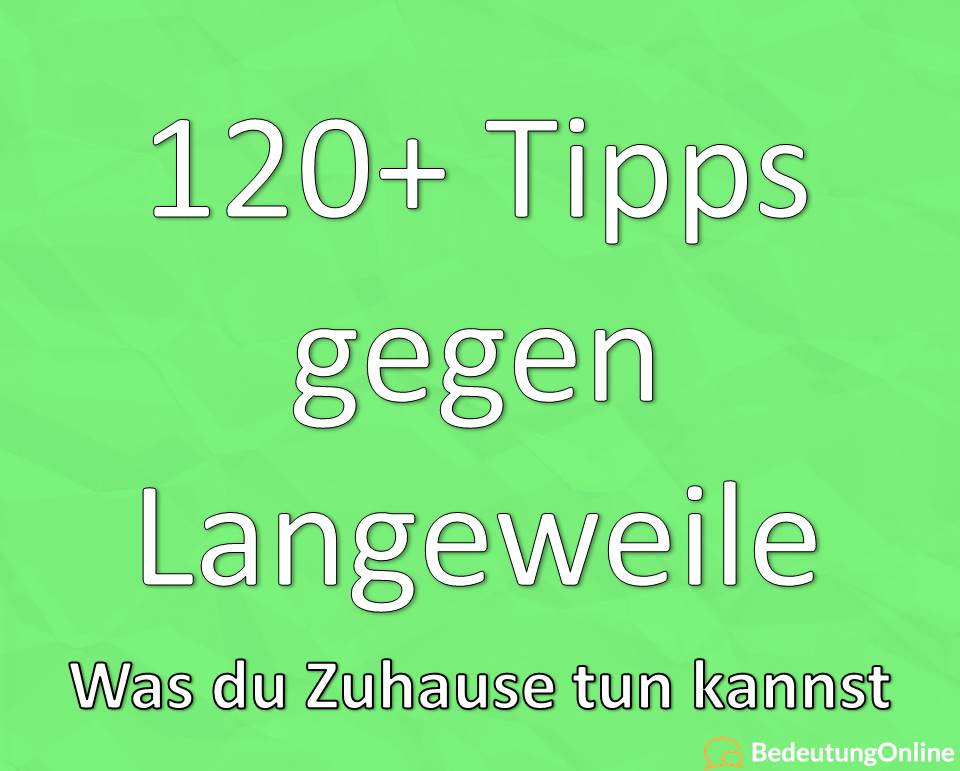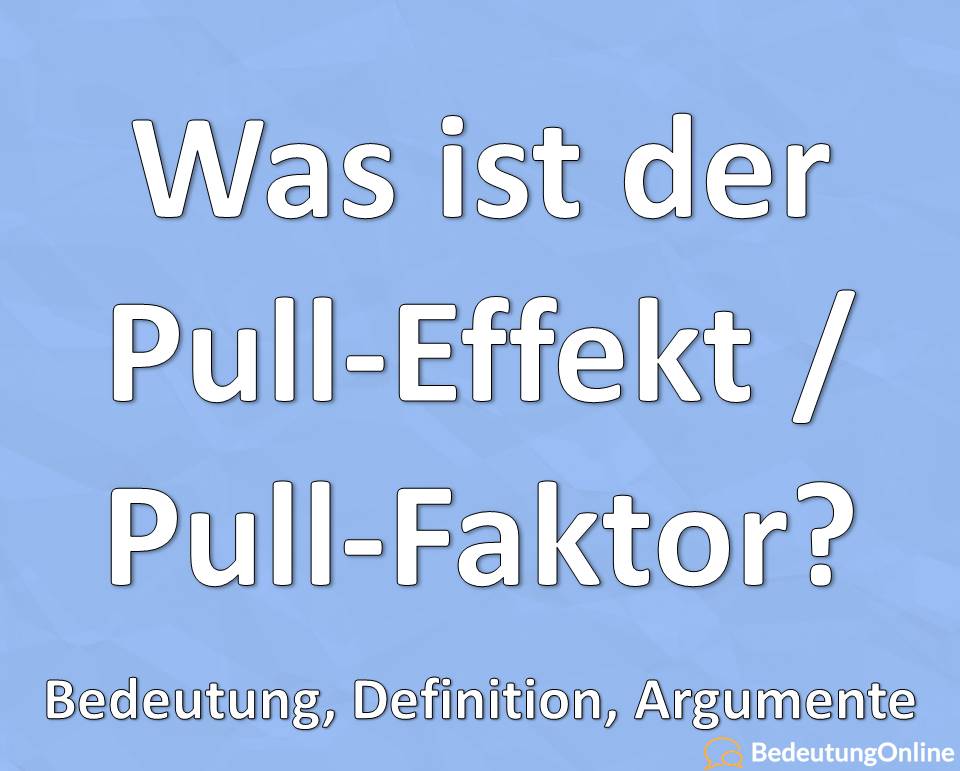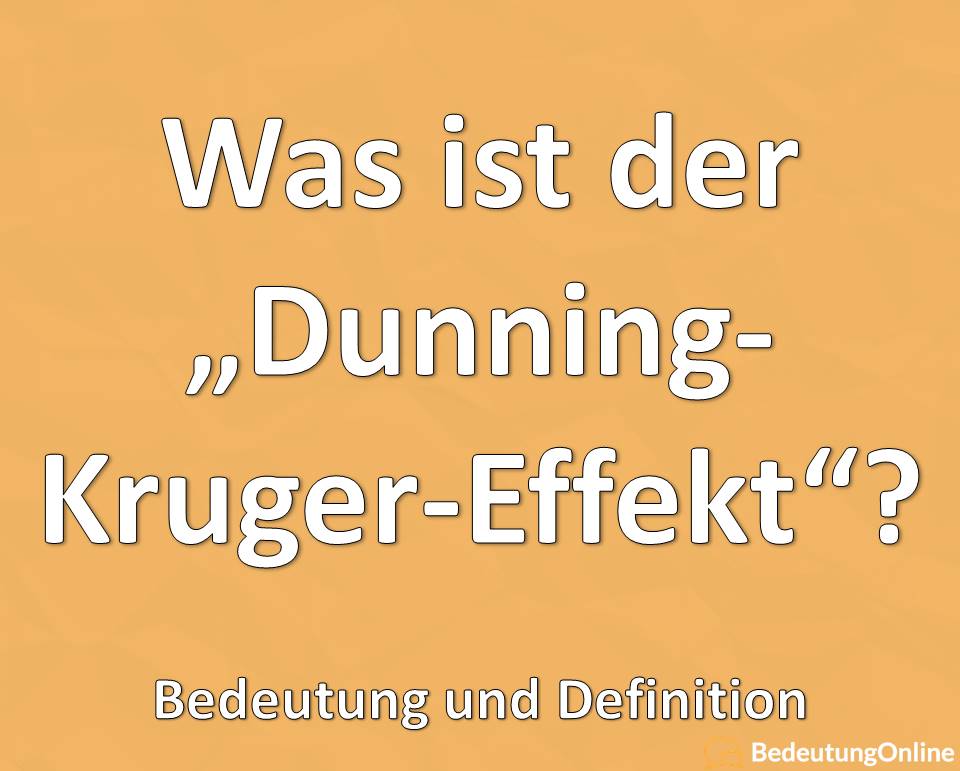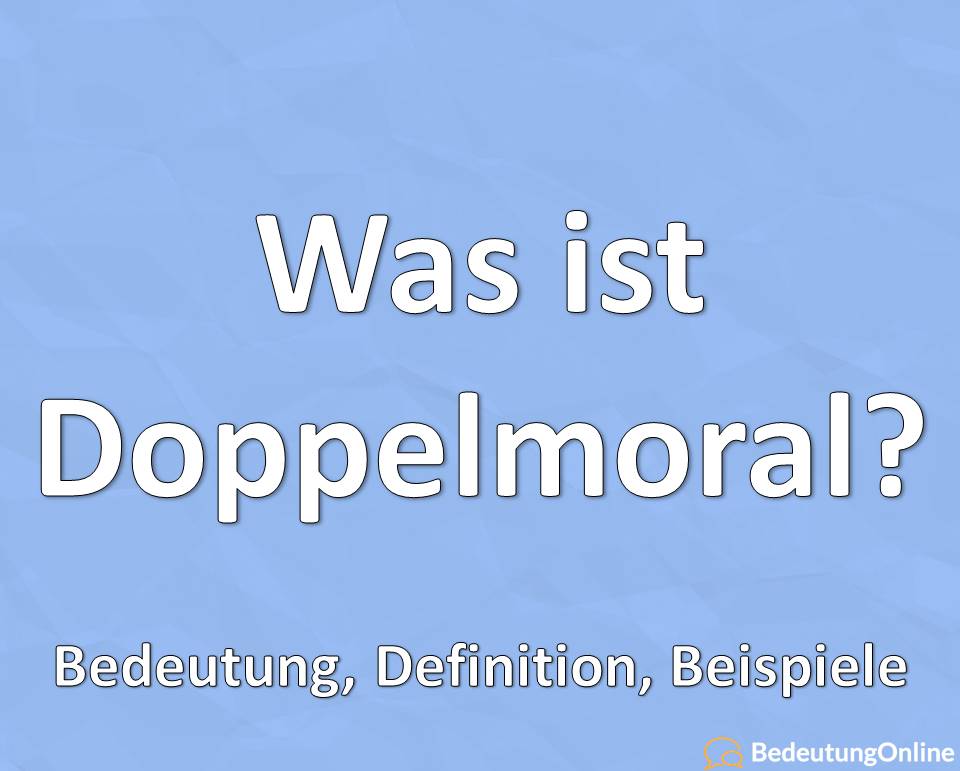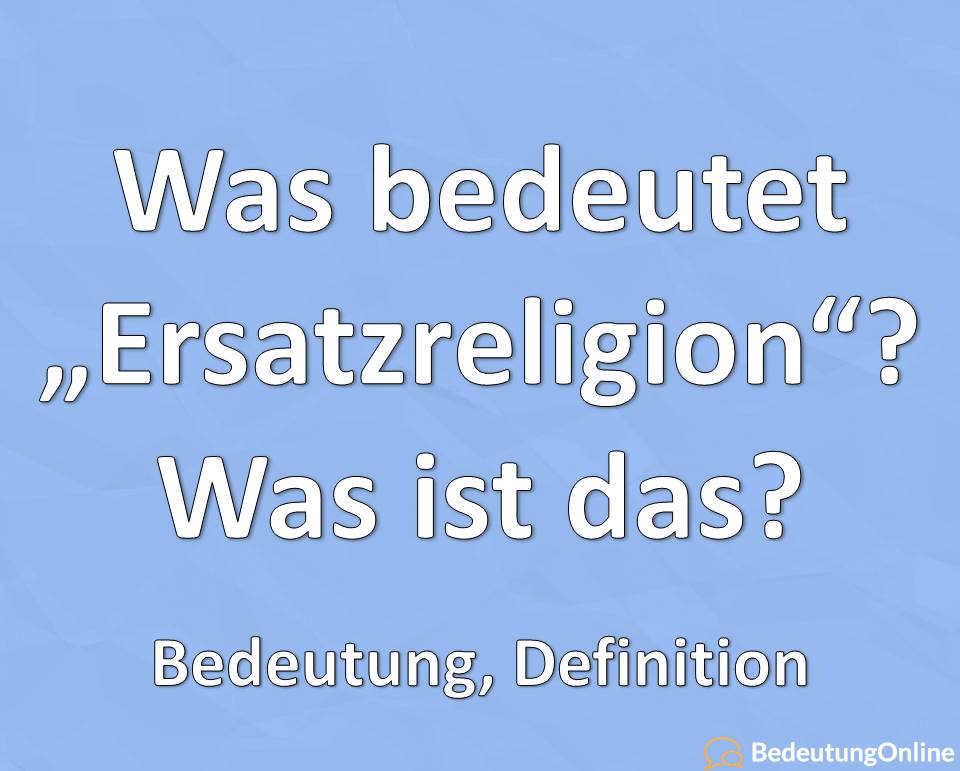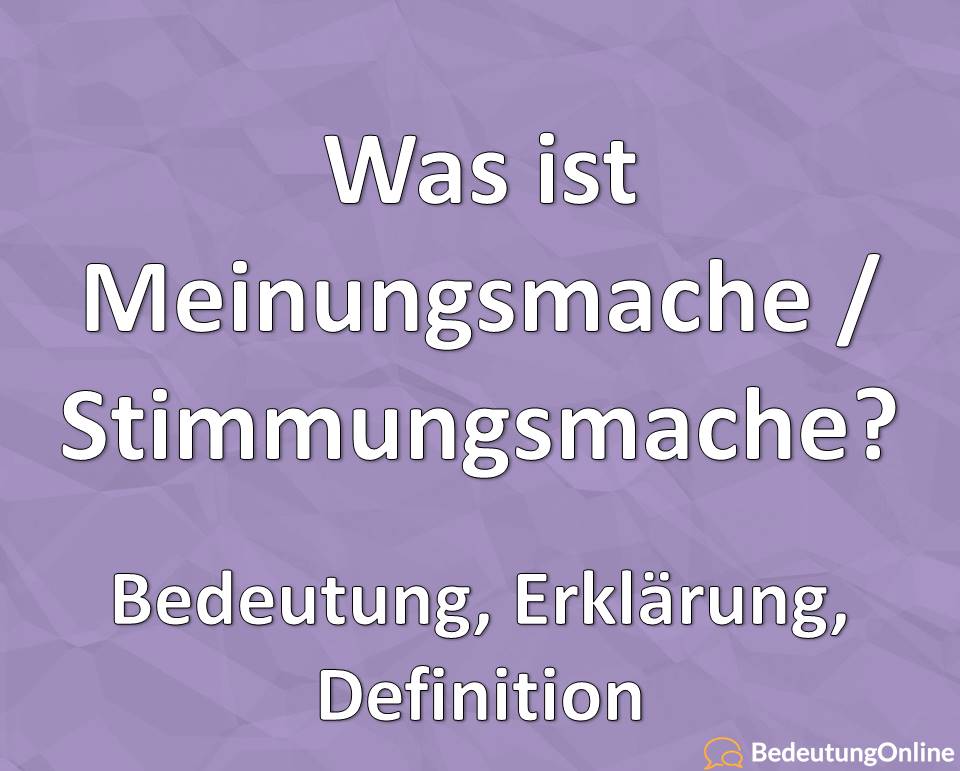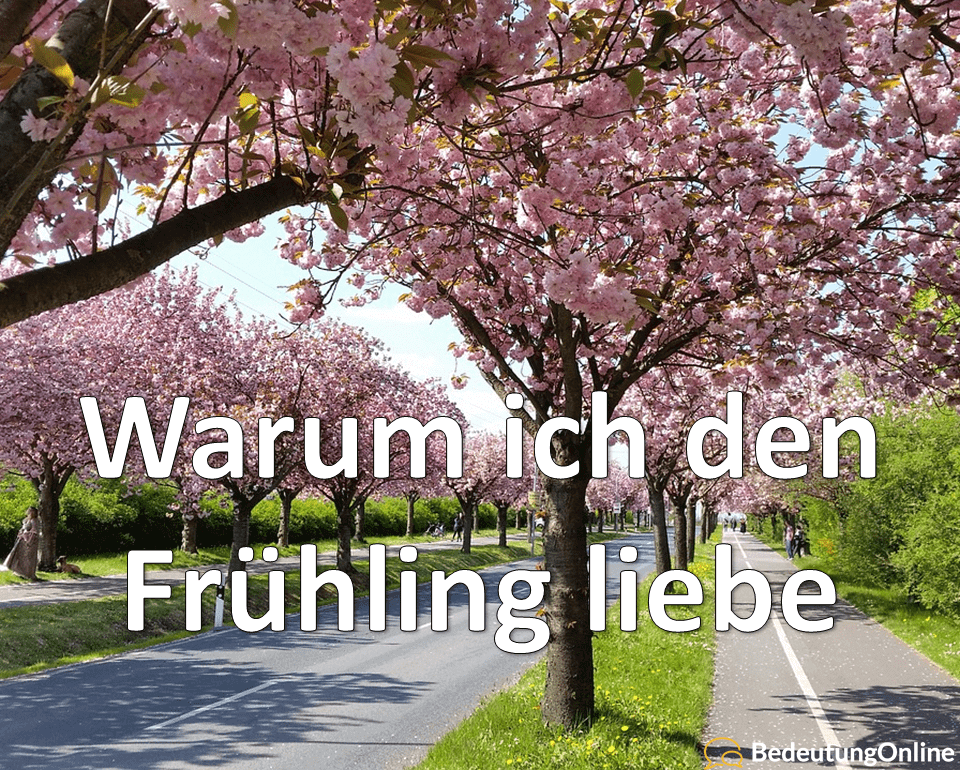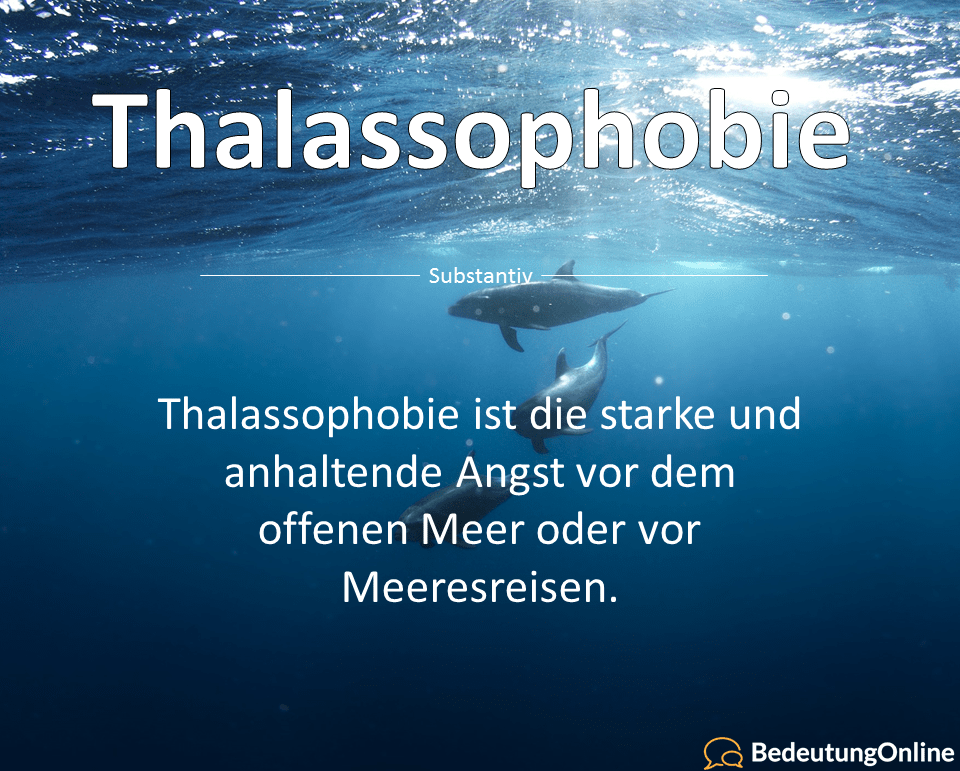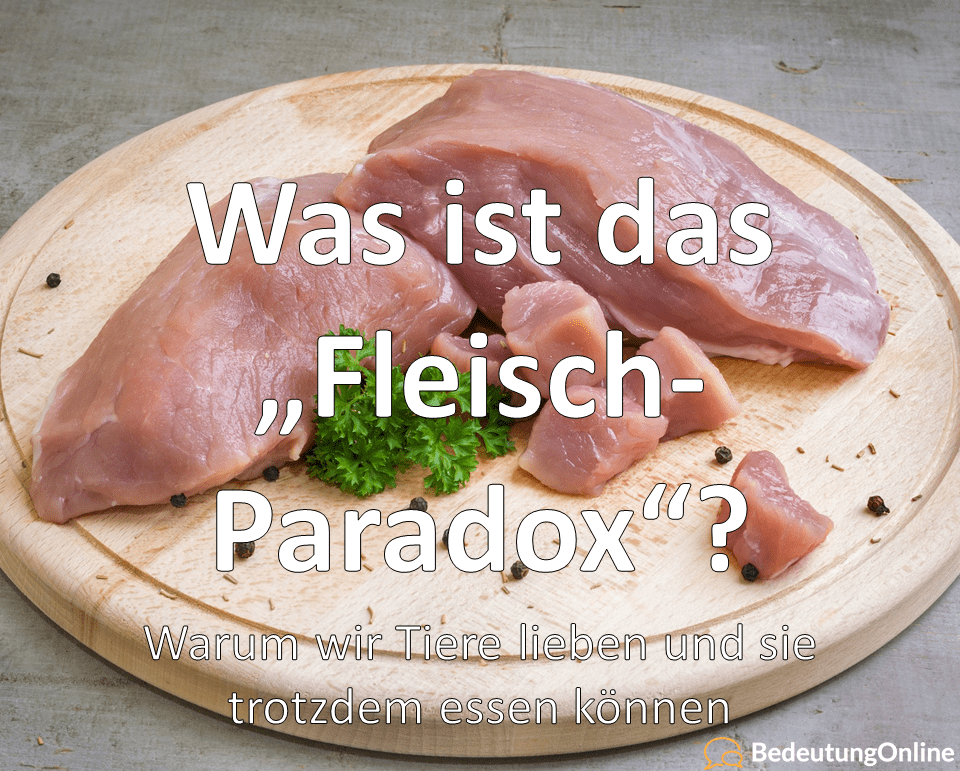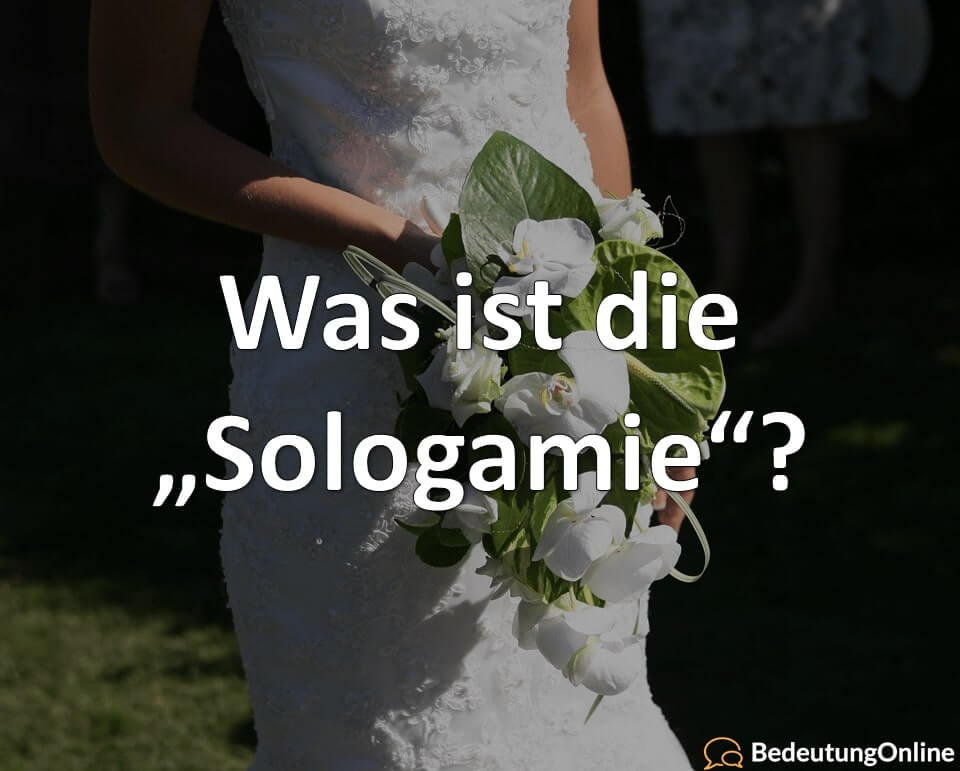Doppelmoral bedeutet, dass Verhalten und Aussagen mit zweierlei Maß bewertet werden, sowie das Verhalten und Aussagen einer Person im Widerspruch zu einander stehen.
Was ist Doppelmoral? Erklärung
Doppelmoral entsteht, wenn jemand verschiedene Grundsätze und moralische Maßstäbe gleichzeitig benutzt, was dazu führt, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt wird.
Doppelmoral hat folgende Spielarten:
- Ein bestimmtes Verhalten wird von anderen eingefordert, dass jemand selbst nicht an den Tag legt.
- Das gleiche Verhalten oder die gleichen Aussagen von Personen werden in Abhängigkeit ihrer Gruppenzugehörigkeit unterschiedlich bewertet. Eine inhaltliche / sachliche Bewertung der Aussagen ist hier zweitrangig.
- Jemand lässt eigenen moralischen Bekundungen keine Taten folgen bzw. lebt eigene moralische Bekundungen nicht. Damit entsteht ein Widerspruch zwischen den Worten und dem Verhalten.
Zu 1) Wasser predigen und Wein trinken (Doppelmoral)
Zu 1) Die Doppelmoral besteht dadrin, dass jemand von anderen etwas verlangt, was er aber selbst nicht tut. Damit kommt jener, der etwas von anderen einfordert seiner eigenen Forderung nicht nach.
Beispiele für Doppelmoral
Jemand predigt Wasser und trinkt Wein. (Zitat von Heinrich Heine aus dem Gedicht „Deutschland. Ein Wintermärchen“ von 1844) Die Doppelmoral besteht dadrin, dass jemand von anderen Enthaltsamkeit und Disziplin fordert, aber selbst nicht enthaltsam oder diszipliniert, sondern verschwenderisch lebt.
Jemand fordert, dass weniger Flugzeug geflogen werden sollte, reist aber selbst viel mit dem Flugzeug. (Siehe: Flugscham (Flygskam))
In früheren Zeiten verlangte der Adel vom gemeinen Volk, dass es enthaltsam und monogam leben soll, während der Adel selbst Untreue lebte, unzüchtig war und es Maitressen gab.
Jemand möchte die Privatsphäre der Nutzer seines sozialen Netzwerkes abschaffen, gibt aber selbst so wenig wie möglich über sich Preis.
Diese Form der Doppelmoral scheitert daran, dass jemand seinen eigenen Worten nicht folgt und nicht als positives Beispiel vorangeht. Diese Personen werden auch „Heuchler“ genannt und es wird hier von „Scheinheiligkeit“ gesprochen. Das Gegenteil ist, dass jemand seinen eigenen Worten Folge leistet und Integrität beweist, sowie damit eine Vorbildfunktion einnimmt.
Diese Form der Doppelmoral hat auch einen Charakter der Selbstgerechtigkeit. Denn Verhalten, das bei anderen negativ bewertet wird, bewertet jemand bei sich selbst positiv oder gar nicht. Damit stellt sich diese Person über andere Menschen und verletzt den Grundsatz der Gleichheit. Diese Person macht quasi eine Ausnahme von der Regel für sich selbst oder für ihre Gruppe.
Beispiel: Jemand rechtfertigt eine Straftat damit, dass sie der (eigenen) guten Sache dient. Während die gleiche Straftat, wenn sie von anderen begangen wird, abgelehnt wird und bestraft werden sollte. (Trotz gleicher Straftaten erfolgt eine unterschiedliche moralische Bewertung.)
Je nachdem, ob eine Person von ihrer Doppelmoral weiß oder nicht, sollte das Verhalten unterschiedlich bewertet werden. Ist einer Person ihre Doppelmoral noch nicht bewusst, so sollte sie darauf hingewiesen werden. Ist einer Person ihre Doppelmoral bewusst, so kann ihr fast unterstellt werden, dass sie verlogen ist.
Zu 2) Bewertung nach Gruppenzugehörigkeit, nicht nach Inhalt (Doppelmoral)
Zu 2) Das Verhalten oder die Aussagen einer Person werden in Abhängigkeit ihrer Gruppenzugehörigkeit unterschiedlich bewertet. Auch gilt, dass in Abhängigkeit der Motivation und der Ziele einer Person bei Einsatz gleicher Mittel eine unterschiedliche Bewertung stattfindet.
Diese Form der Doppelmoral führt zu einem Ungleichgewicht und eine Asychronität, welche zu einer Einseitigkeit führt. Das Ergebnis ist, dass eine Seite überbewertet wird, während die andere Seite unterbewertet wird, sowie dass eine Seite sehr positiv bewertet wird, während eine andere Seite sehr negativ bewertet wird. (Diese fast schon schwarz-weiße Einteilung wird durch den menschlichen Drang nach Bestätigung / Einheitlichkeit verstärkt. Denn, wenn jemand eine Sache negativ bewertet, so wird diese Person viel negatives über eine Sache entgegen und positives ausblenden.)
Beispiele für Doppelmoral
Demonstrationen sind okay, wenn sie den eigenen Zielen dienen. Dienen sie nicht den eigenen Zielen oder wird gegen etwas, dass gegen die eigenen Wertvorstellungen ist, demonstriert, so sind diese Demonstrationen nicht okay. (Siehe auch: NPC-Meme)
Ein Beispiel sind die Pegida-/ Anti-Flüchtlingspolitik-Demonstrationen und die Fridays-For-Future-Demonstrationen. Beide Demonstrationen finden innerhalb der gesetzlich erlaubten Rahmen statt, werden aber in den Medien sehr unterschiedlich bewertet. (Die unterschiedliche Bewertung liegt auch an den unterschiedlichen Zielen der Demonstrationen, welche wiederum auch unterschiedlich moralisch bewertet werden.)
Weitere Beispiele für Doppelmoral:
Eine Nation oder ein Staatenbündnis toleriert, dass Menschenrechtsverletzungen durch einen anderen Staat begangen werden, obwohl sie sich dagegen ausgesprochen haben.
Eine andere Form der Doppelmoral ist es, dass Männern sexuelle Freizügigkeit zugestanden wird, während sie bei Frauen abgelehnt wird. Hier gelten verschiedene Maßstäbe der Sittlichkeit.
Zu 3) Seine Worte nicht leben – Worte und Taten stehen im Widerspruch (Doppelmoral)
Zu 3) Die dritte Spielart der Doppelmoral betrifft den einzelnen Menschen. Hierbei geht es darum, dass jemand zwar moralische Bekundungen äußert, aber diese nicht lebt.
Beispiele für Doppelmoral:
Jemand spricht sich gegen Massentierhaltung aus, kauft aber im Supermarkt Billigfleisch. Oder: Jemand findet es schlecht das Tiere für den eigenen Genuss sterben und isst trotzdem Fleisch. (Siehe: Fleisch-Paradox)
Jemand fordert Meinungsfreiheit ein, zensiert aber unliebige Meinungen.
Politische Korrektheit ablehnen und später politische Korrektheit einfordern.
Jemand sagt, dass er Christ ist und christliche Werte lebt, spendet aber Armen nichts oder hilft Menschen in Not nicht.
Jemand spricht sich für Treue aus und geht fremd.
Jemand fordert gute Arbeitsbedindungen in der Dritten Welt und kauft das in der dritten Welt produzierte T-Shirt für 2 Euro.
Jemand redet schlecht über andere und ist entsetzt, wenn andere schlecht über ihn oder sie selbst reden.
Jemand gibt vor Kunst interessiert zu sein, hat aber noch nie eine Kunstausstellung besucht.
Andere kritisieren, aber selbst keine Kritik aushalten.
Diese Form der Doppelmoral entsteht, wenn jemand seinen moralischen Bekundungen und Äußerungen keine Folge leistet.
Doppelmoral kann auch entstehen, wenn jemand widersprüchliche Aussagen zu verschiedenen Zeitpunkten macht. Hier kann dieser Person dann eine gewisse Unentschlossenheit und Inkonsistenz vorgeworfen werden. Auch muss angemerkt, dass es sinnvoll sein kann eine Meinung zu ändern. Nämlich dann, wenn sich Rahmenbedingungen geändert haben.
Über die Doppelmoral: Bedeutung und Psychologie
Doppelmoral ist so alt wie die Menschheit. Es ist dem Menschen angeboren, dass er widersprüchlich ist und auch widersprüchliche Dinge tut. Auch ist es dem Menschen angeboren über Doppelmoral hinwegzuschauen oder sie auszublenden. Menschen mögen keine Ambivalenz.
Doppelmoral wegen mangelnder Eigenwahrnehmung
Doppelmoral verschwindet, wenn die Selbst- bzw. Eigenwahrnehmung steigt und besser wird. Selbstwahrnehmung ist nämlich einer der Gründe für Doppelmoral: Manchen Menschen ist es einfach nicht bewusst, dass sie sich widersprüchlich verhalten. Auch verschwindet Doppelmoral, wenn Menschen aufhören anderen vorzuschreiben, wie sie leben wollen.
Es ist eben normal, dass Menschen eine gewisse Doppelmoral besitzen. Denn erst mit fortschreitenden Alter sehen sie manche Dinge klarer und durchschauen auch mehr.
Wer mehr über seine Werte lernt und auch mehr über Werte, die sich widersprechen, kann auf den Vorwurf Doppelmoral reagieren. Im besten Fall erfolgt eine Korrektur des Verhaltens, keine Abwehr.
Doppelmoral entsteht auch dadurch, dass Menschen sich gut und wohl fühlen wollen. Sie wollen sich moralisch gut fühlen, anstatt stets mit der (unschönen) Realität konfrontiert zu werden. Sich moralisch gut zufühlen, findet eben statt, wenn jemand moralisch-wertvolle Äußerungen tätigt. (Moralische Menschen genießen auch mehr Ansehen in der Gesellschaft.)
Doppelmoral: Moralische Lizenzierung
Ein psychologisches Phänomen, das Doppelmoral erklärt, ist die „Moralische Lizensierung“ (Englisch: „moral licensing“)
Moralische Lizensierung bedeutet, dass jemand etwas schlechtes tun kann, weil er vorher etwas gutes getan hat. Hierbei wird das schlechte Verhalten gegen das gute aufgewogen, so dass jemand keine Schuldgefühle hat.
Beispiele:
Jemand kauft Bio-Gemüse oder im Bio-Laden ein, also ist es vertretbar die Einkäufe mit dem Auto nach Hause zu fahren.
Wer viel Sport macht, darf auch mal Chips oder Fast Food essen und dazu ein Bier trinken. Oder: Wer viel Sport macht, darf rauchen.
Folgen der Doppelmoral
Wird Doppelmoral erkannt oder aufgedeckt, so verringert dies die Glaubwürdigkeit einer Person. Doch es zeigt auch eins, nämlich, dass die Realität eine Person eingeholt hat und dass die Realität oft komplexer ist, als so mancher denkt.
Doppelmoral erkennen als Schutz
Doppelmoral wird in der bürgerlichen Gesellschaft als Anlass zur Selbstkritik und Kritik genutzt. Doppelmoral ist damit ein Anlass Werte in Frage zu stellen. Dies wird unterschiedlich genutzt. Z.B.: Eine Person verwahrt sich gegen eigentlich moralisch richtige Forderungen anderer, weil sie entdeckt hat, dass eine Person doppelmoralisch lebt. (Die Forderungen bleiben trotzdem moralisch richtig. Nur ist die doppelmoralische Person ein schlechtes Beispiel, um für die moralisch richtige Position zu werben, da es ihr an Glaubwürdigkeit mangelt. Die sich verwahrende Person kann nun den aktuellen Zustand erhalten und muss ihr Verhalten nicht ändern oder ihre Komfortzone verlassen. (Auch das ist ein essentielles menschliches Bedürfnis. Menschen mögen Veränderungen nicht.)
Die Existenz der Doppelmoral auch steht dafür, dass ein Mensch nicht immer eins mit seinen Werten. Dieser Relativismus wird z.B. in verschiedenen Räumen ausgelebt: Im privaten ist jemand z.B. freizügiger als in der Öffentlichkeit. Für jeden einzelnen gilt es daher, dass er eine gewisse moralische Ambilvanz aushalten muss.
Synonyme für Doppelmoral
Der englische Ausdruck „double standard“ hat sich mittlerweile in der deutschen Sprache in der deutschen Variante „Doppelstandard“ verbreitet.
Weitere Synonyme sind:
- Bigotterie
- Doppelstandard
- Doppelzüngigkeit
- Heuchelei
- Moraldualismus / moralischer Dualismus
- Verlogenheit