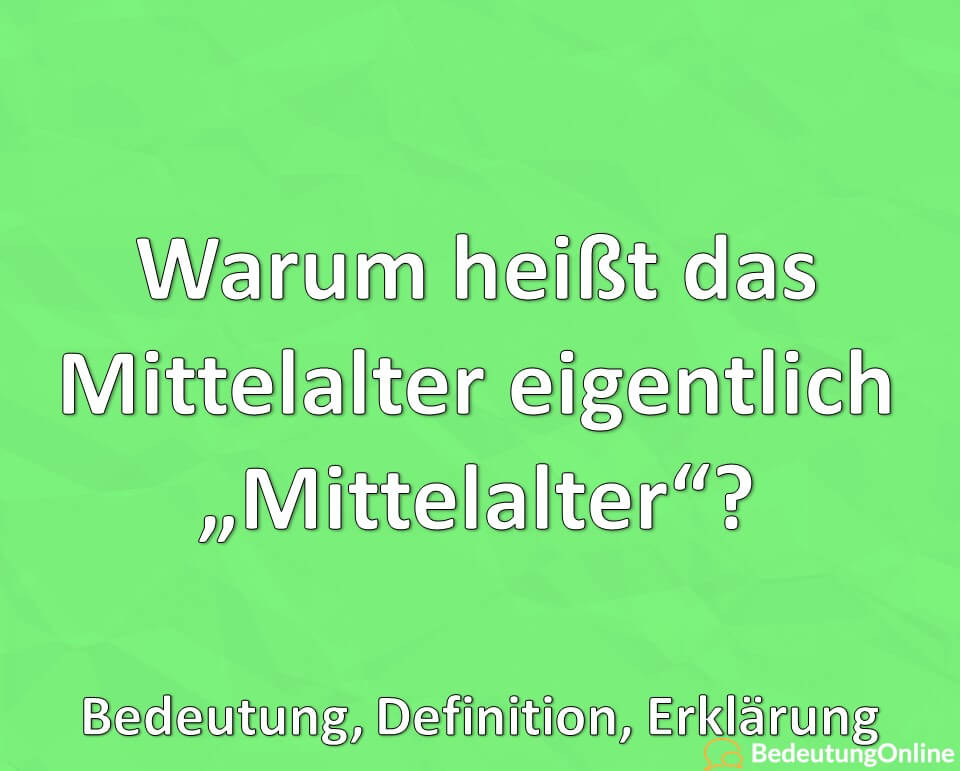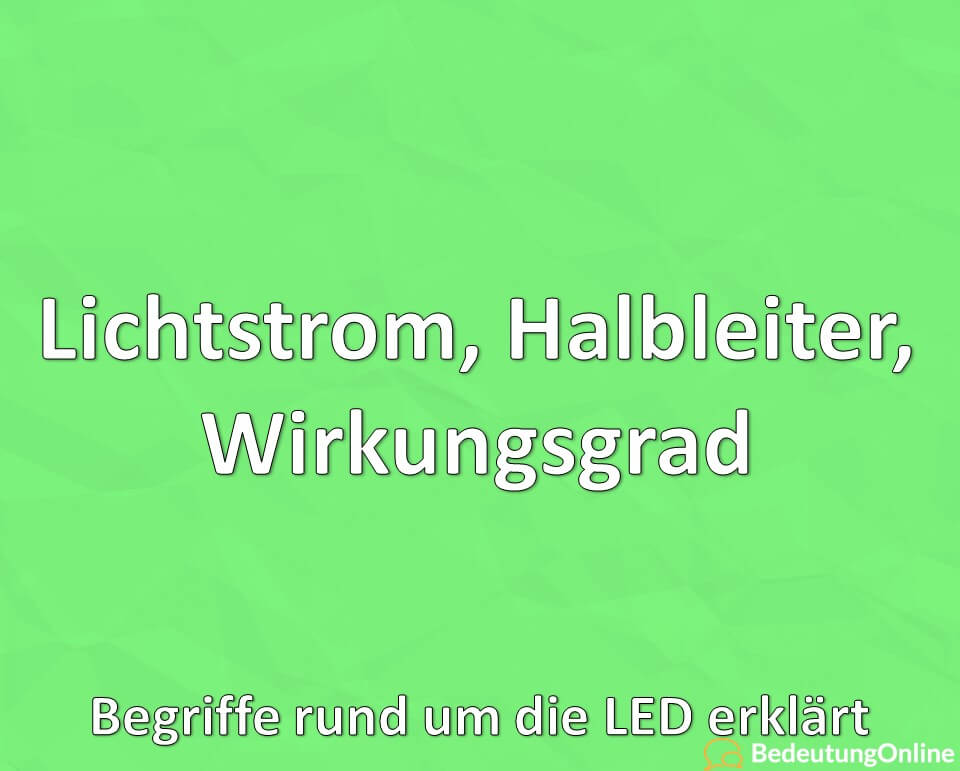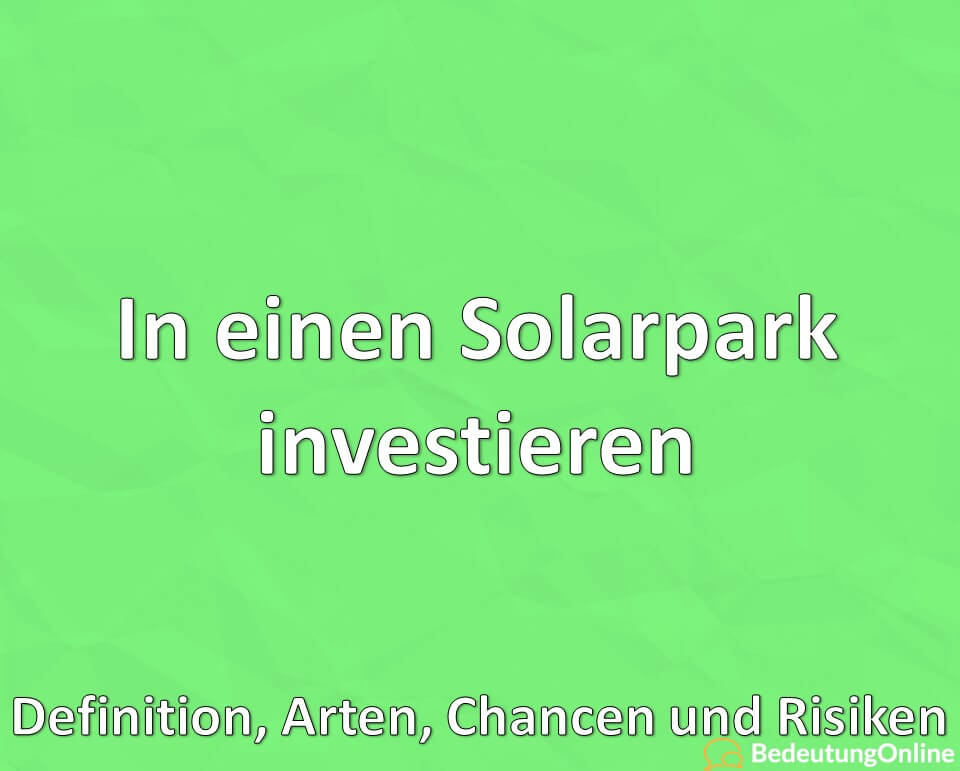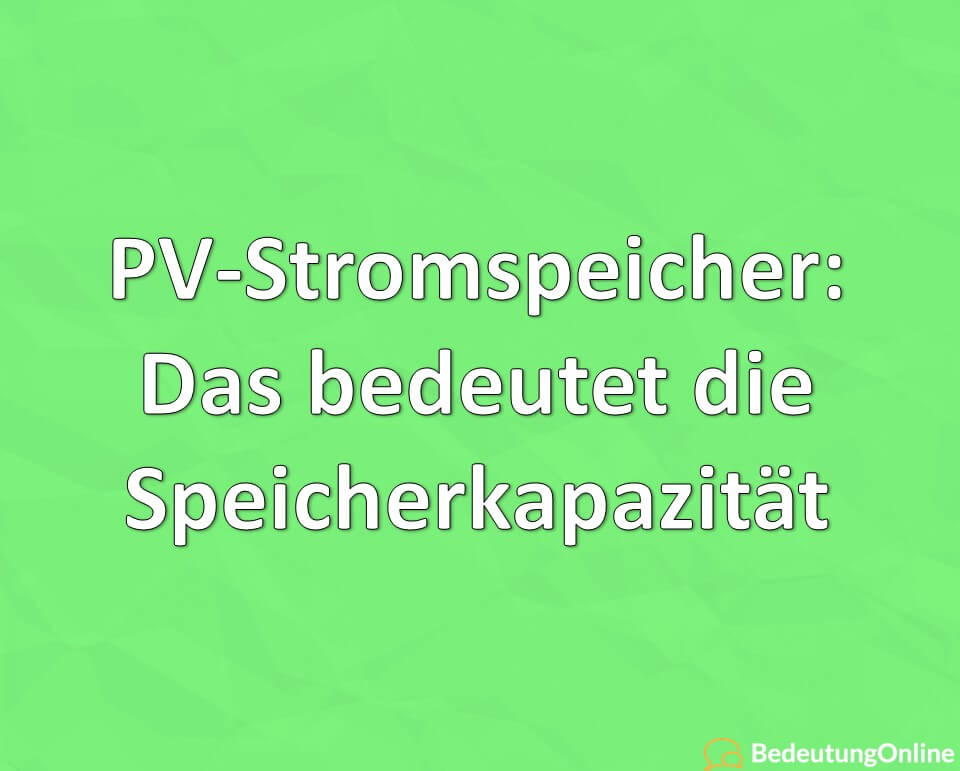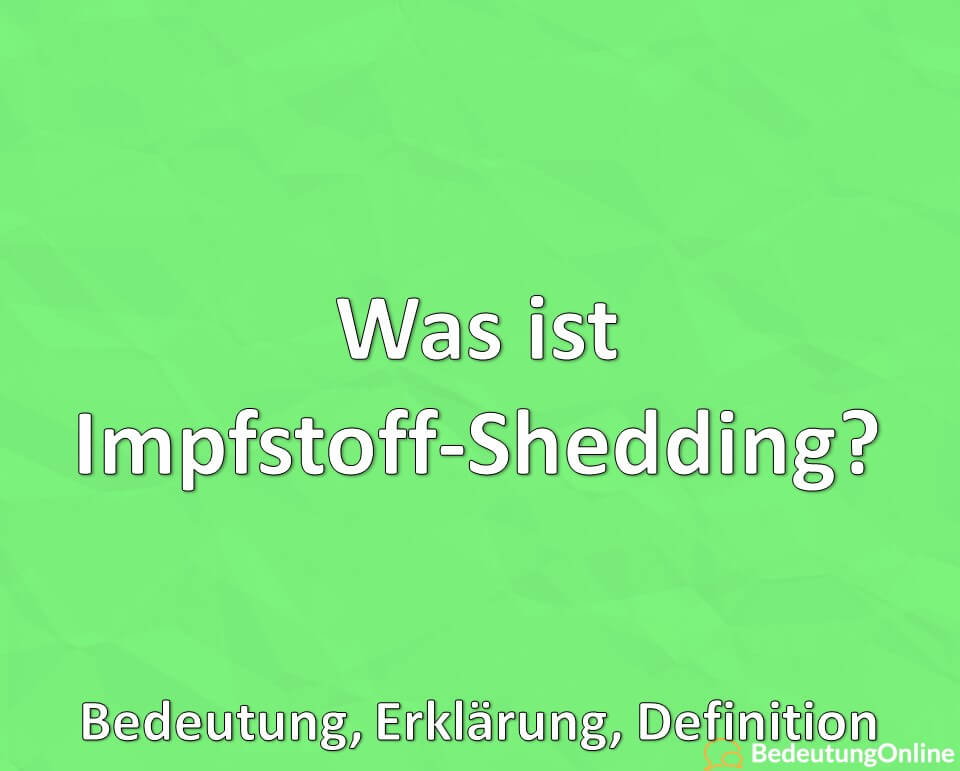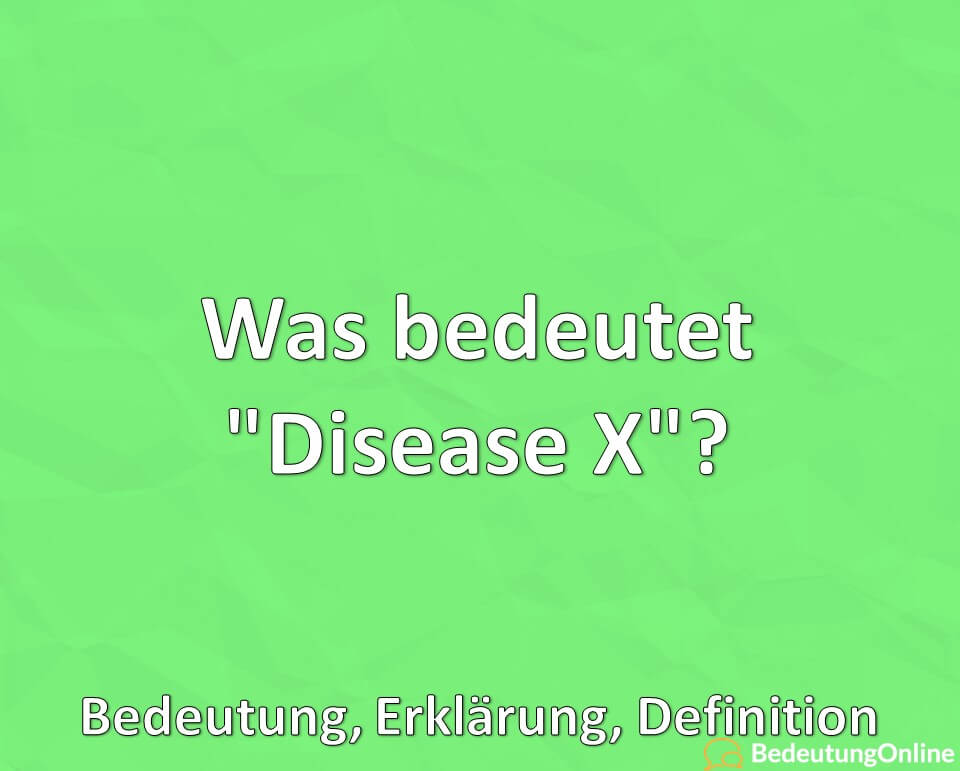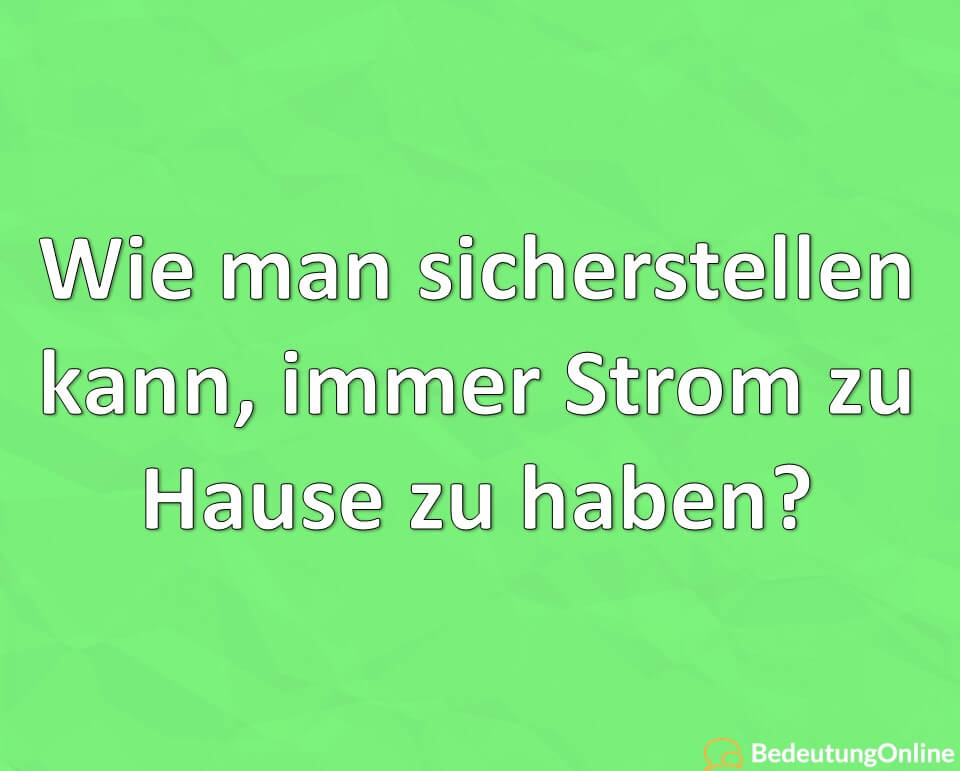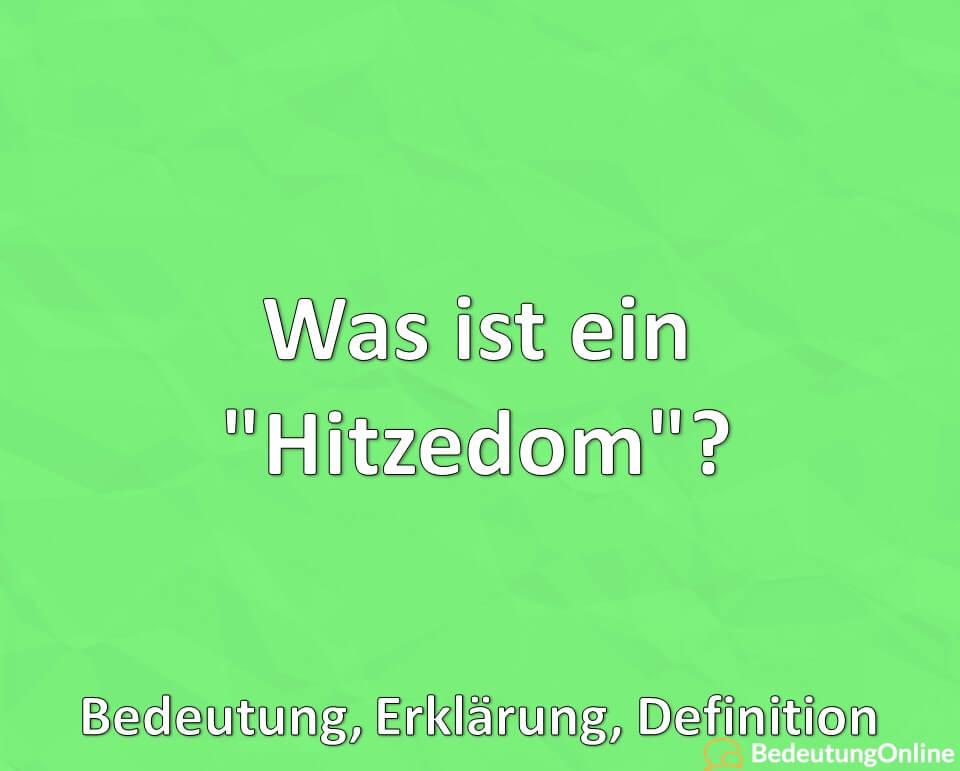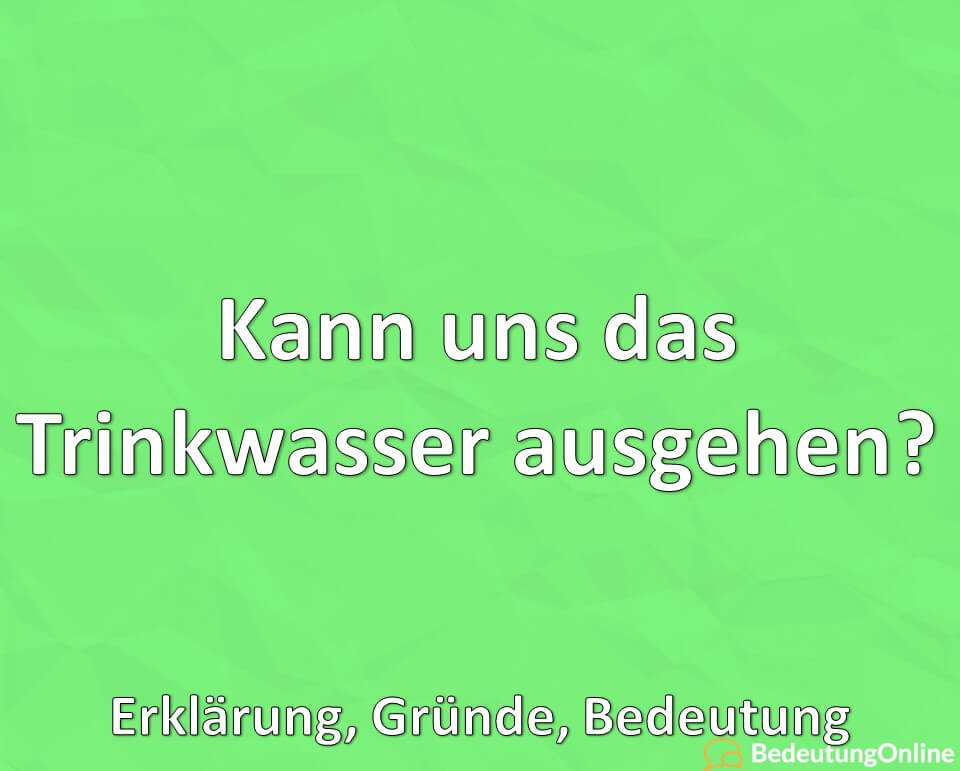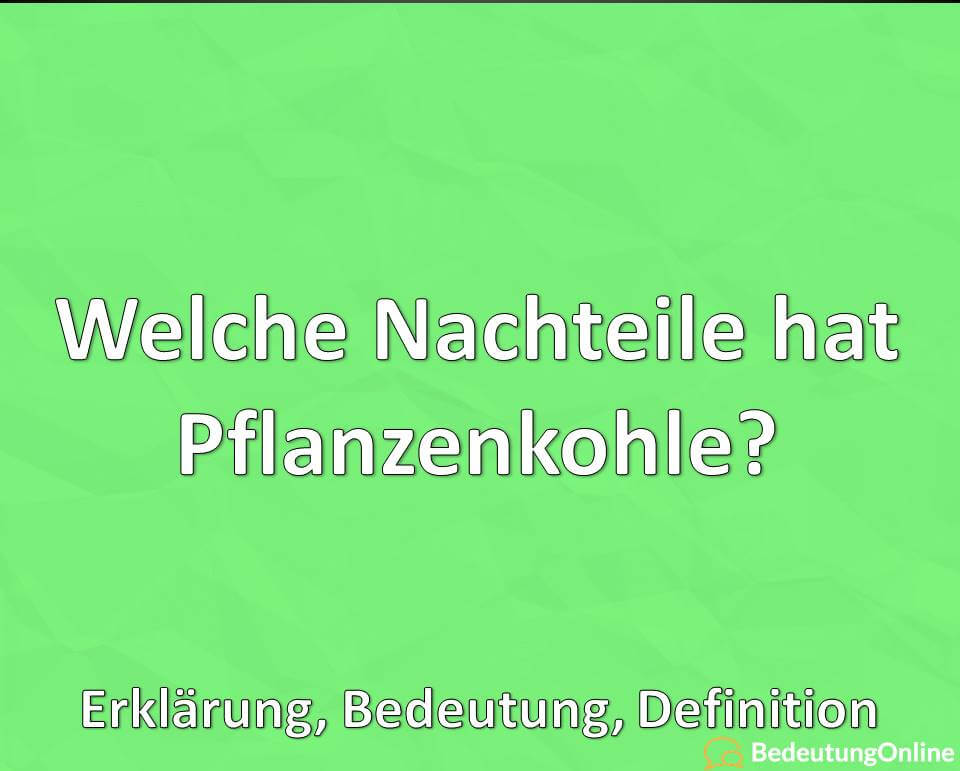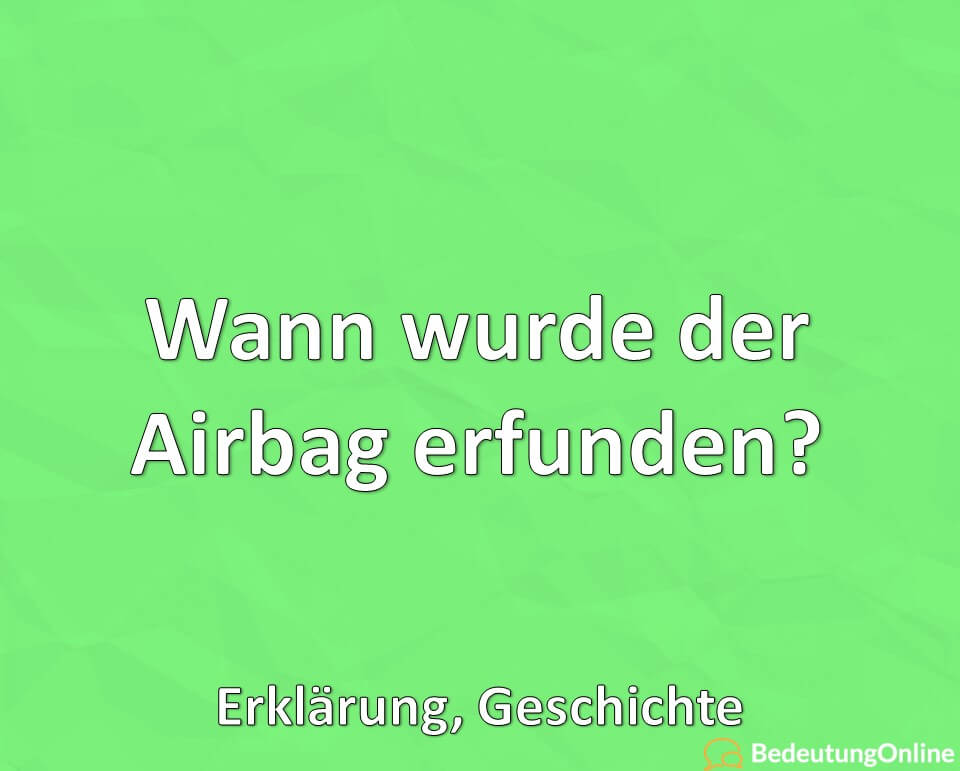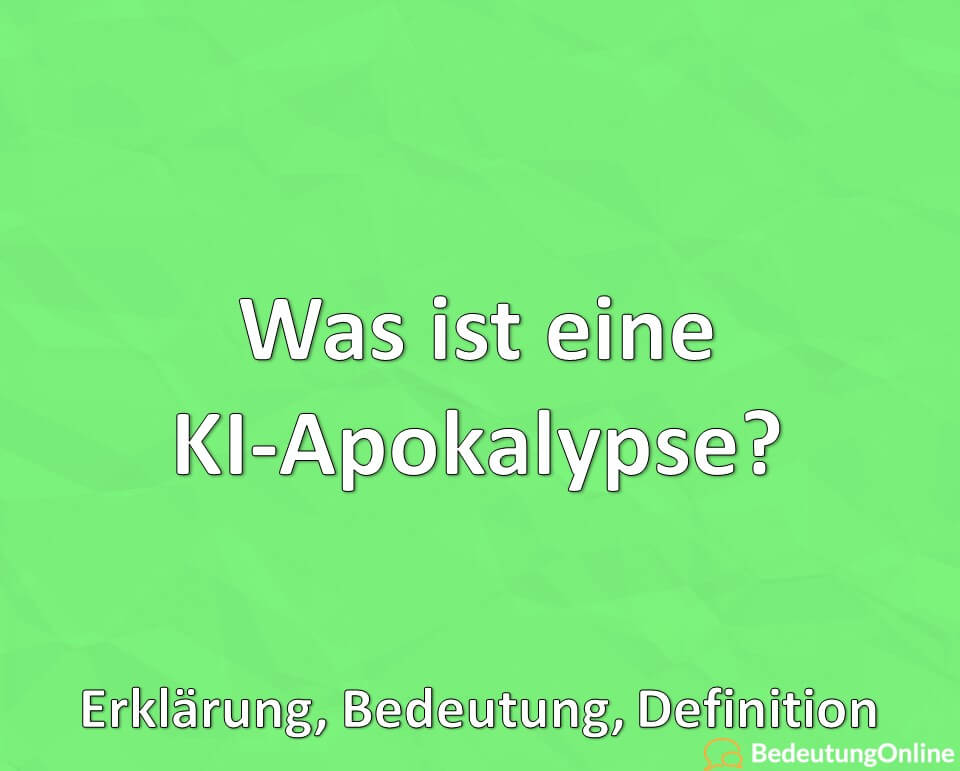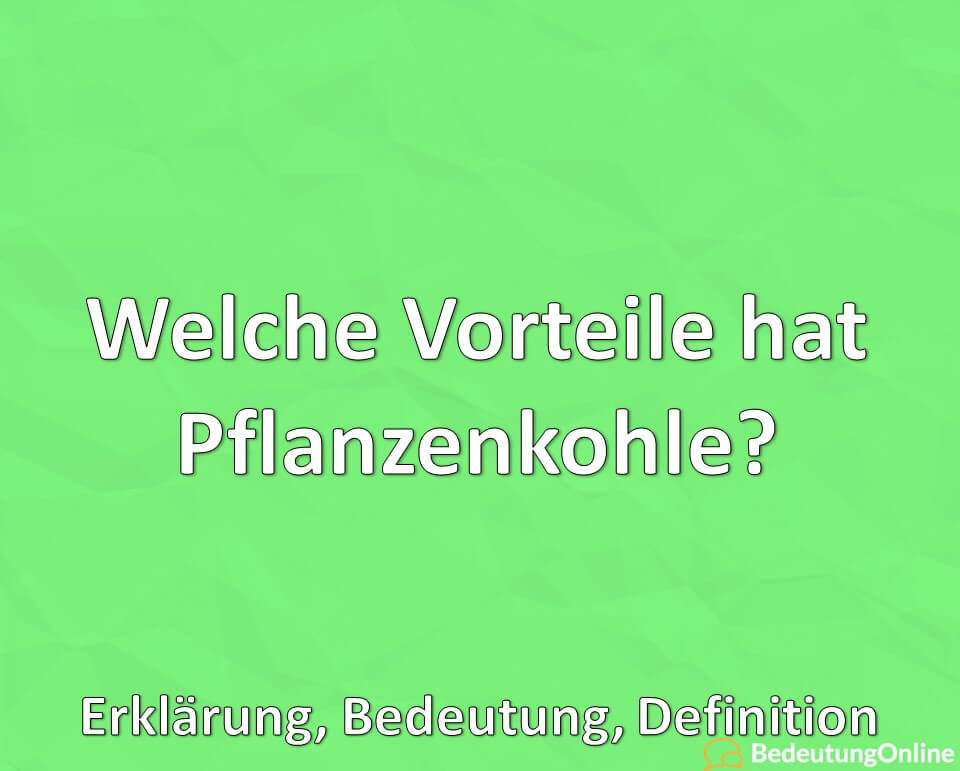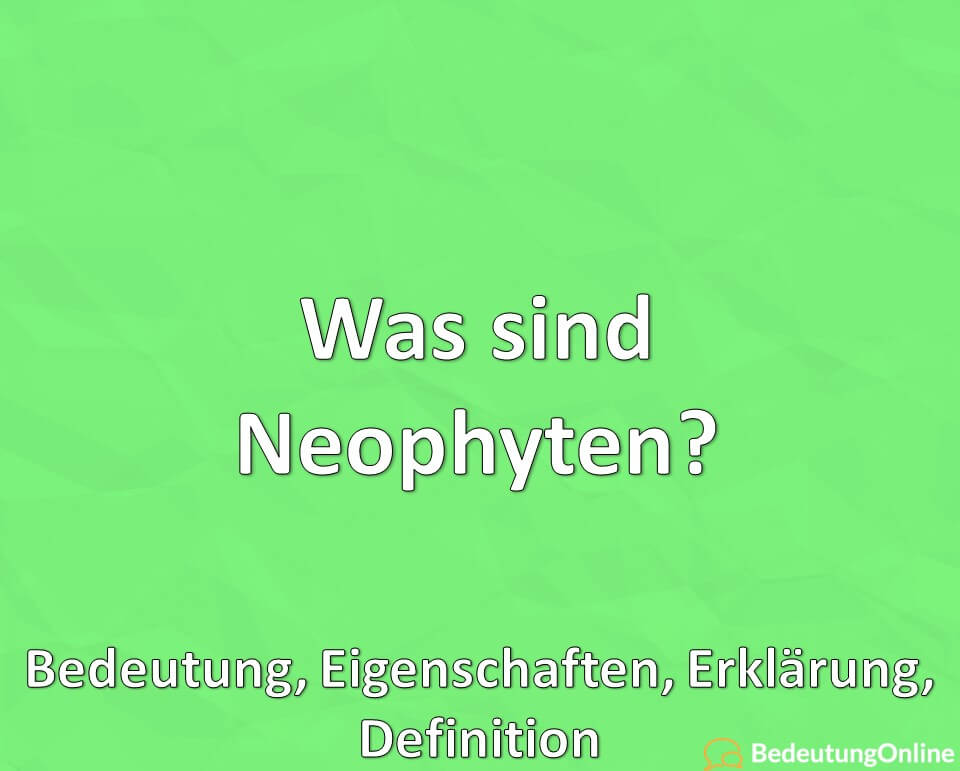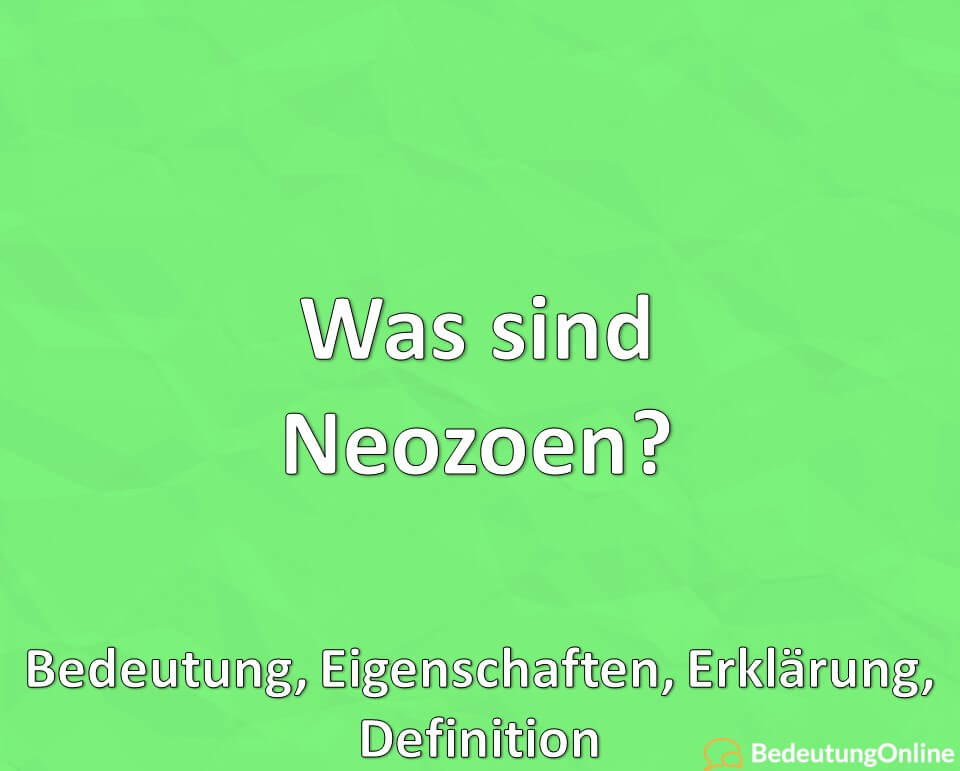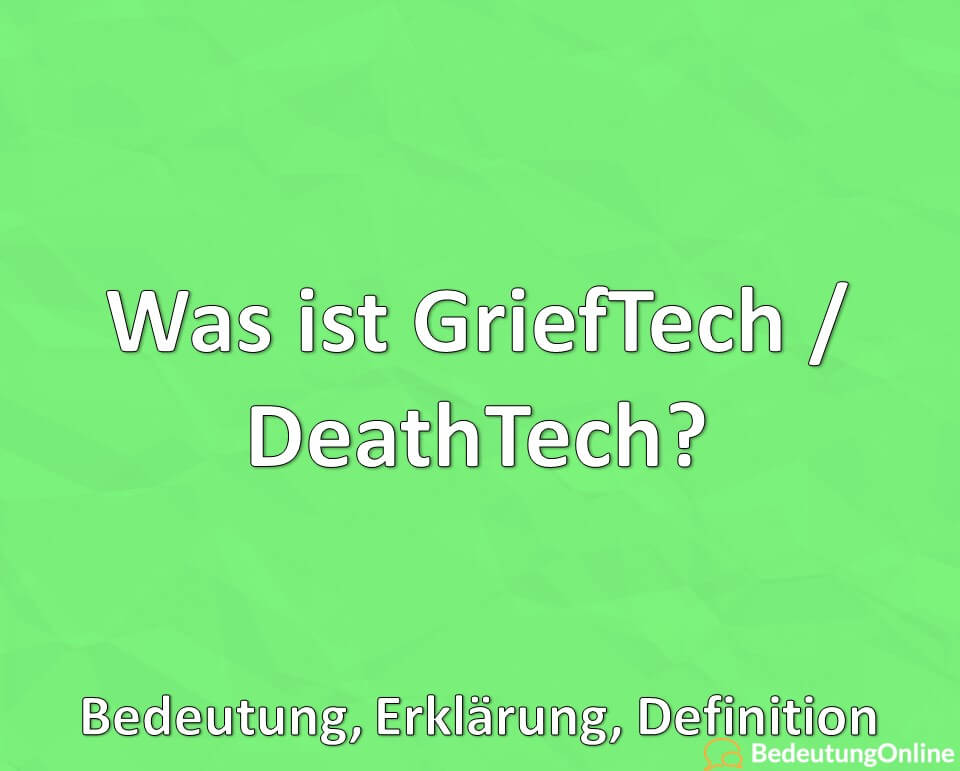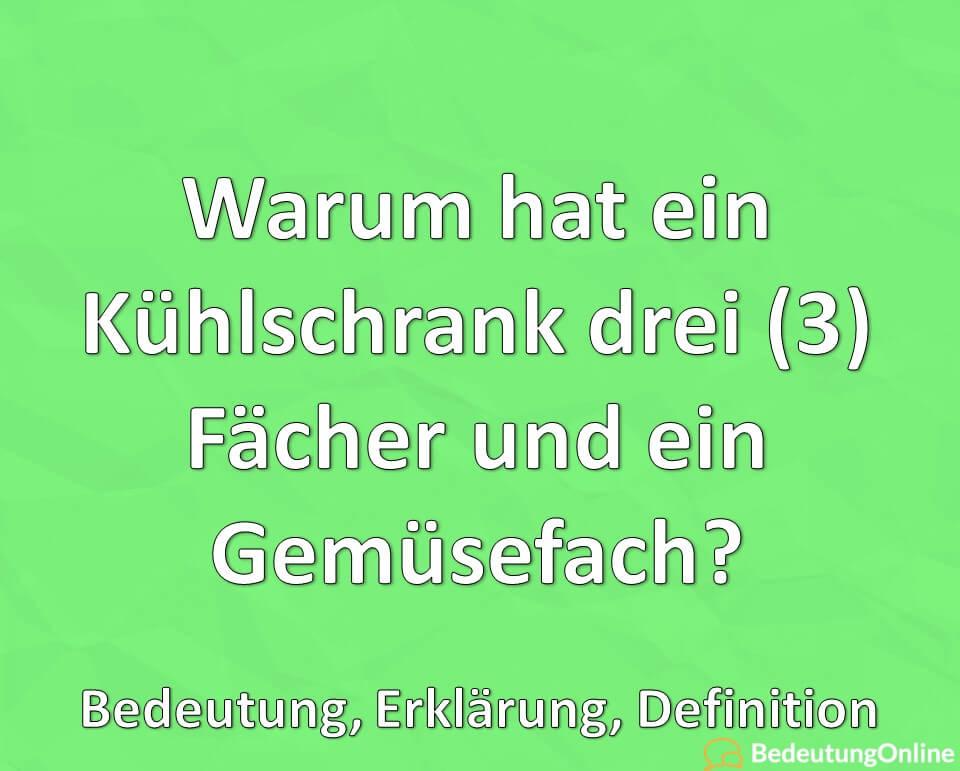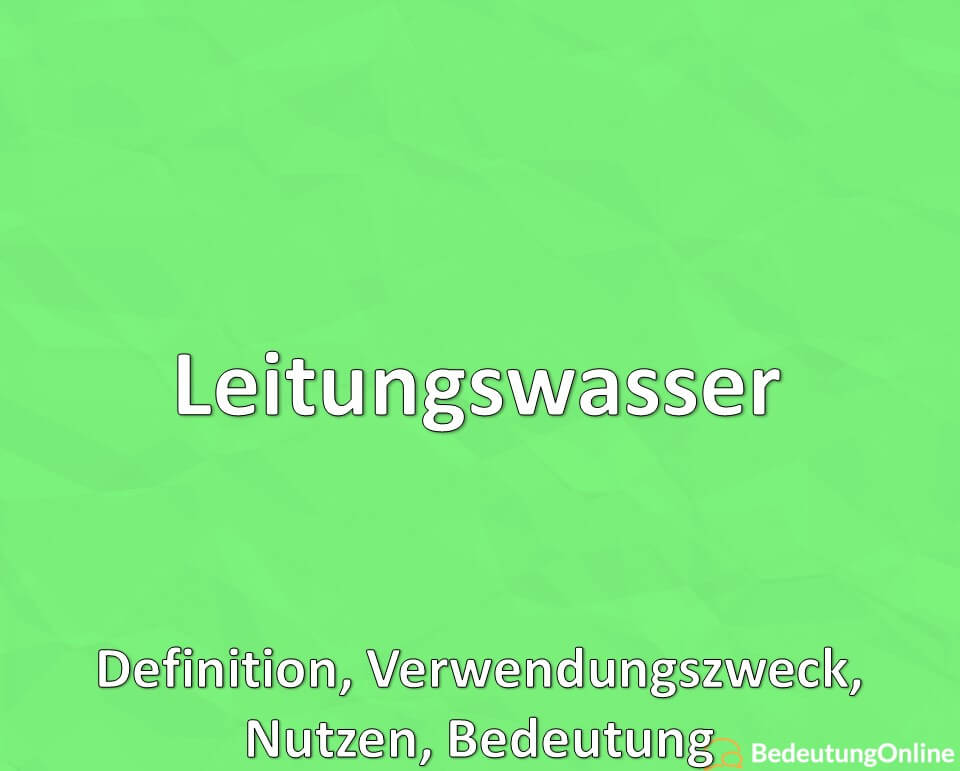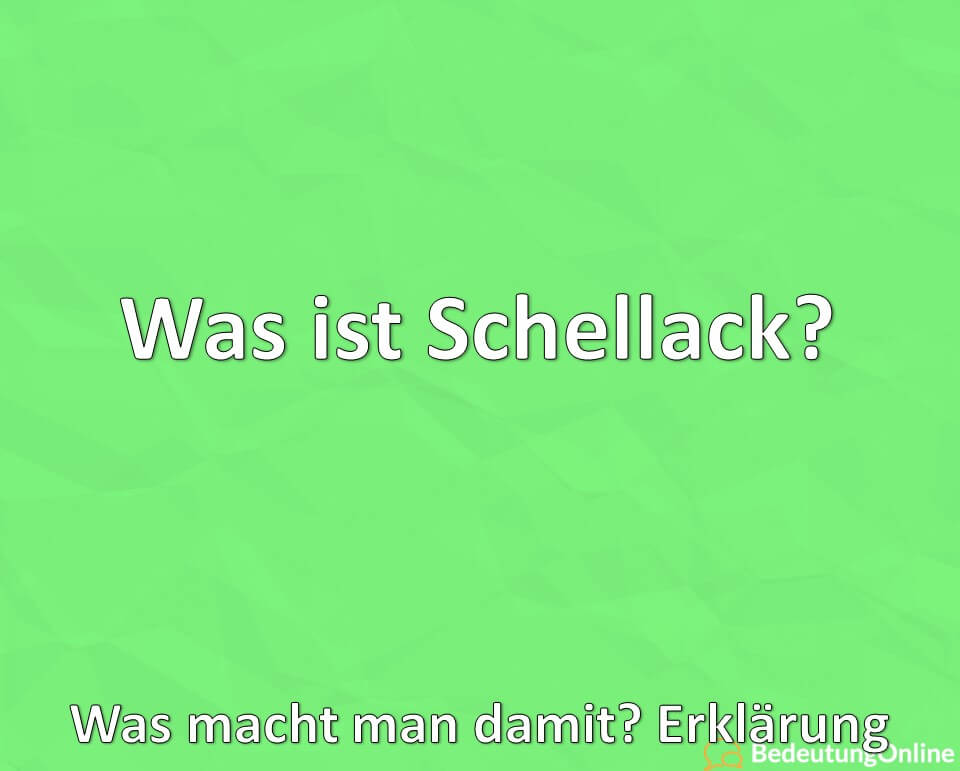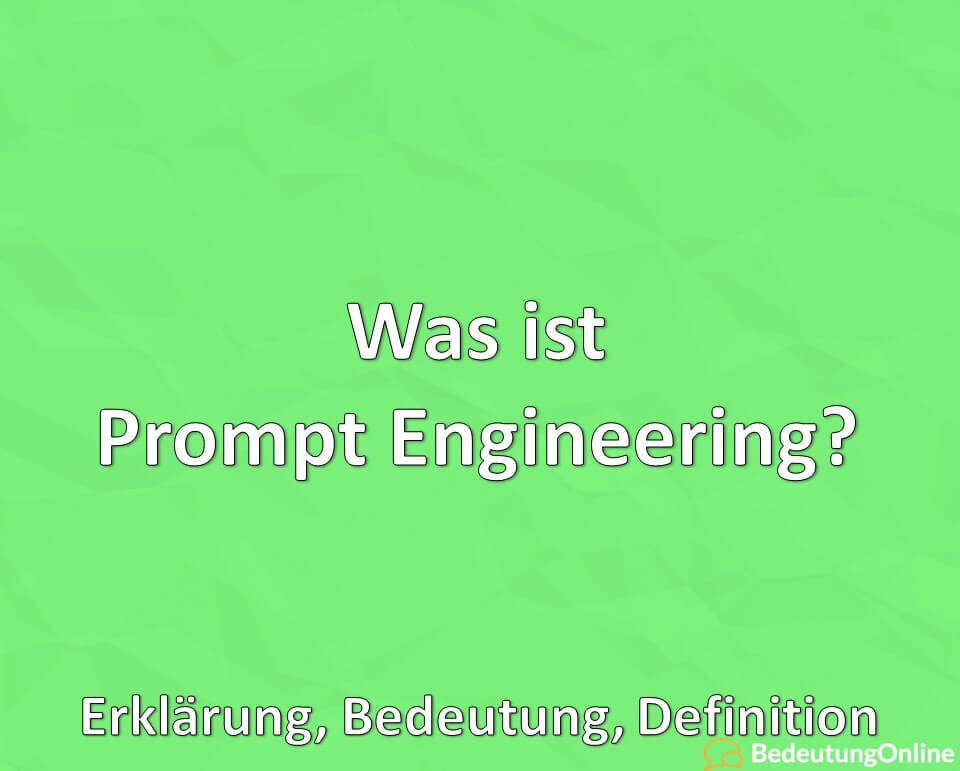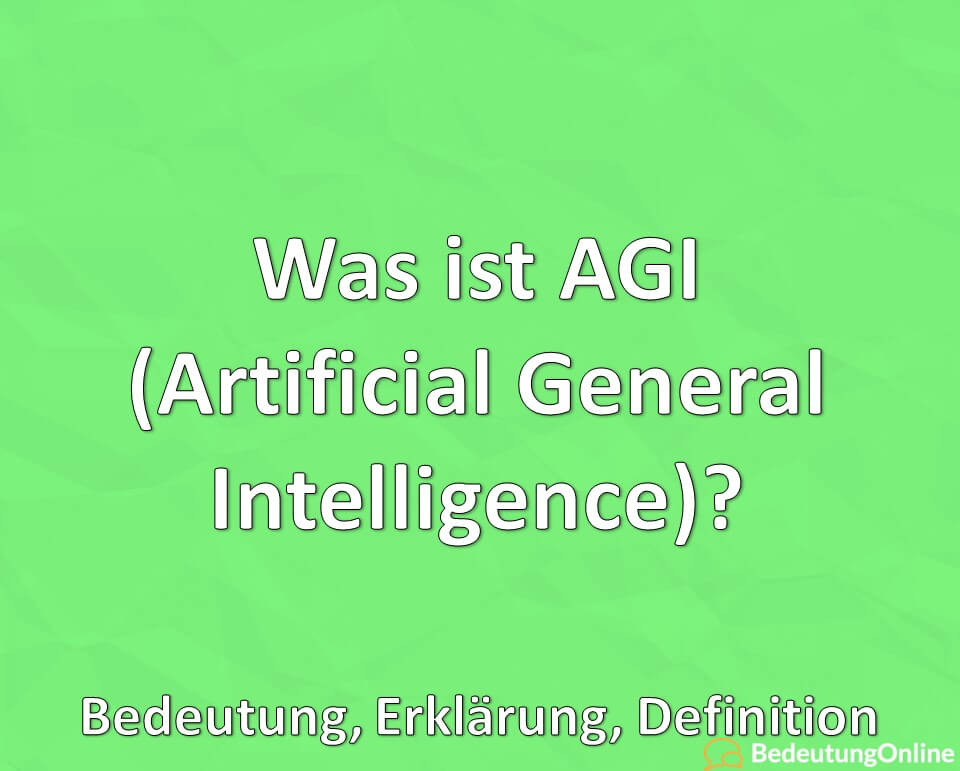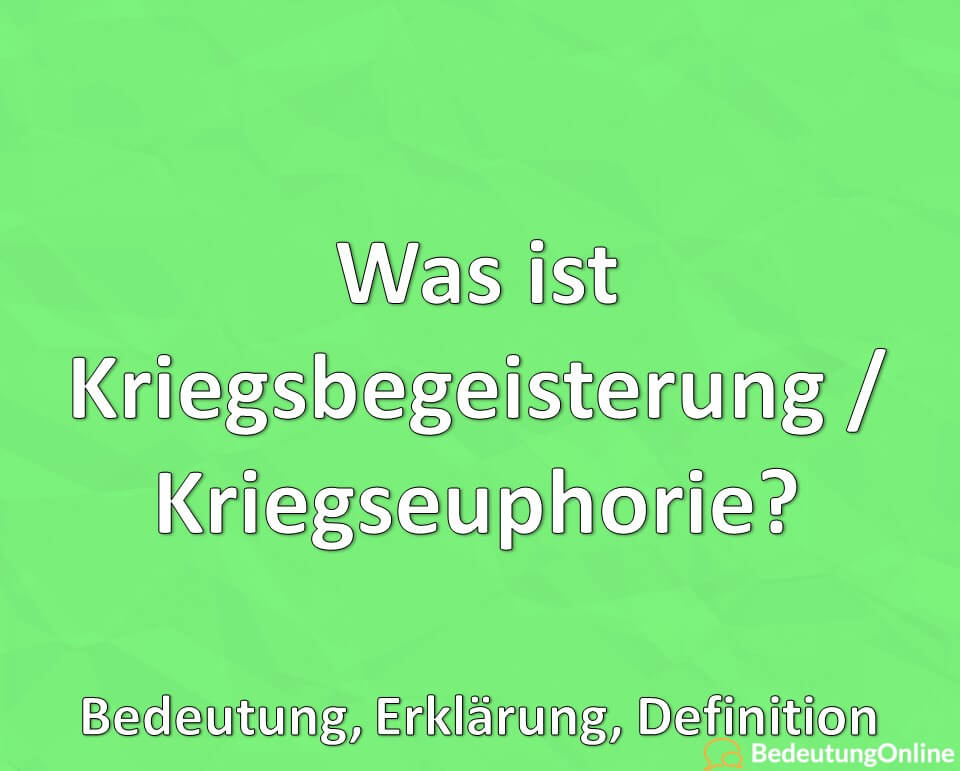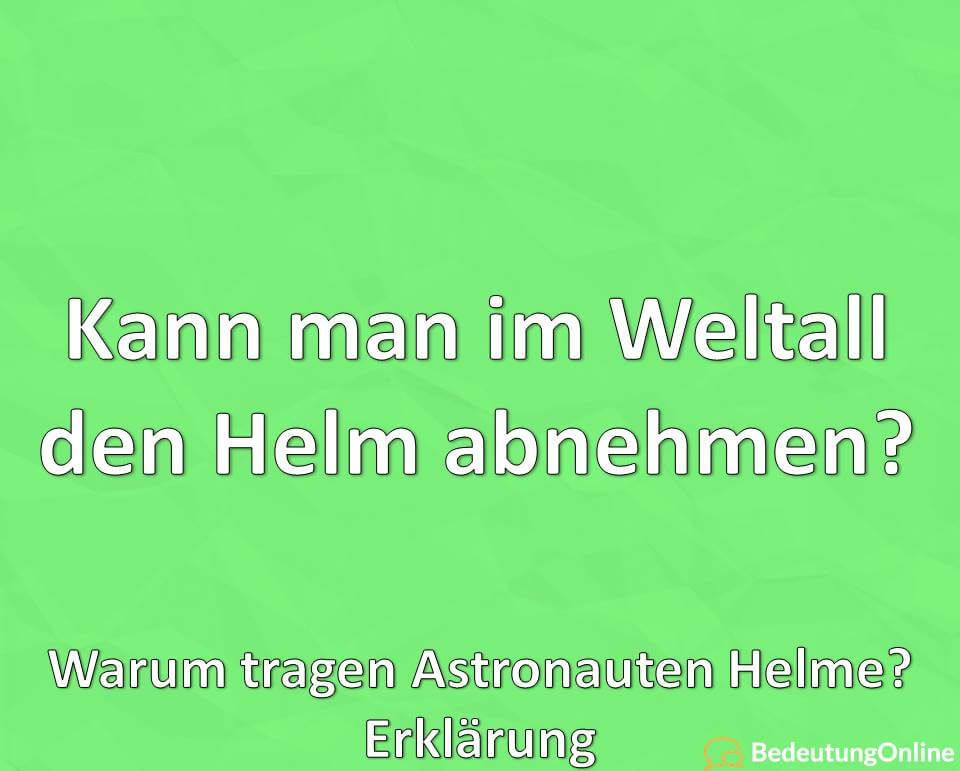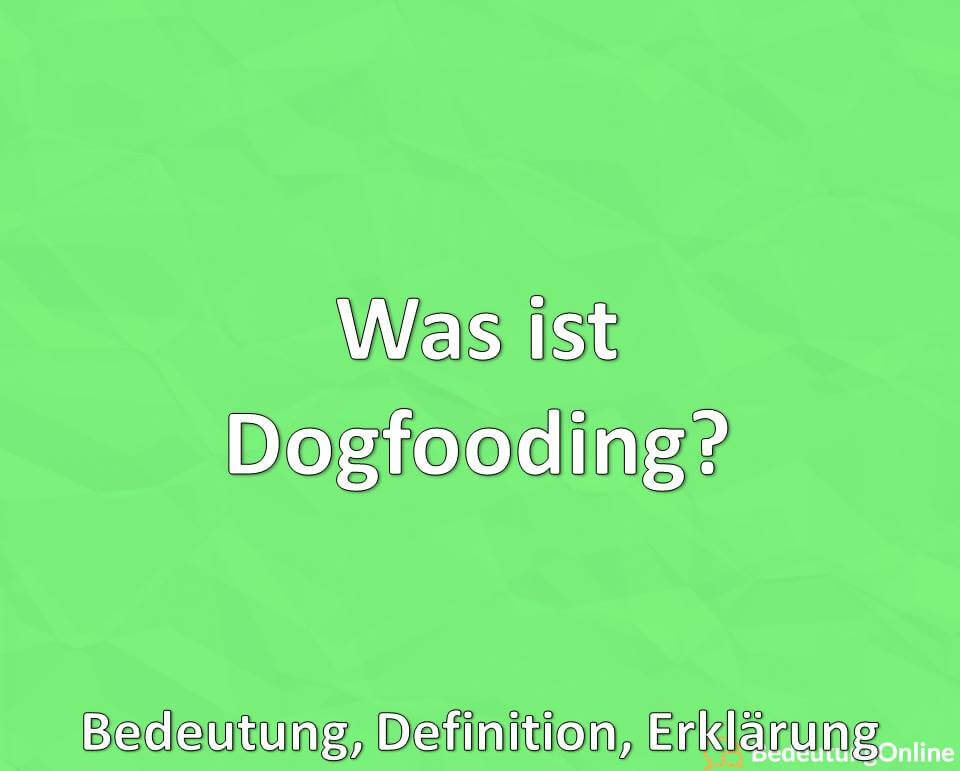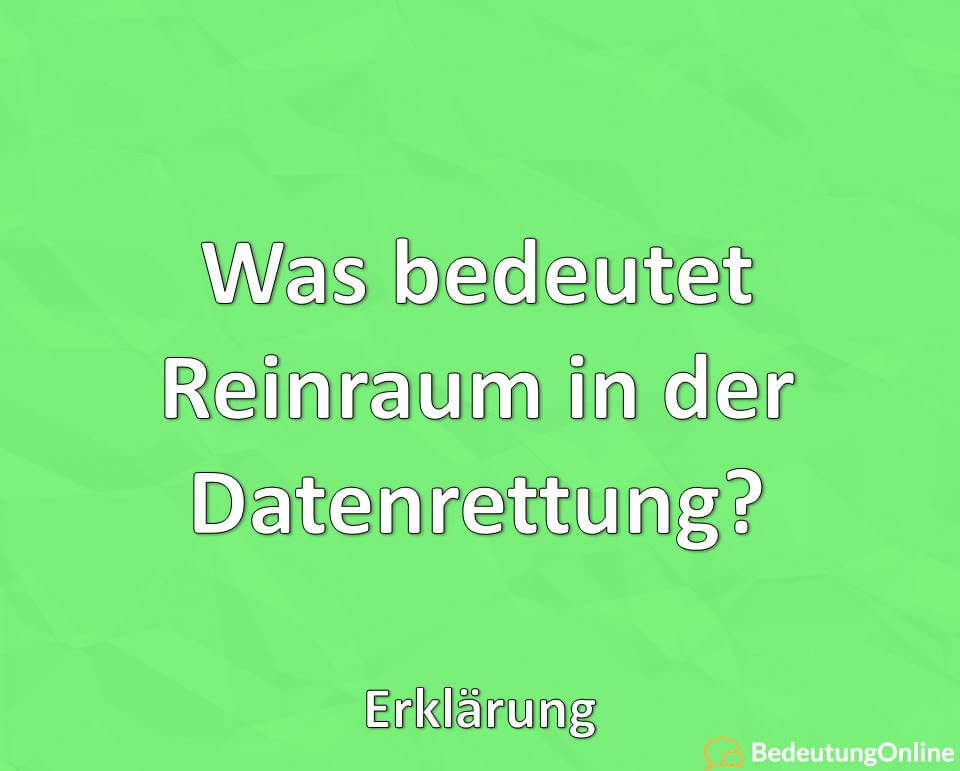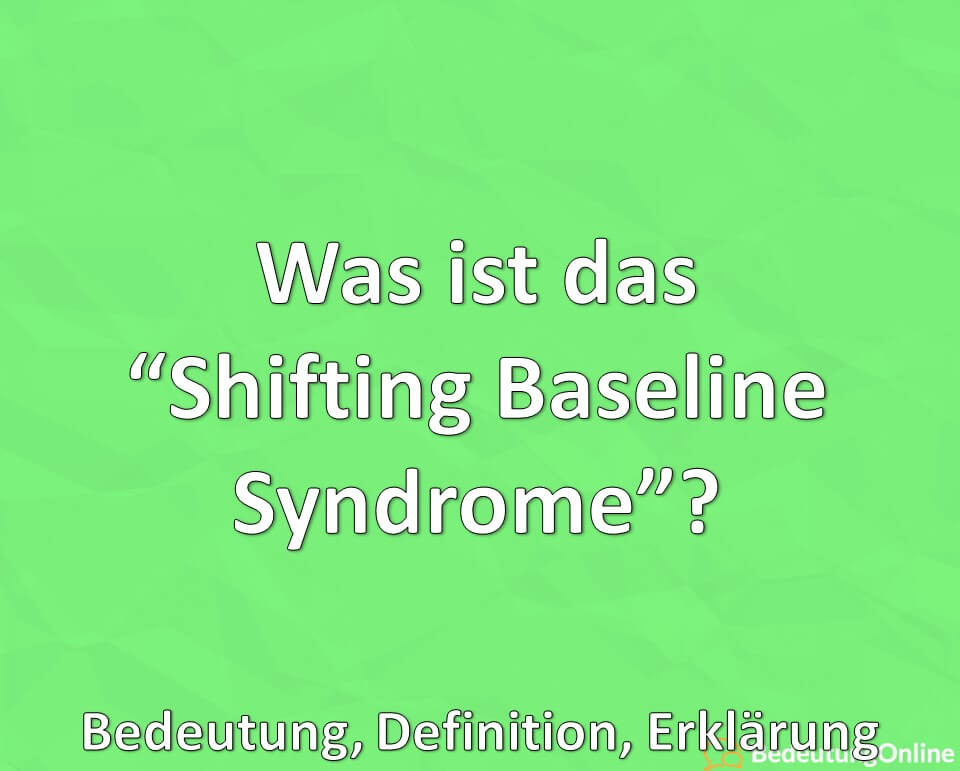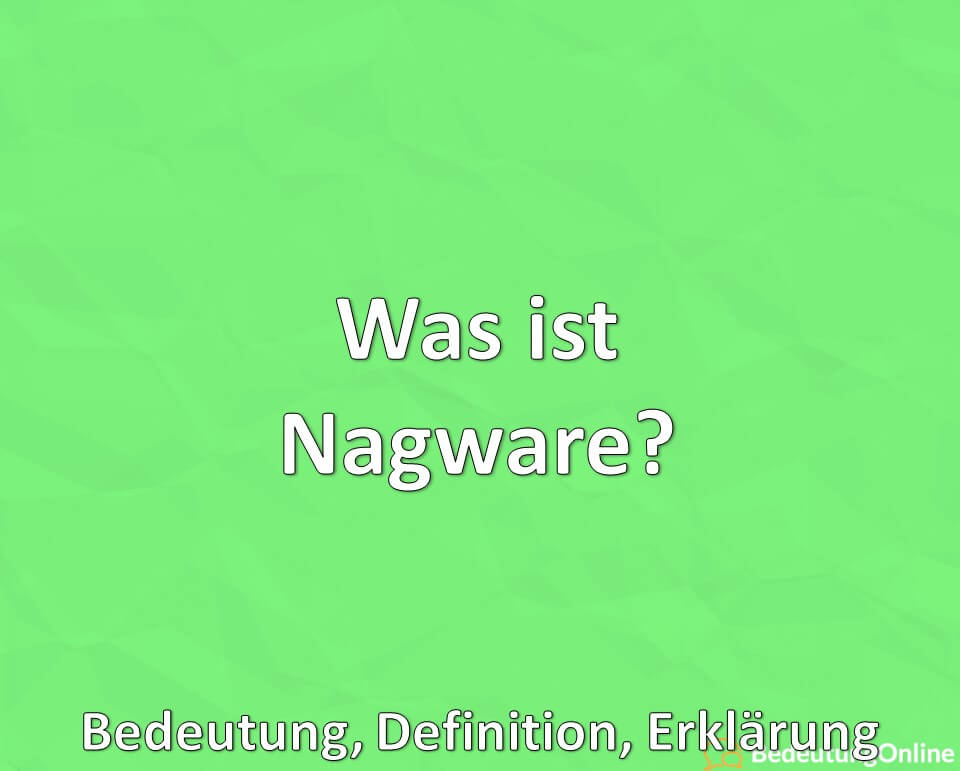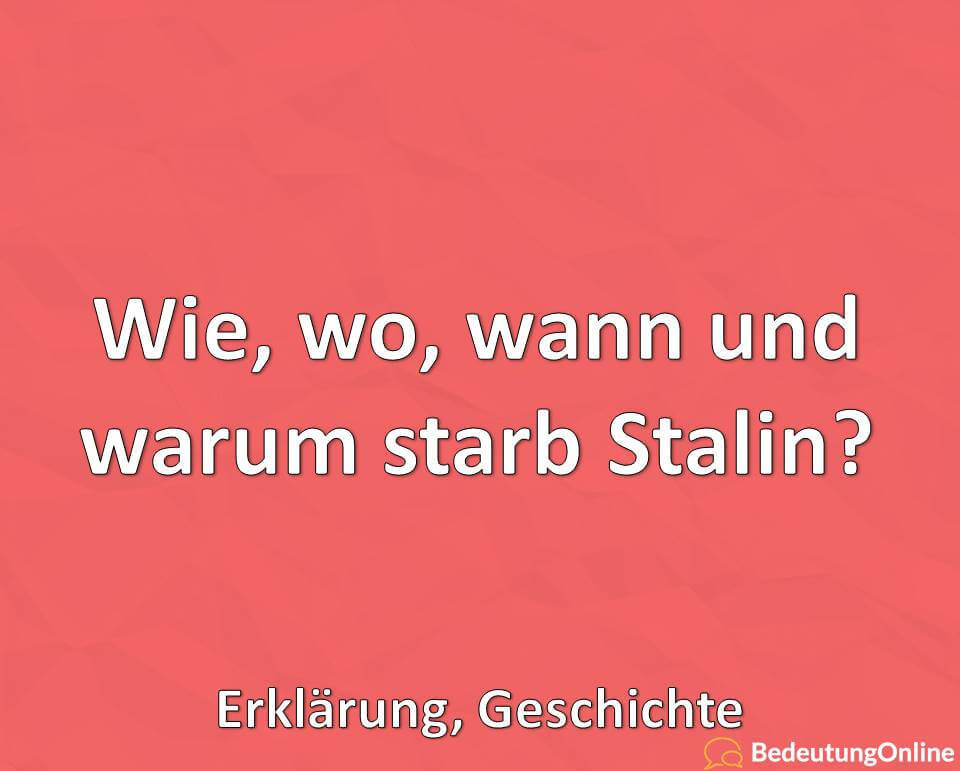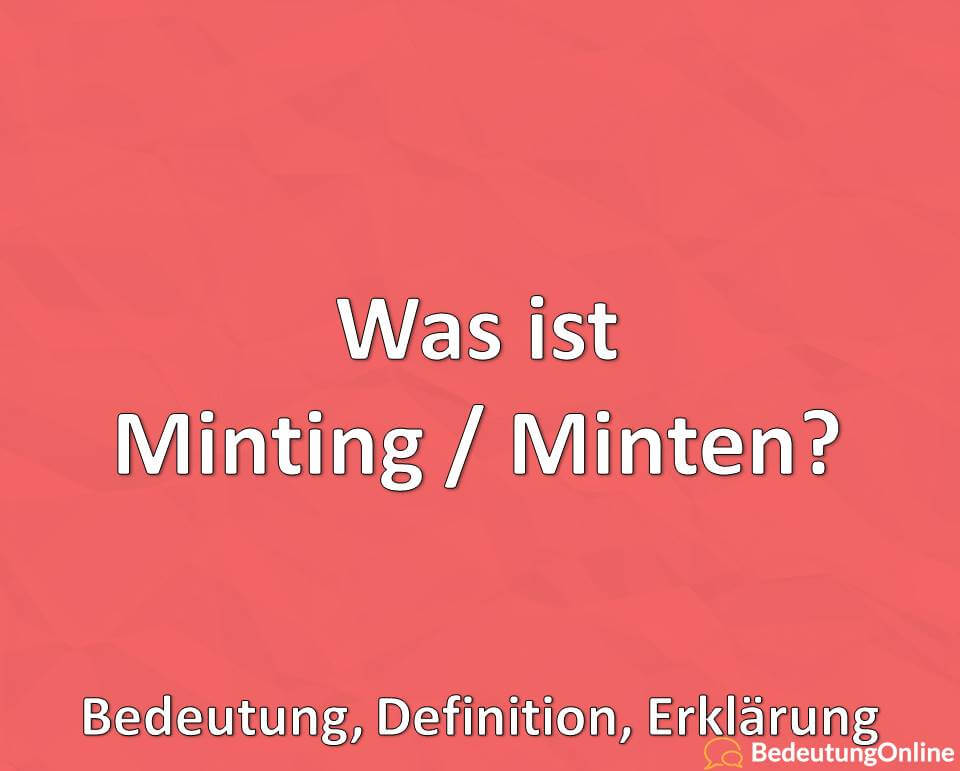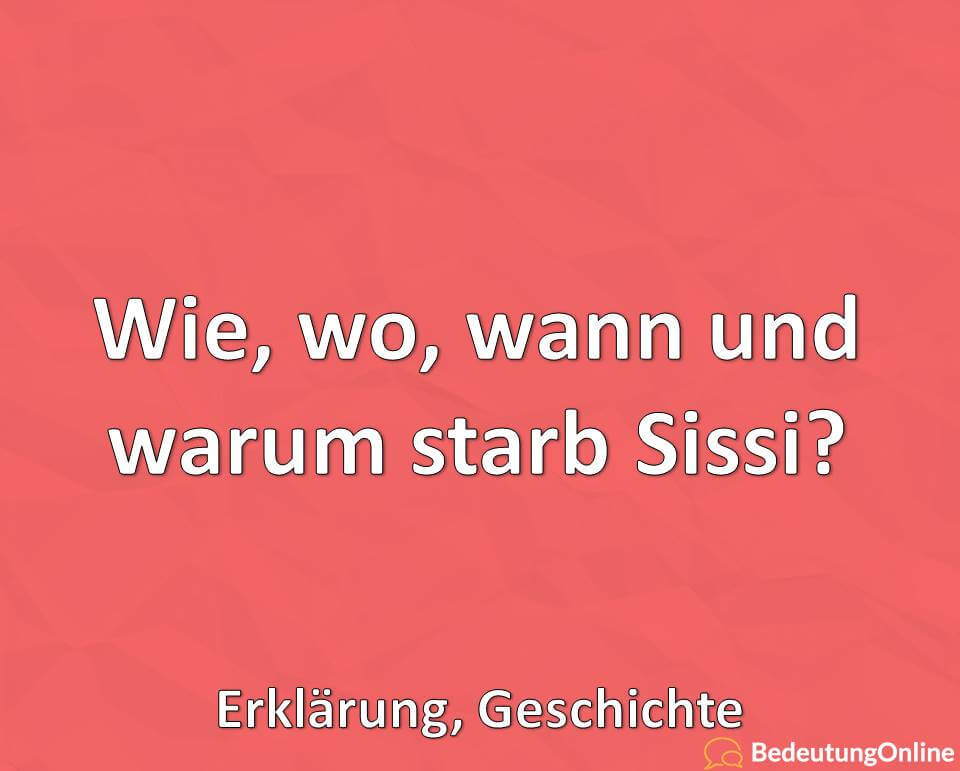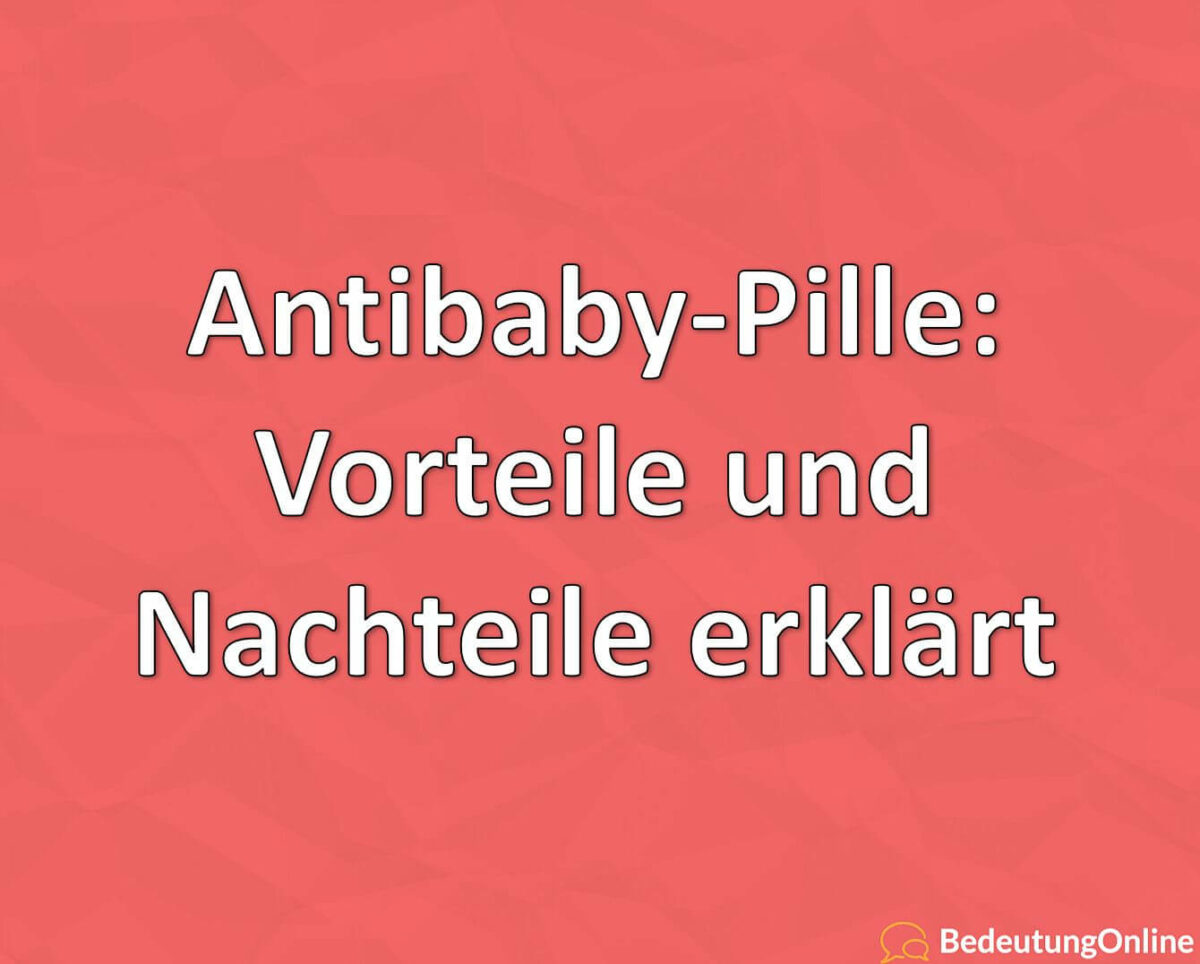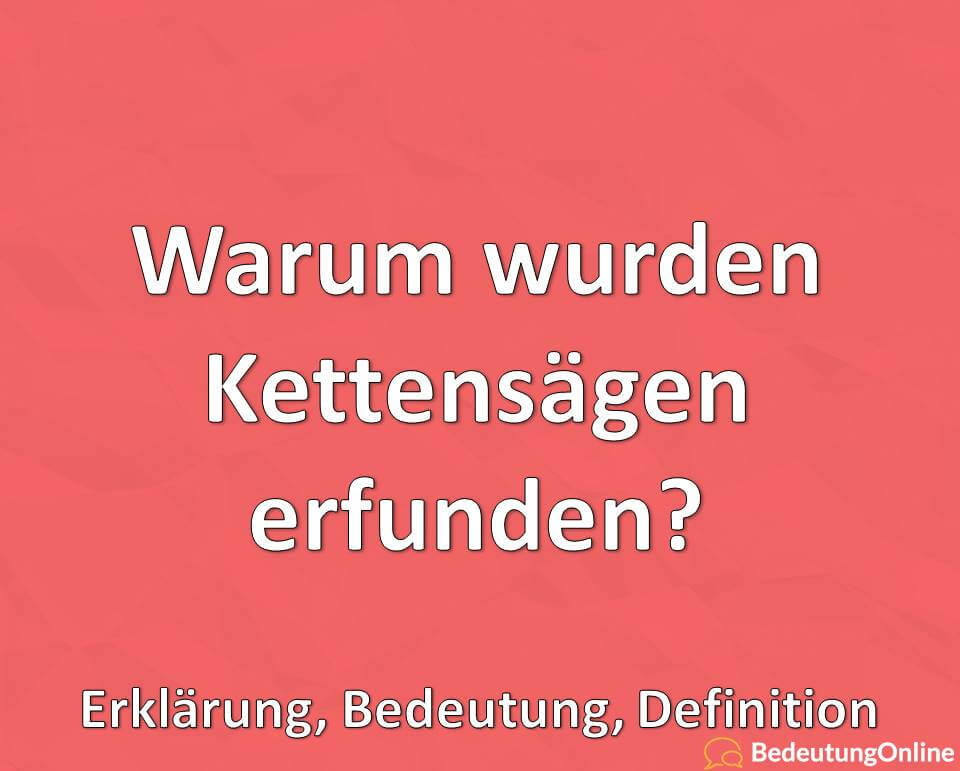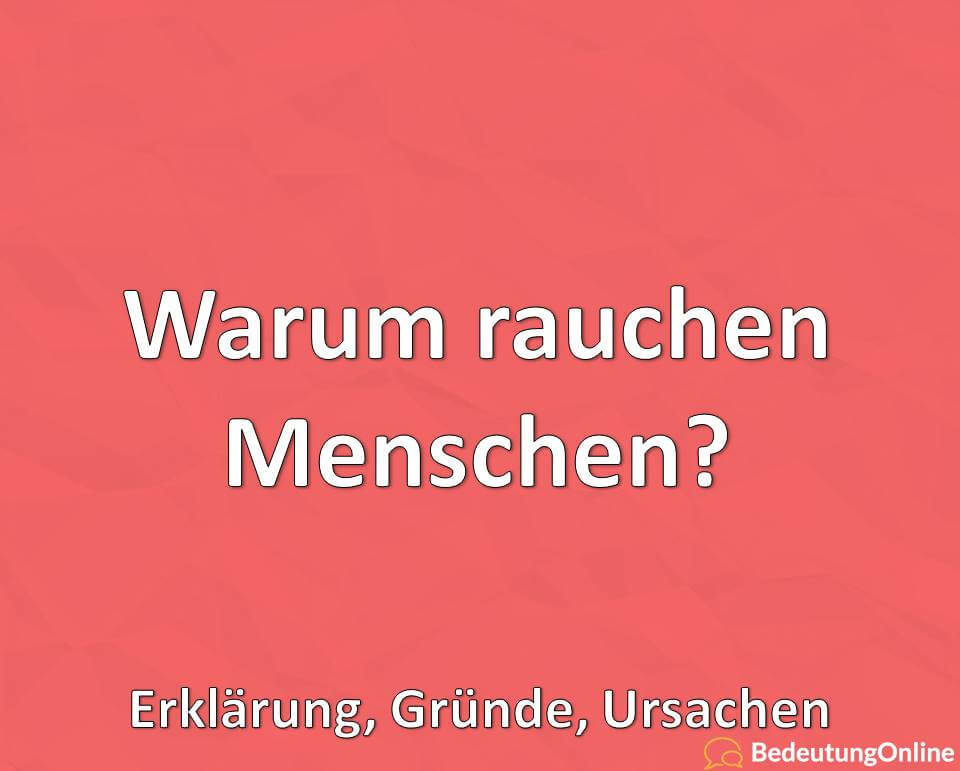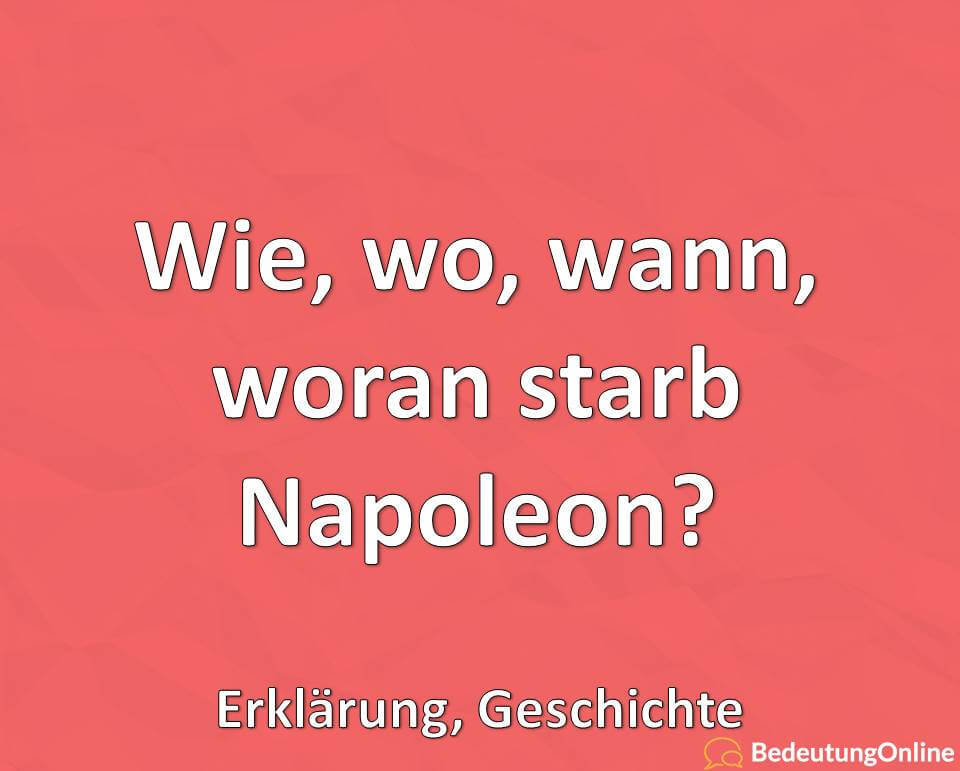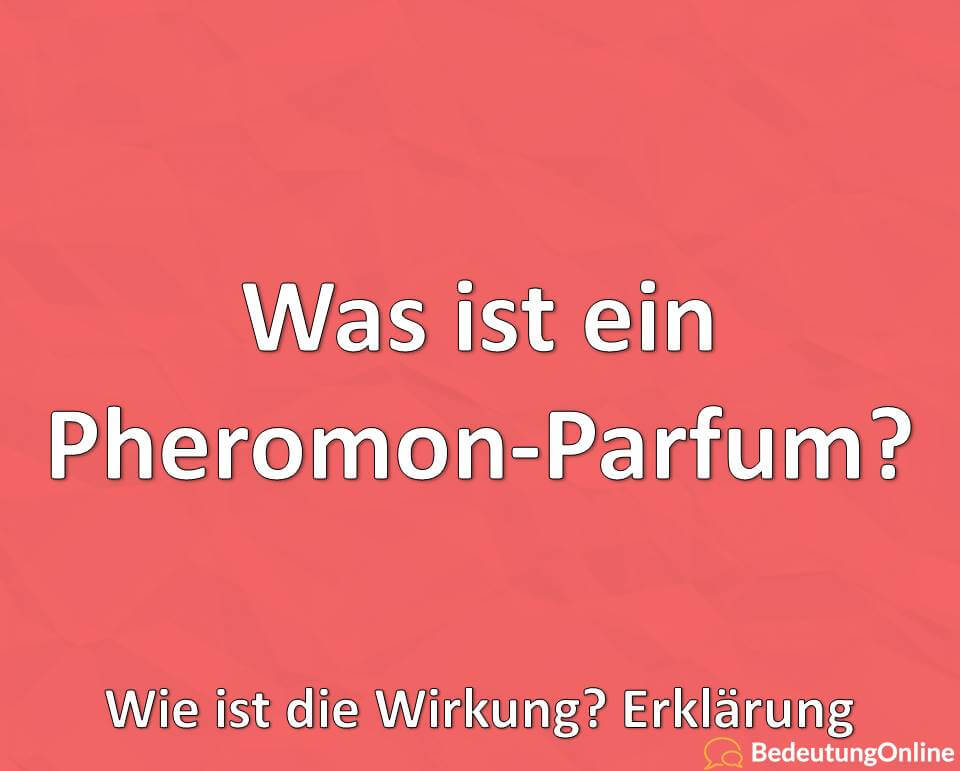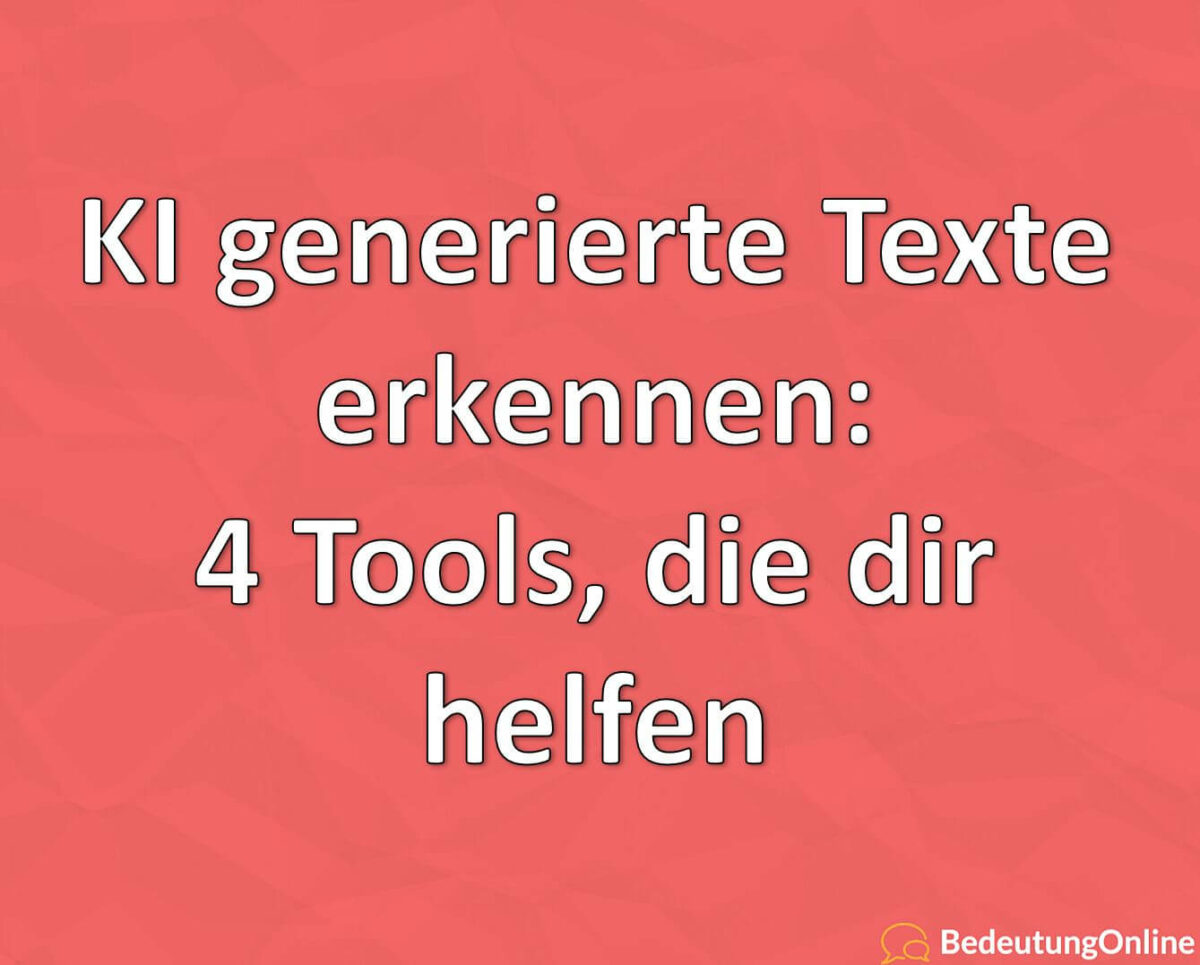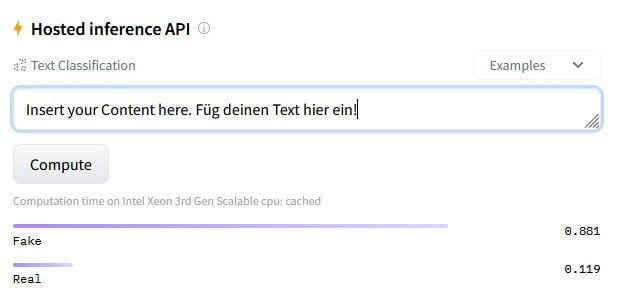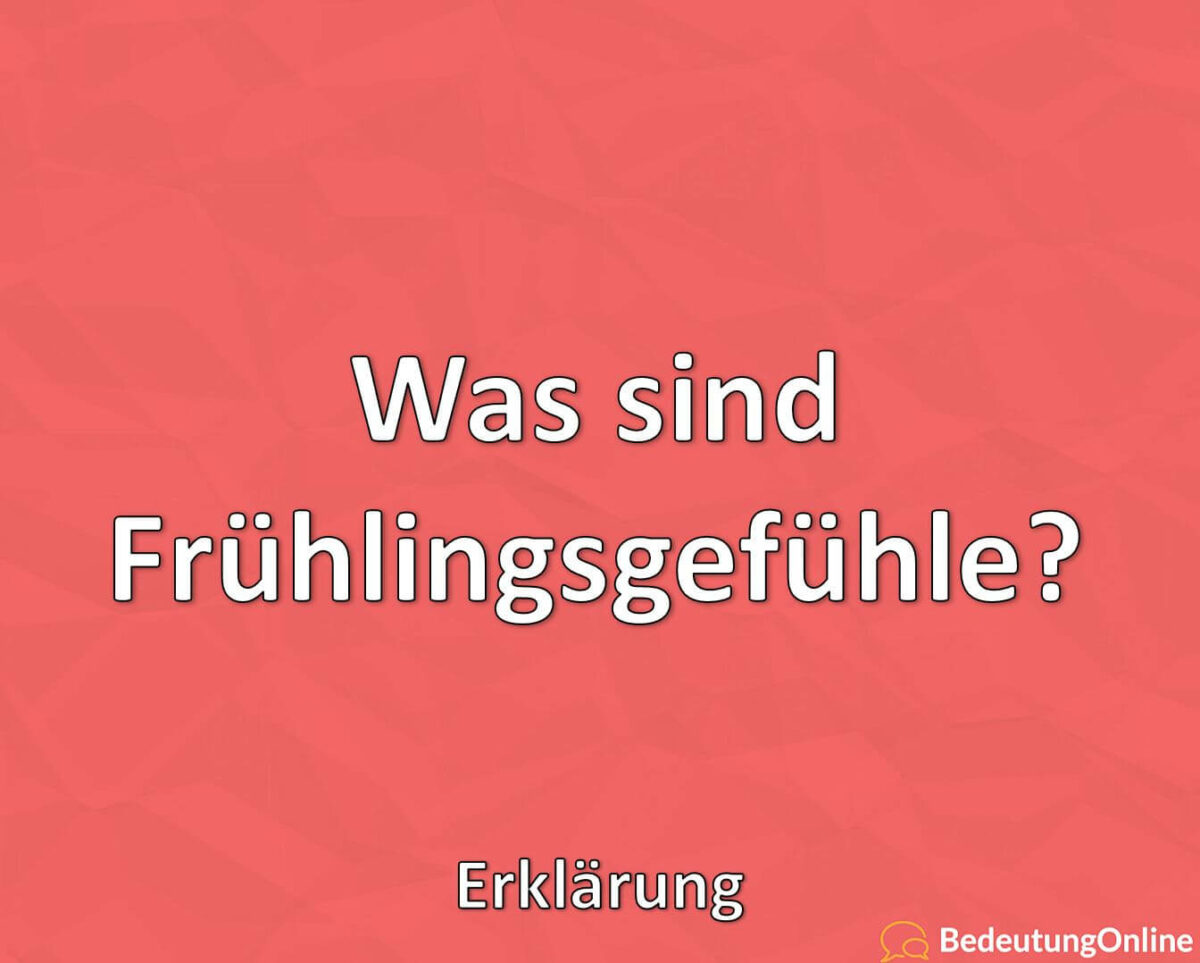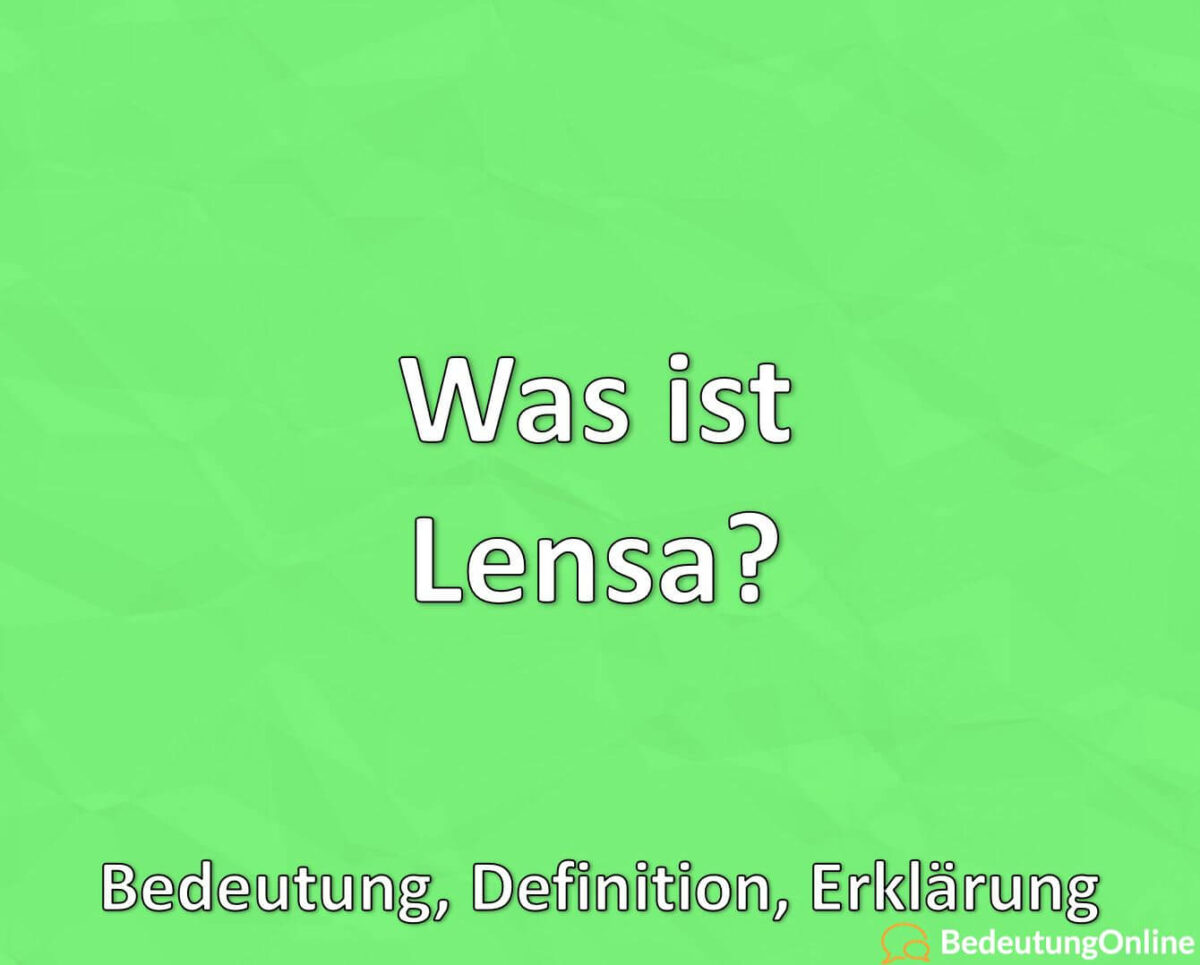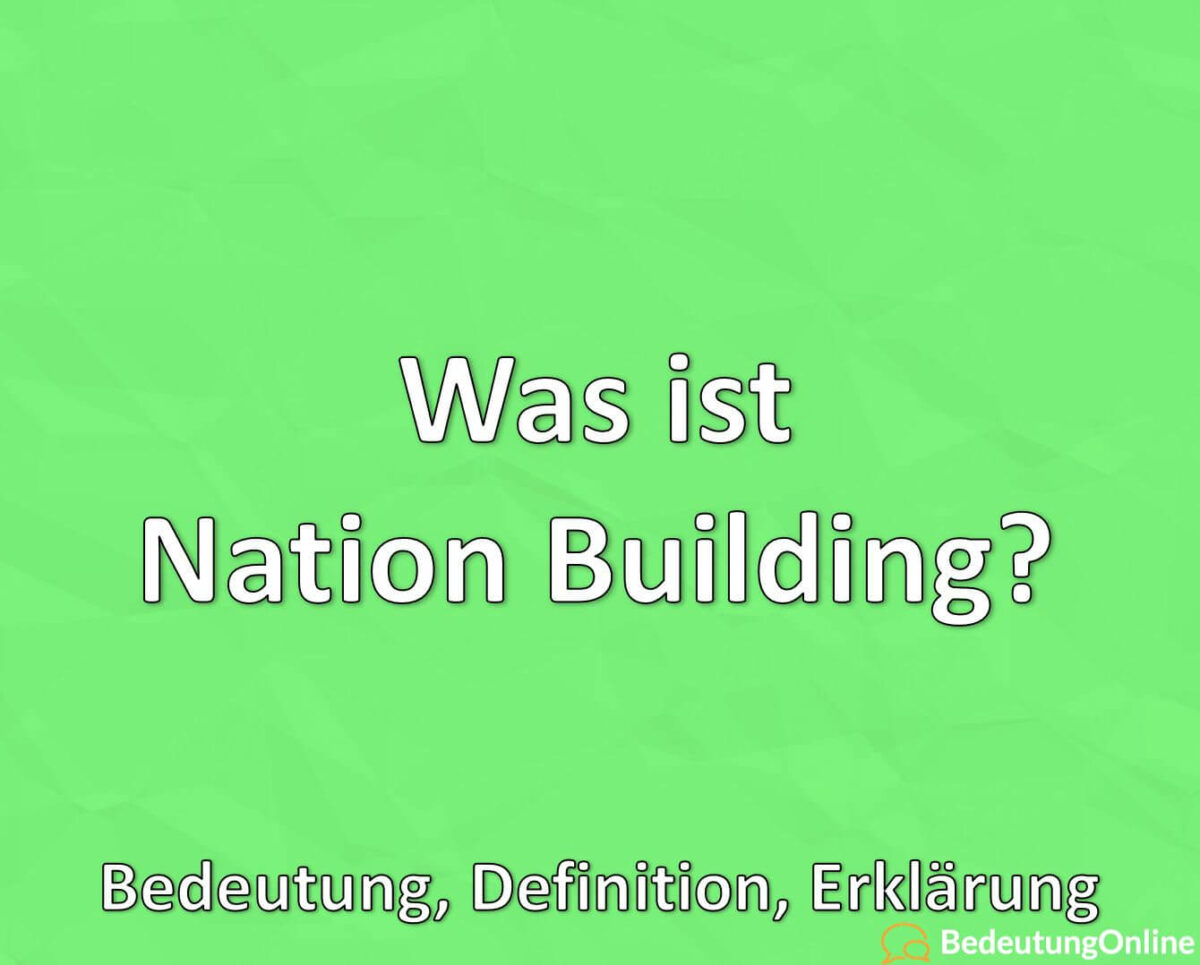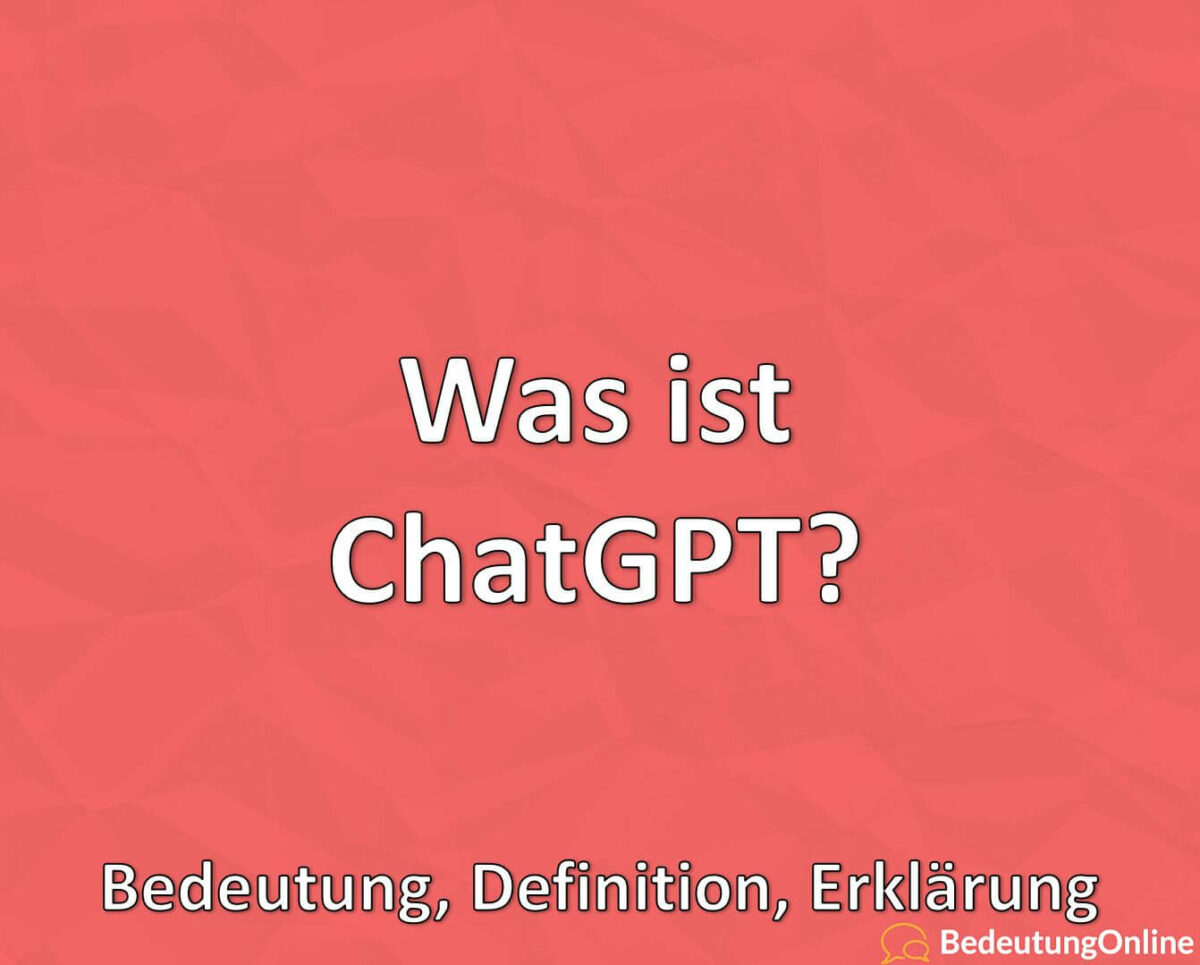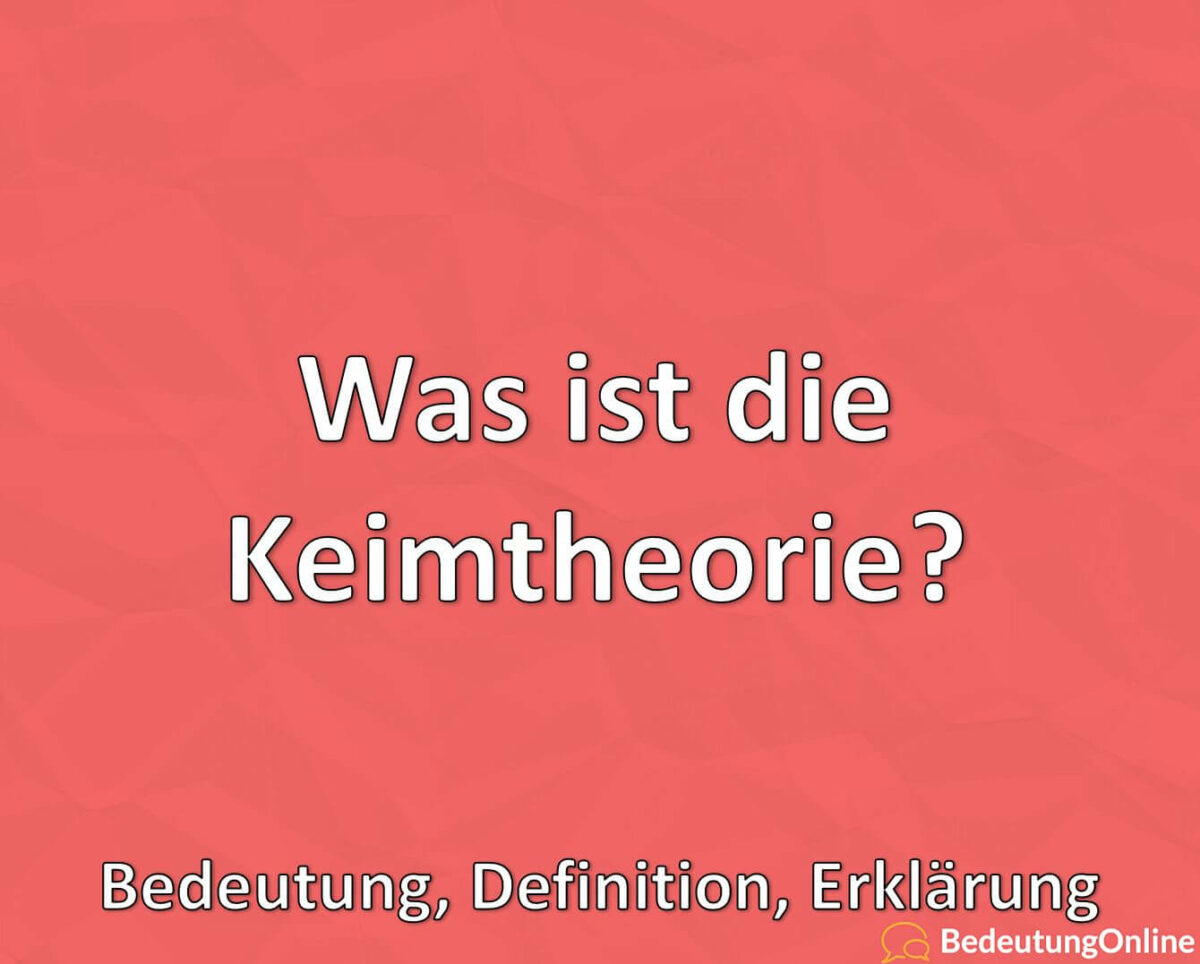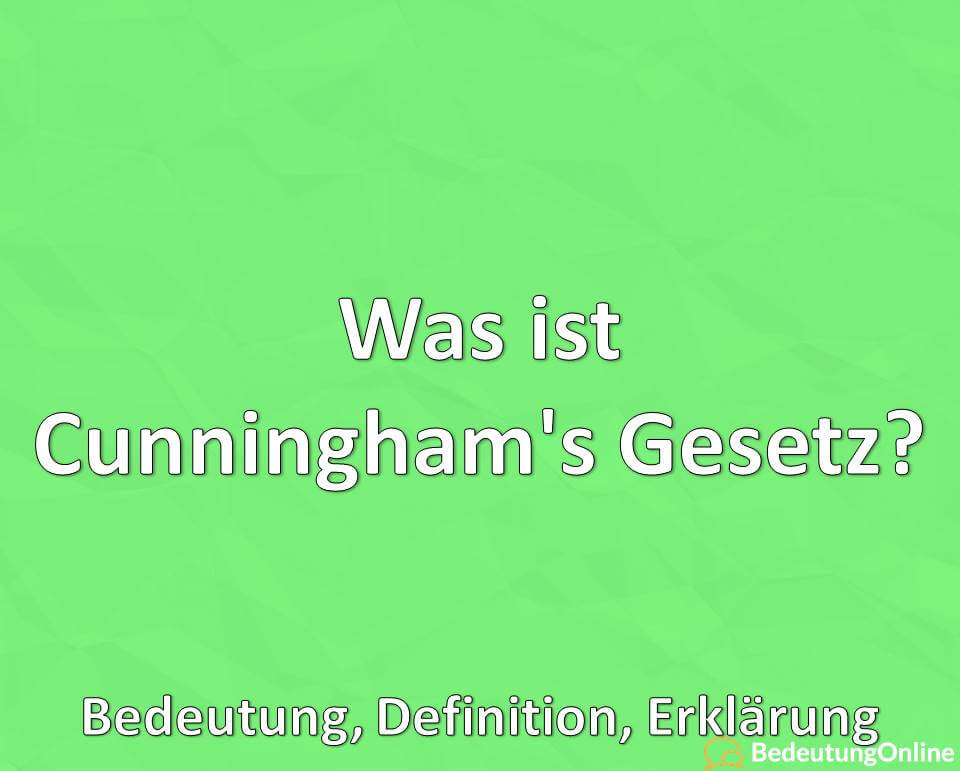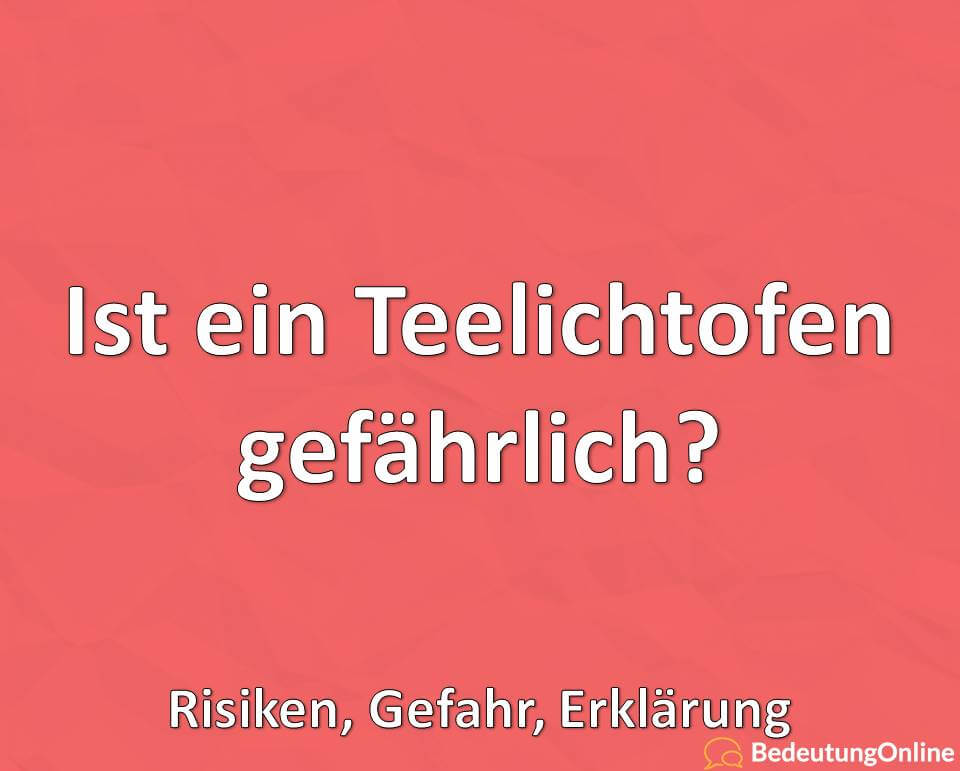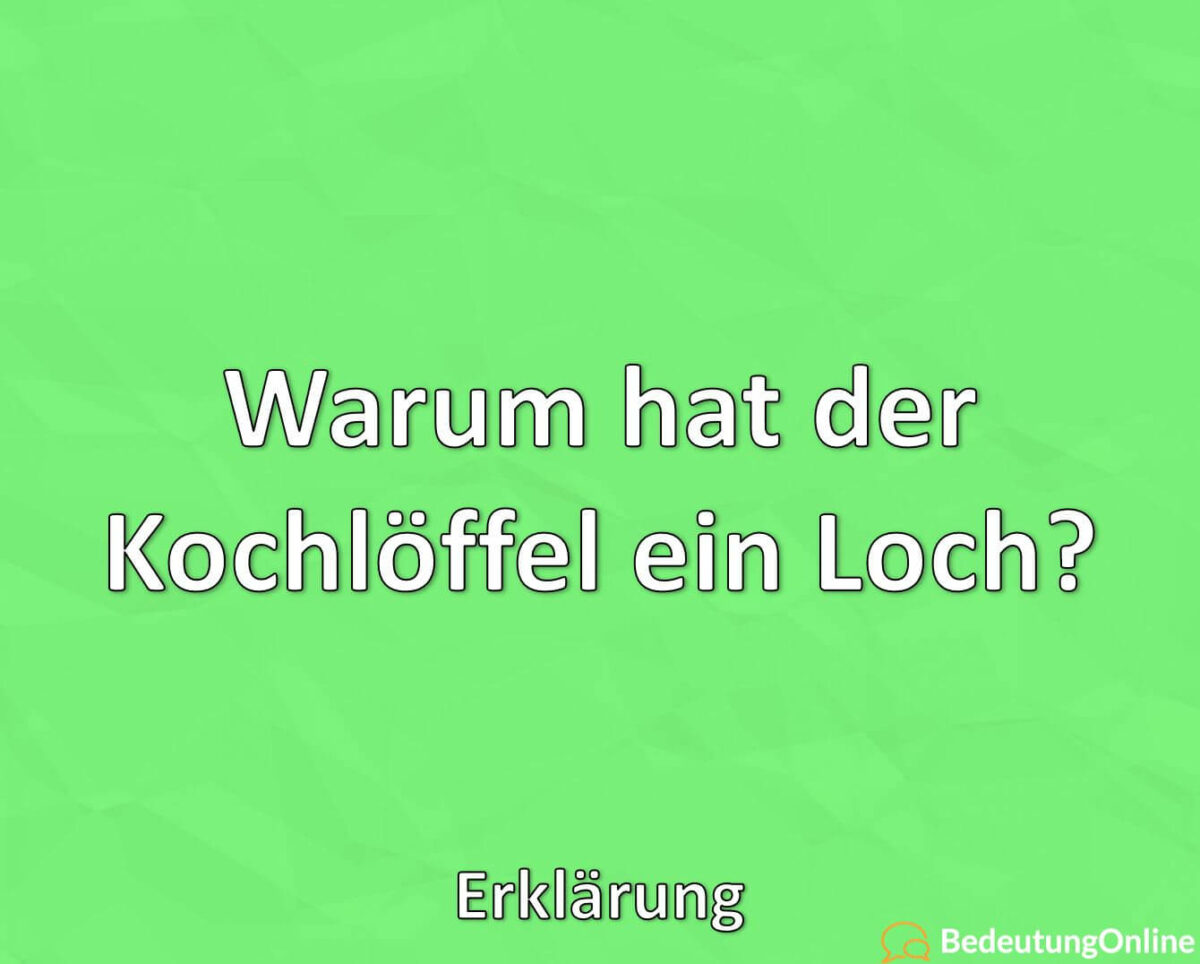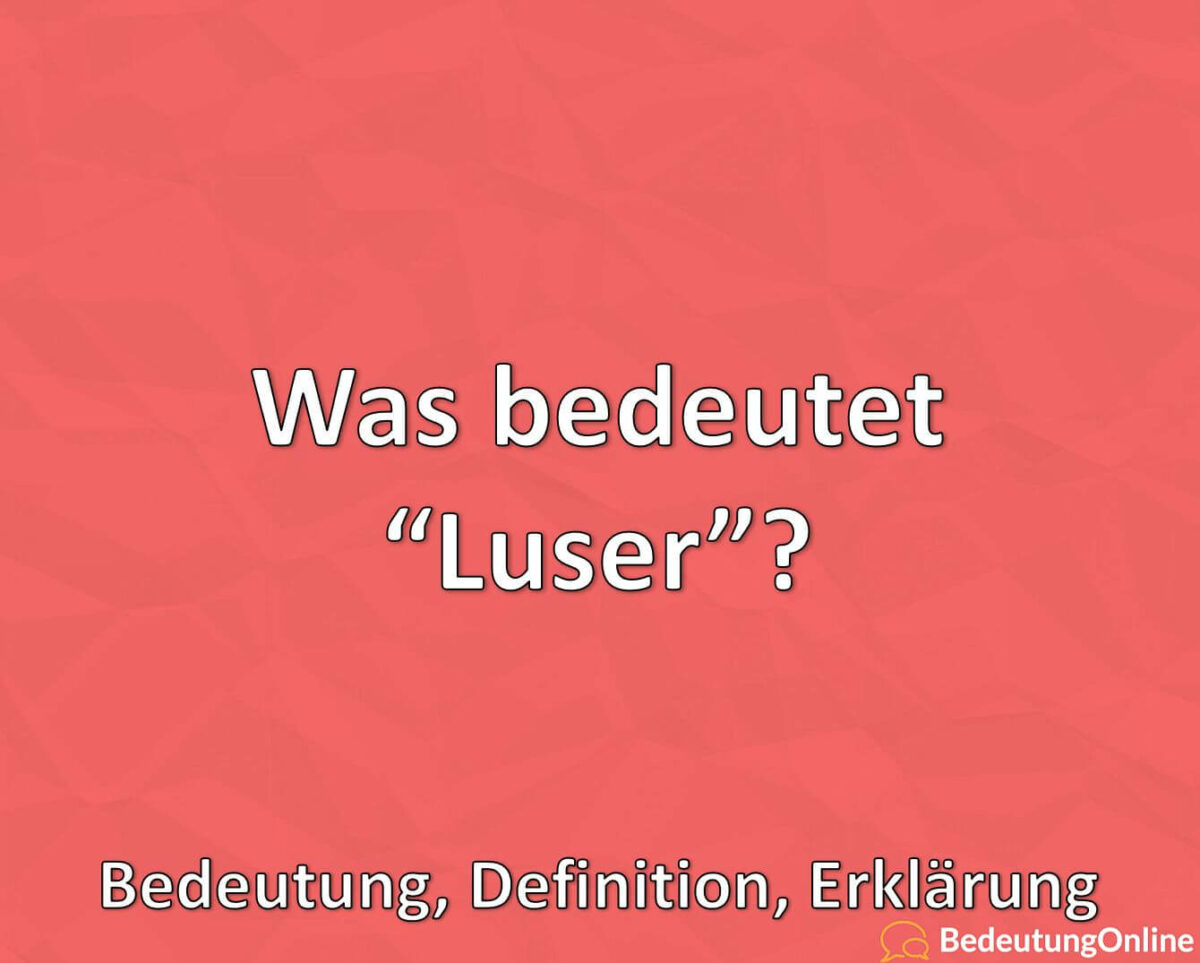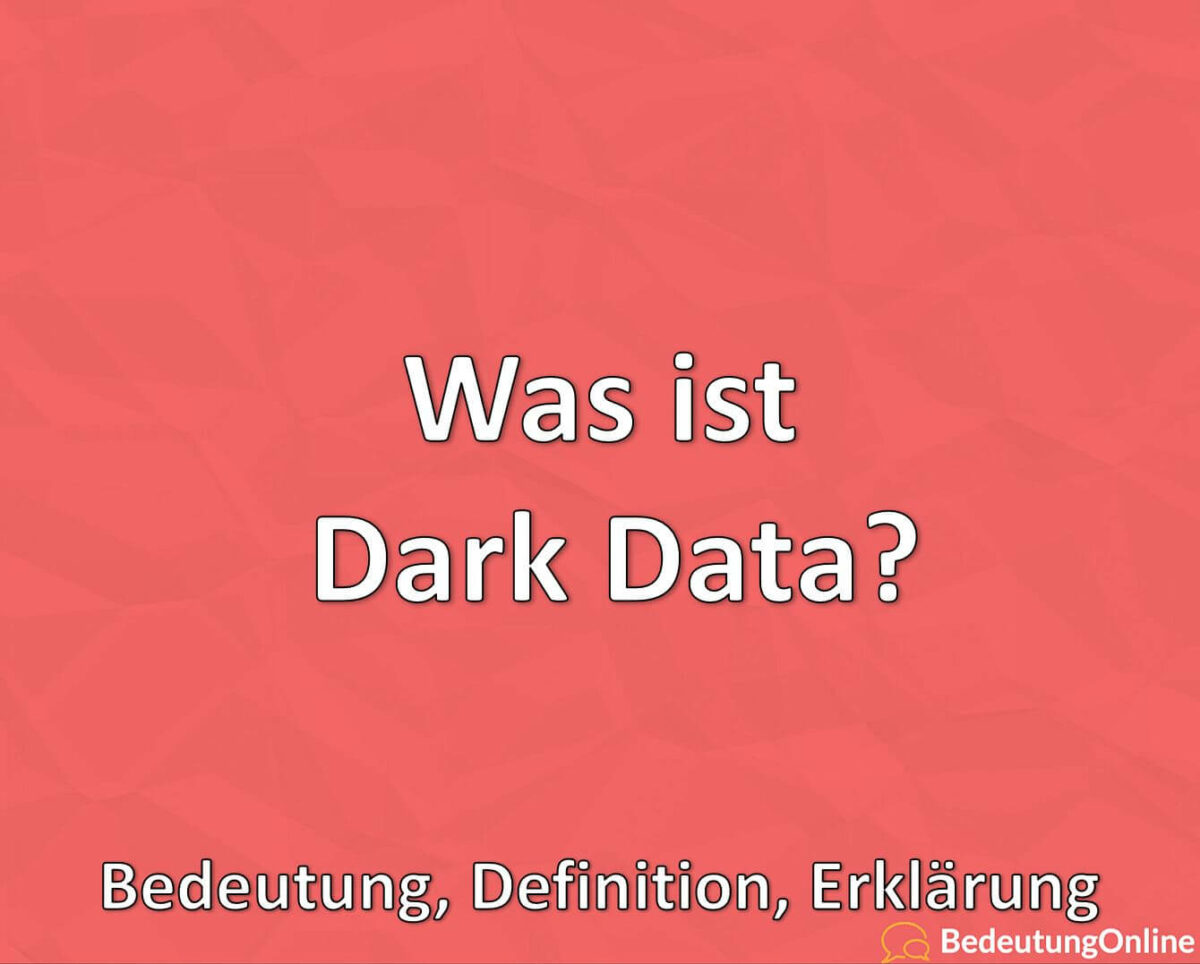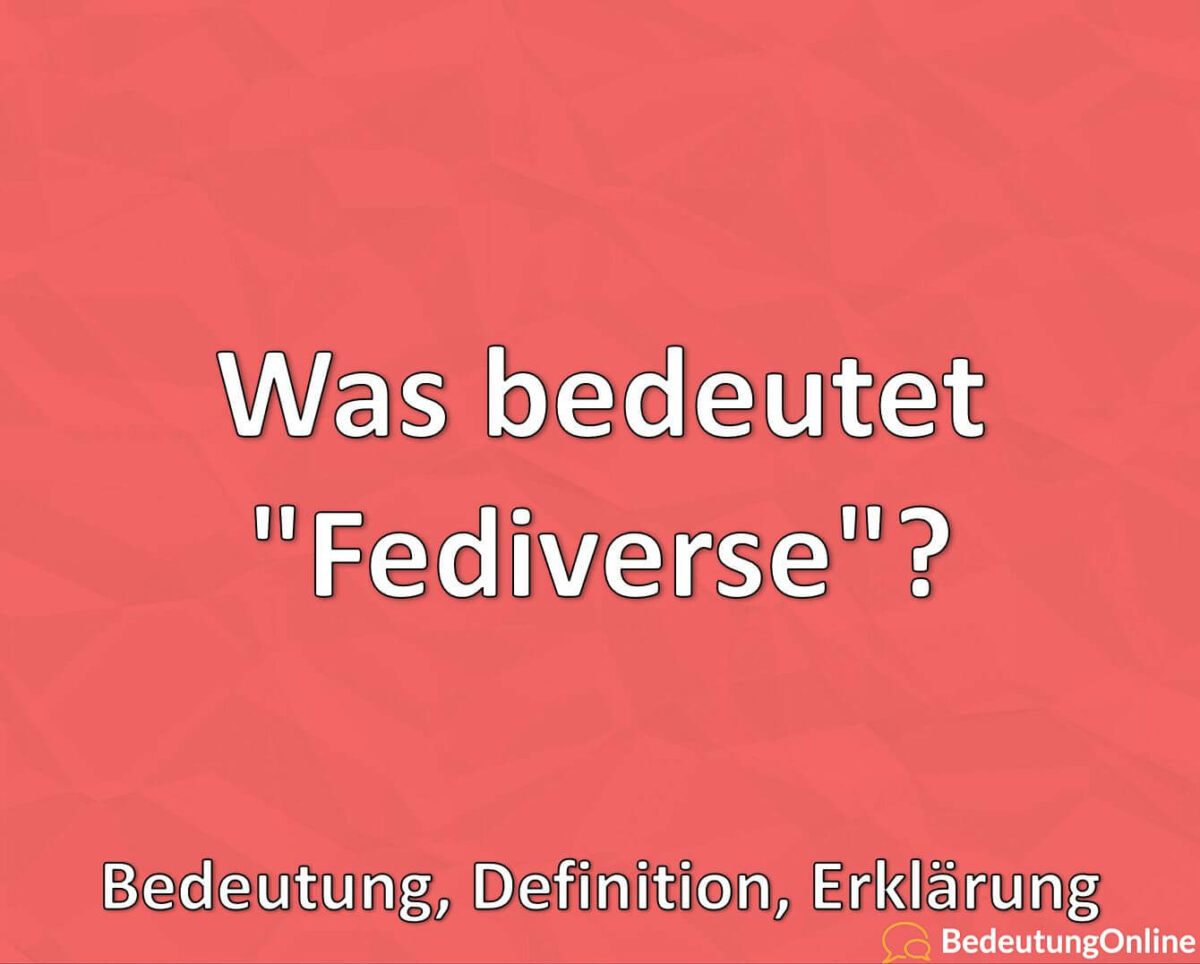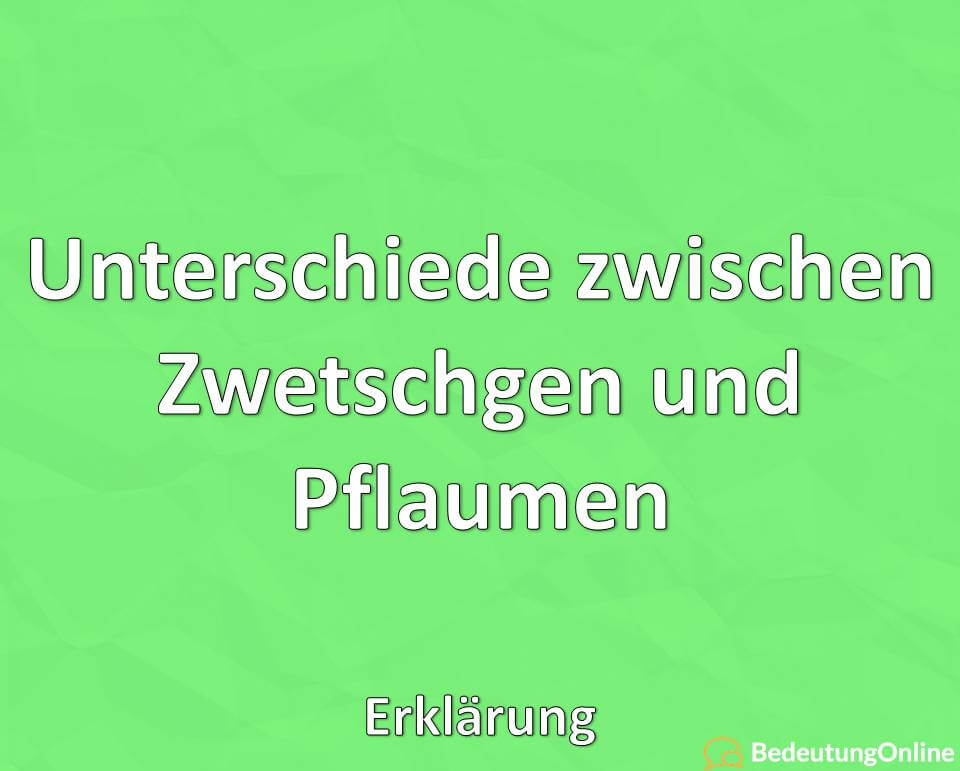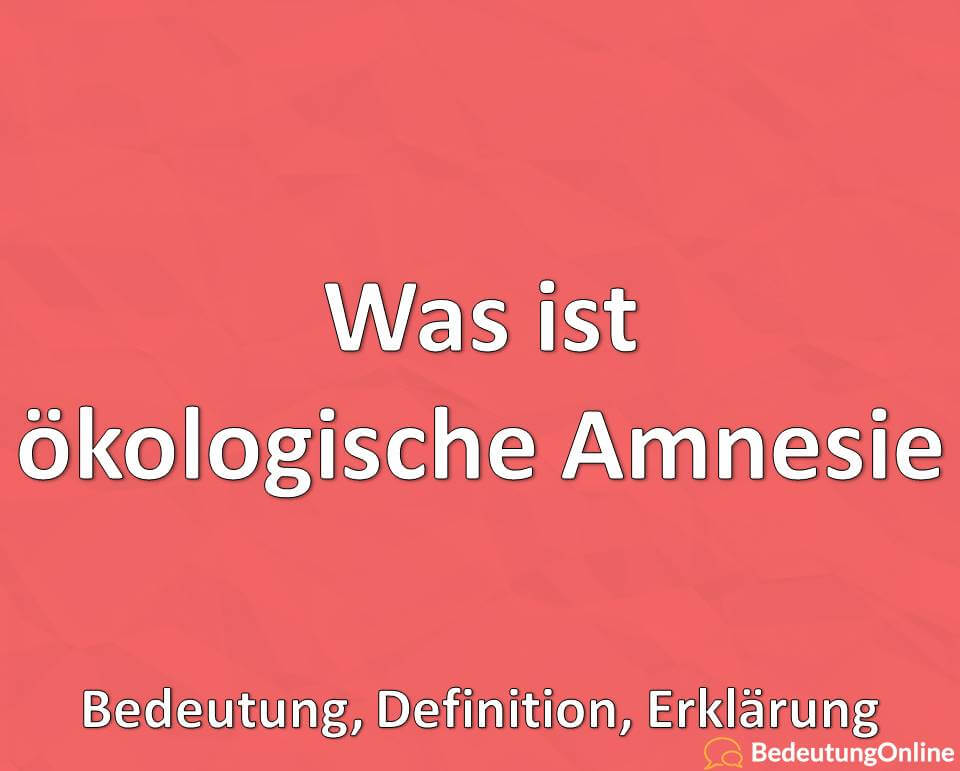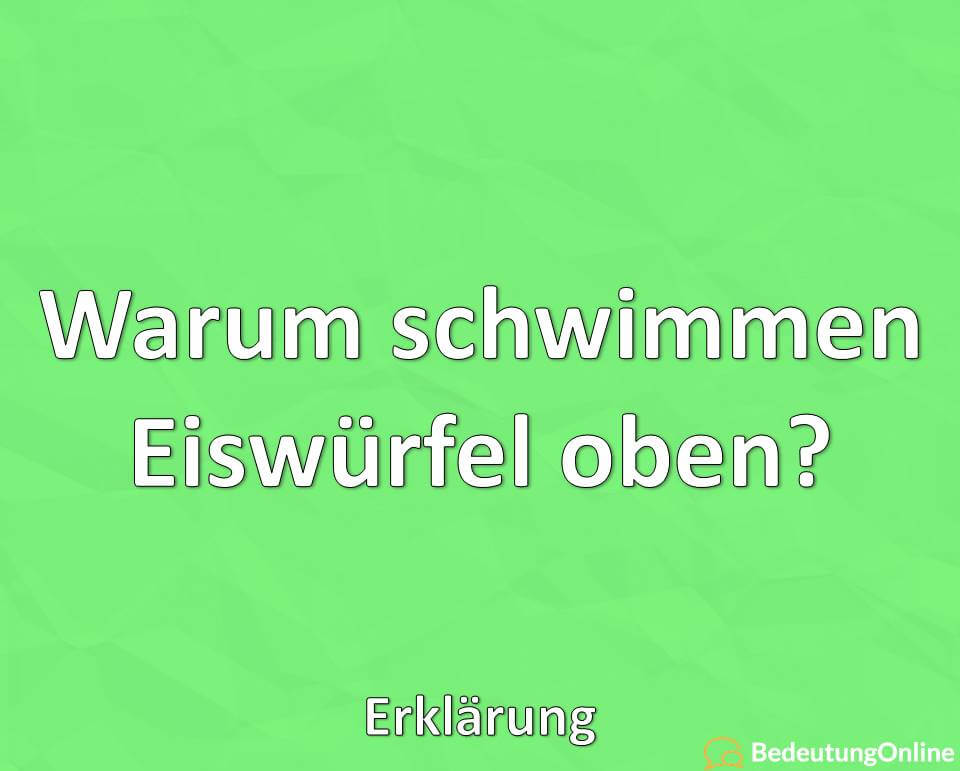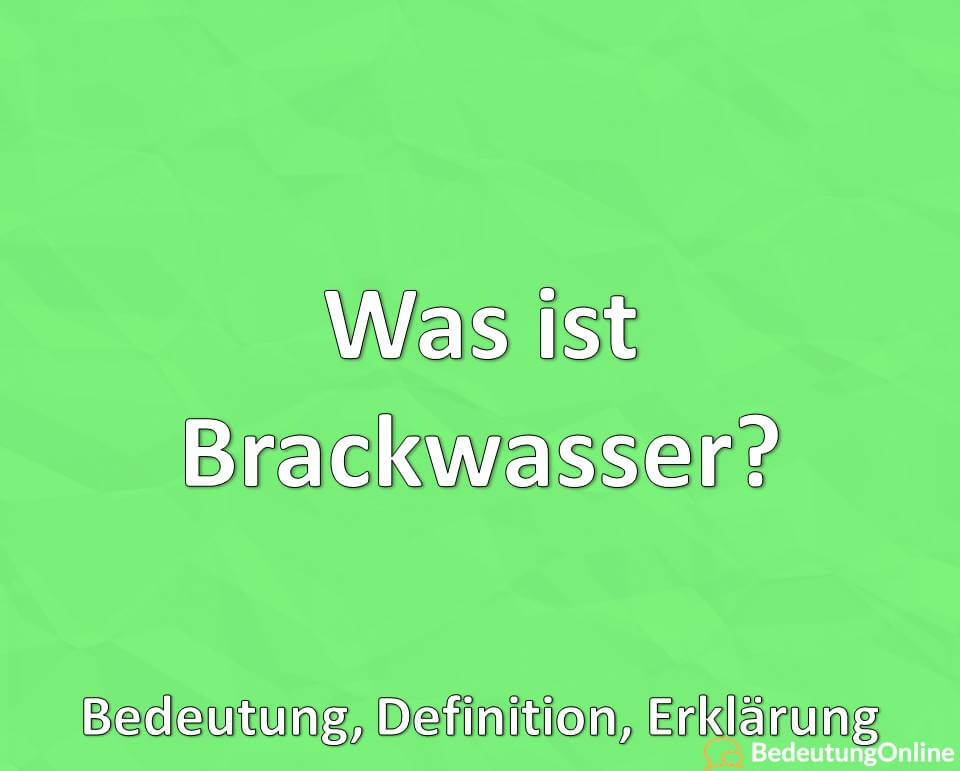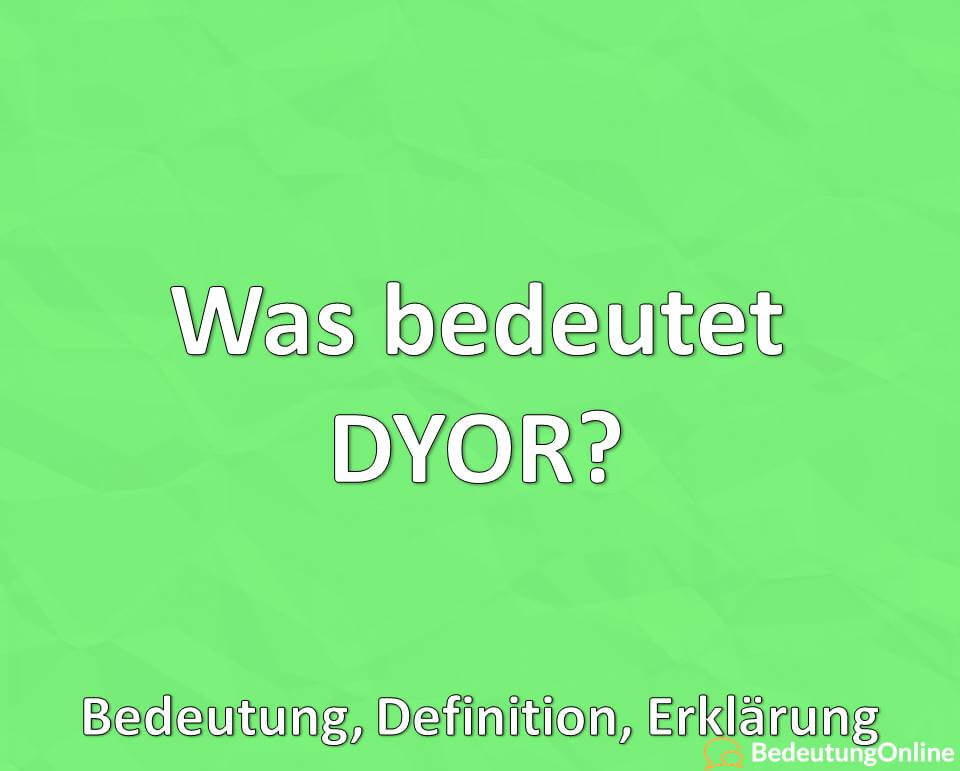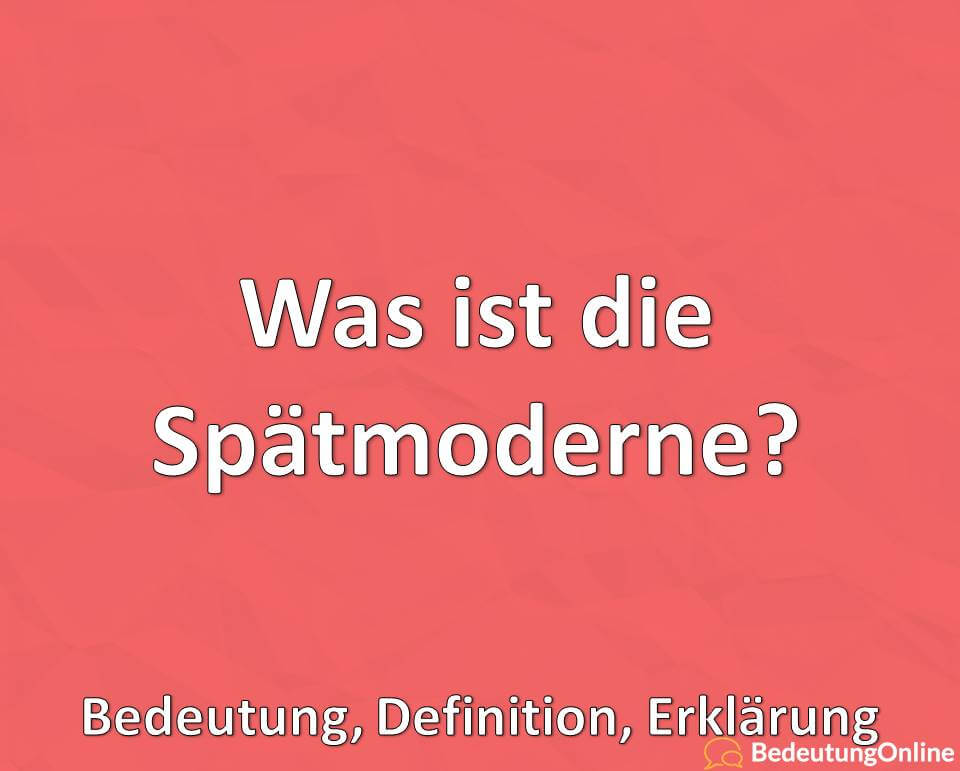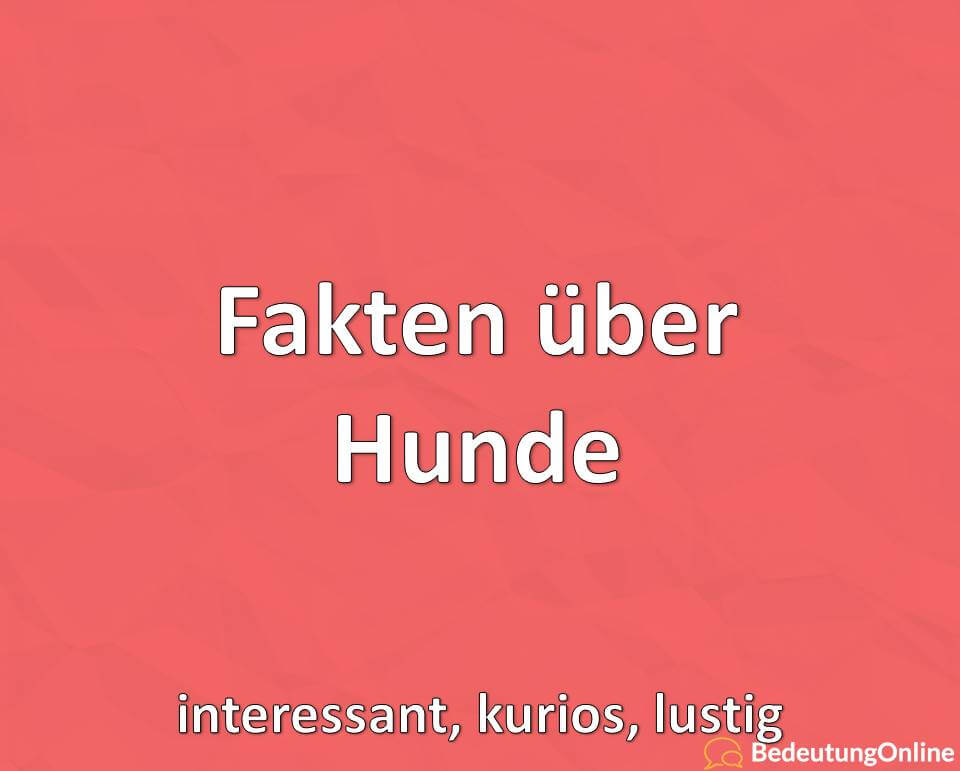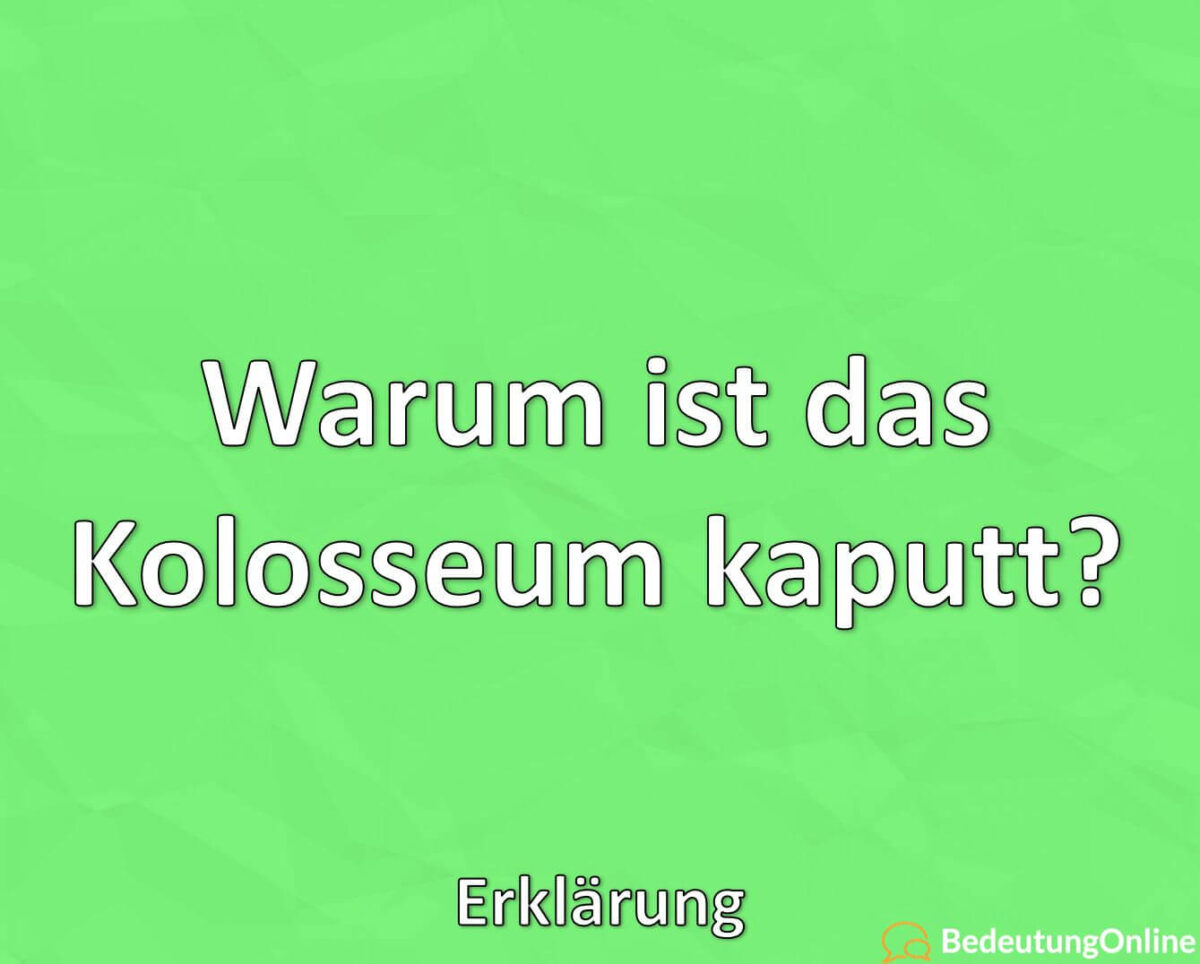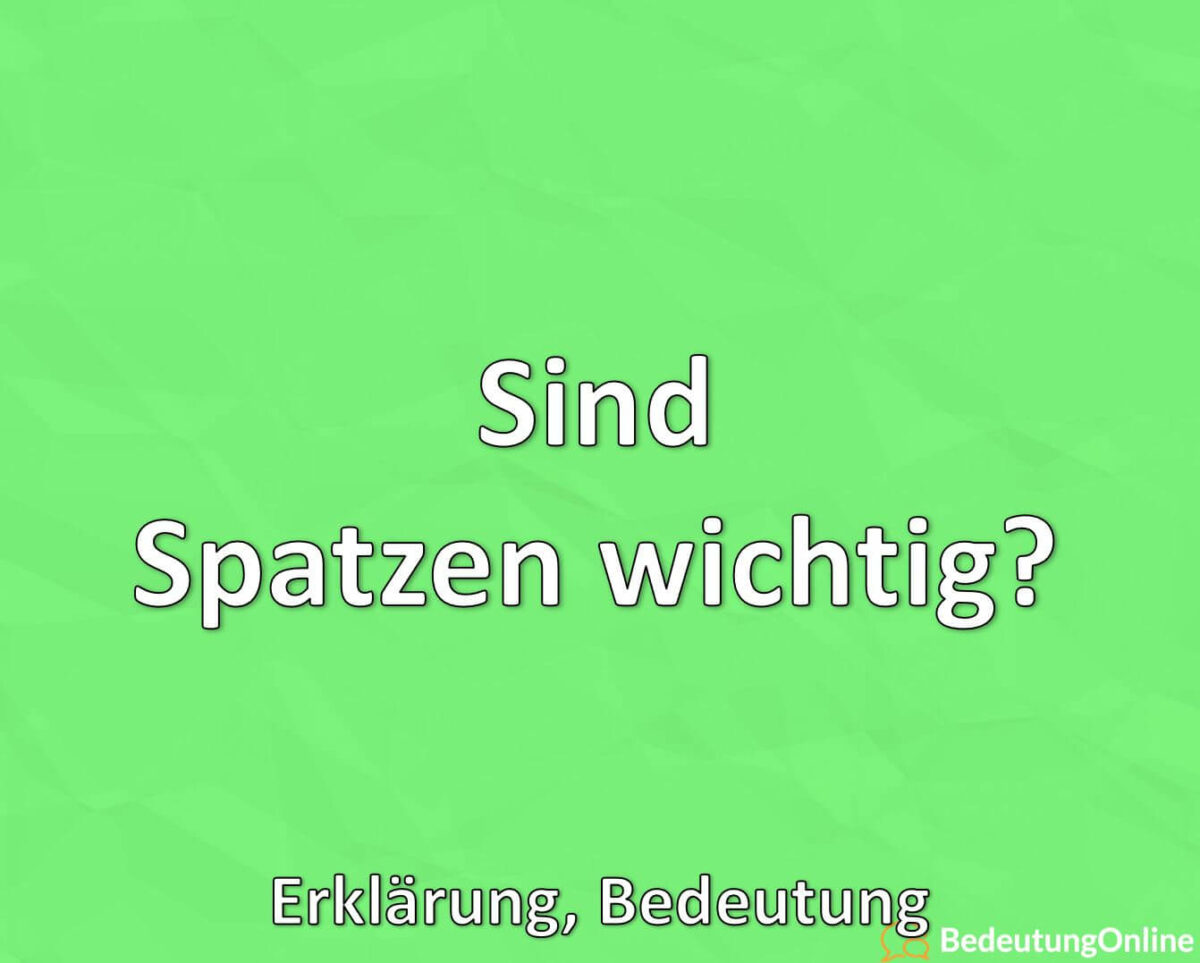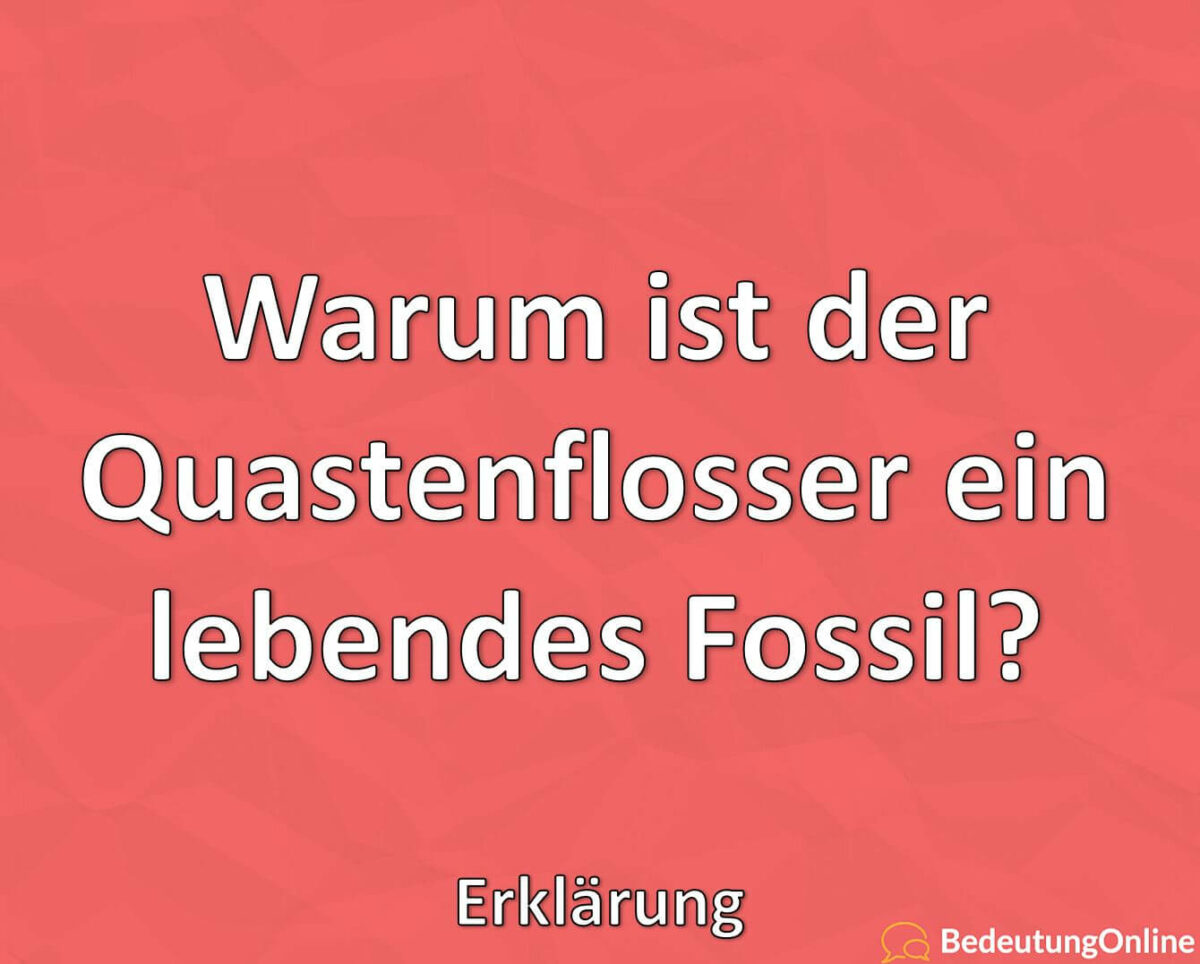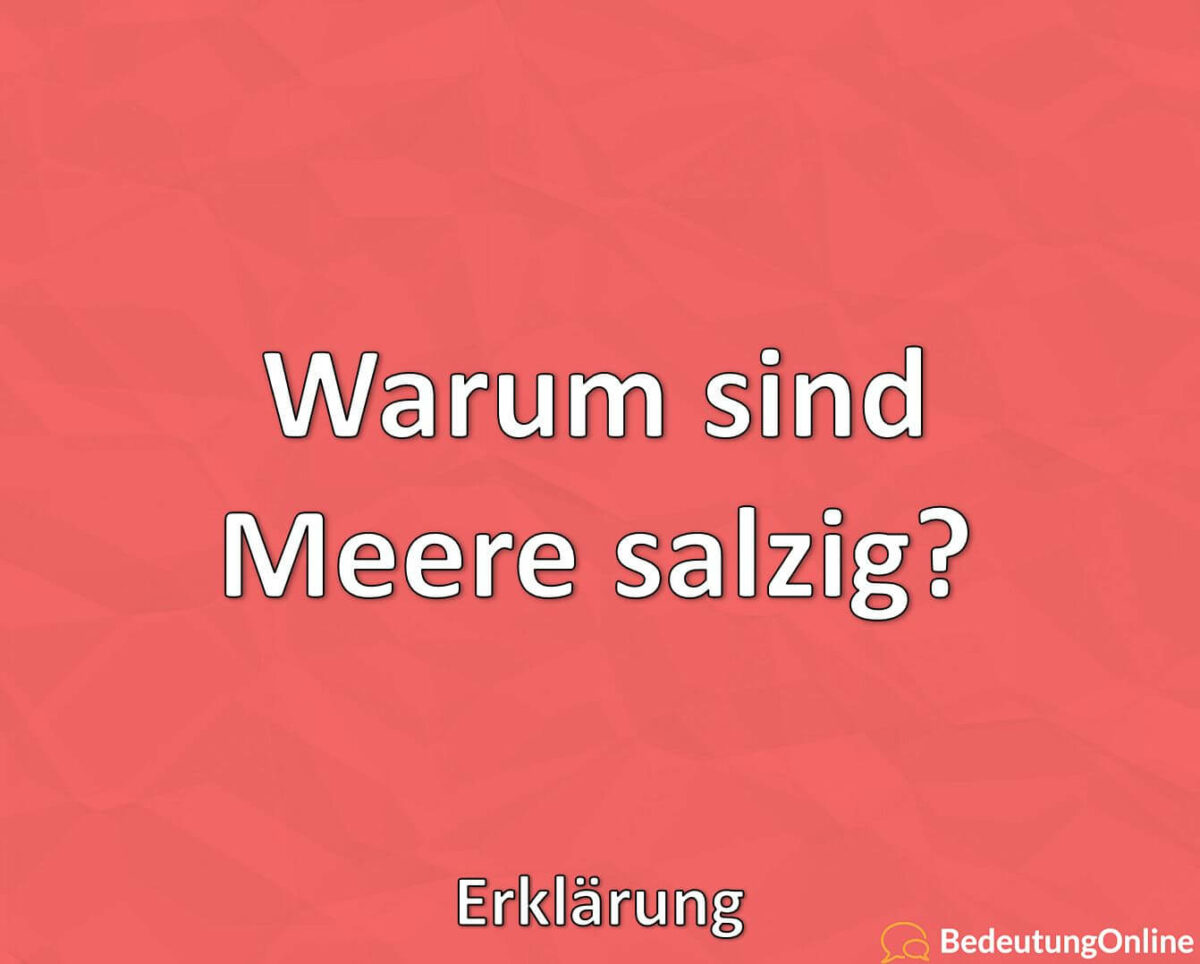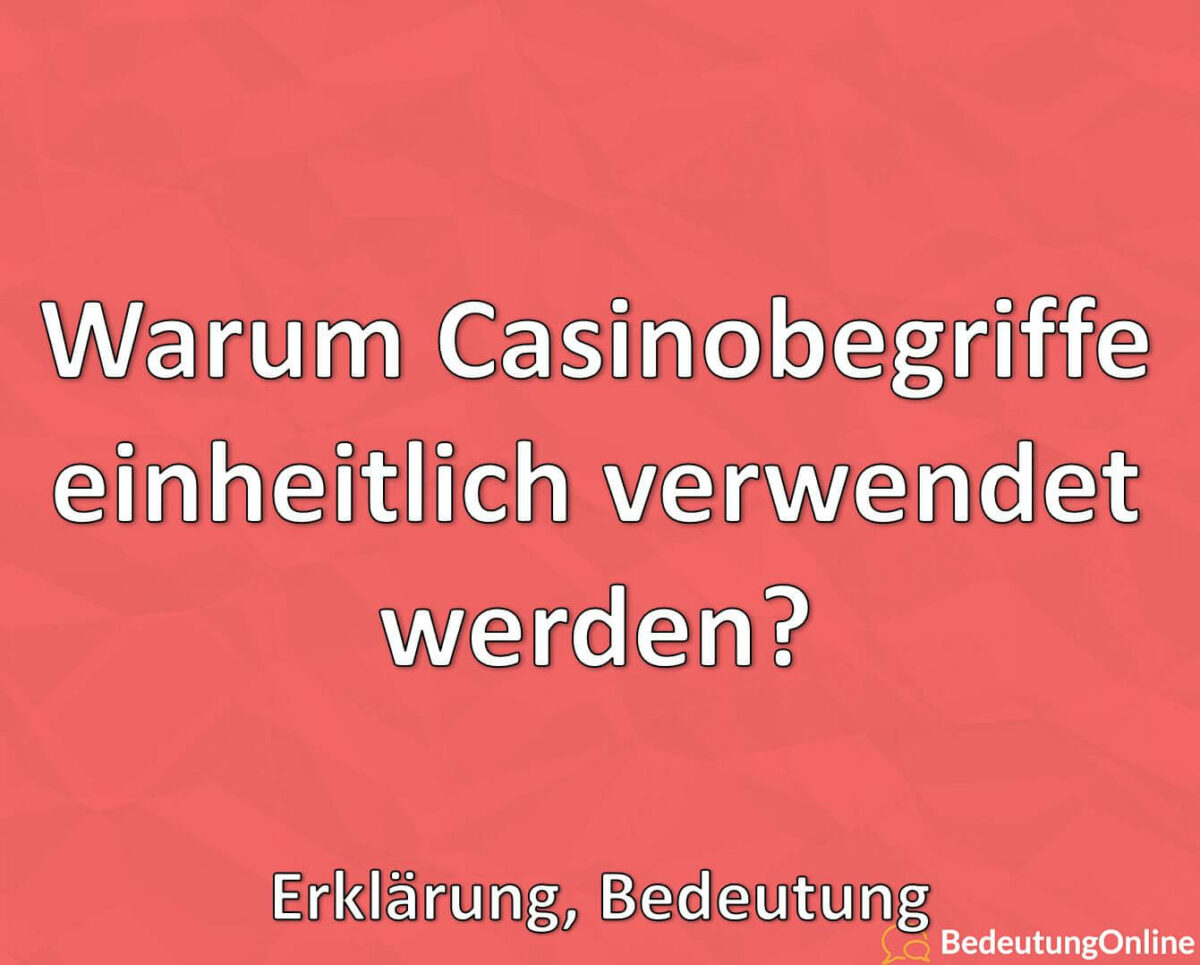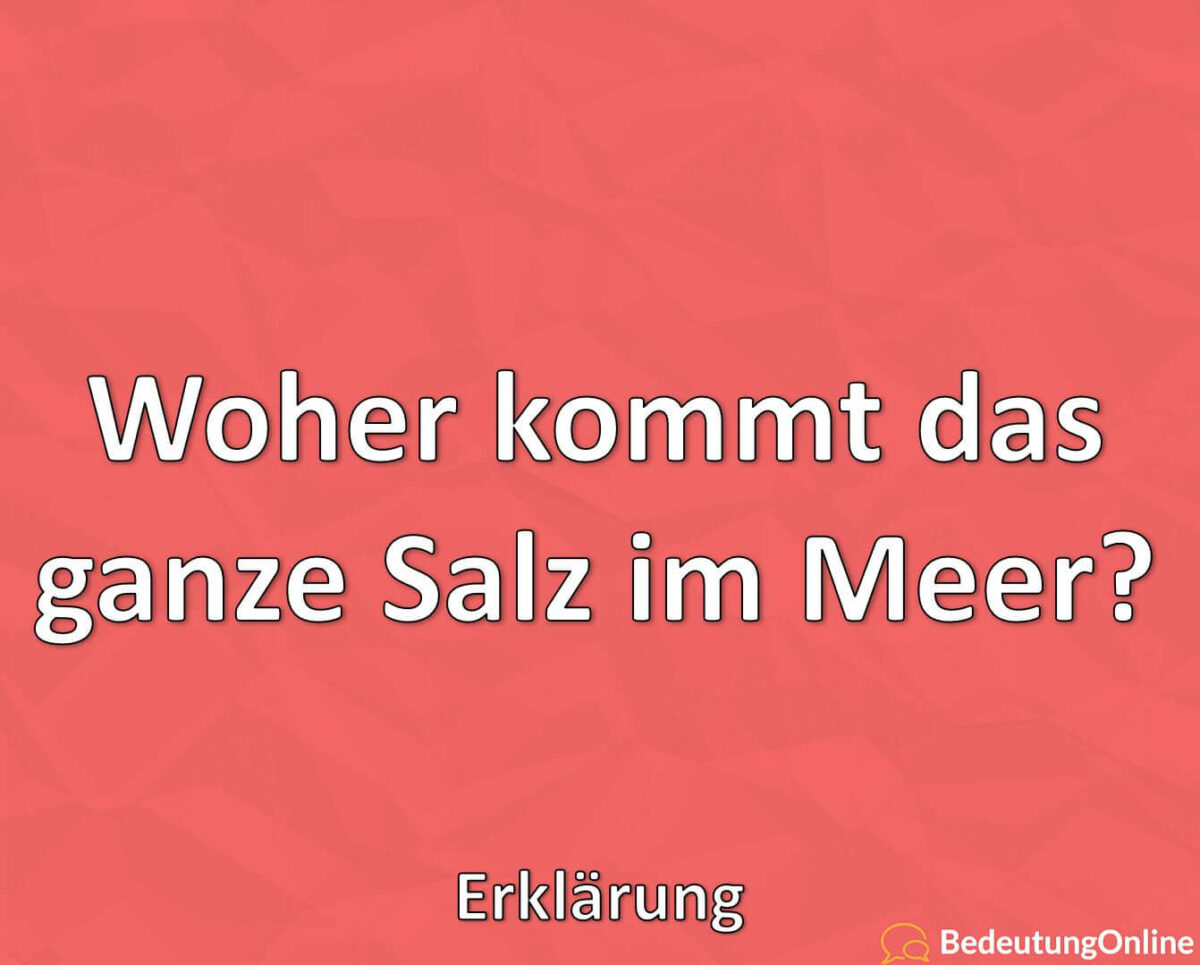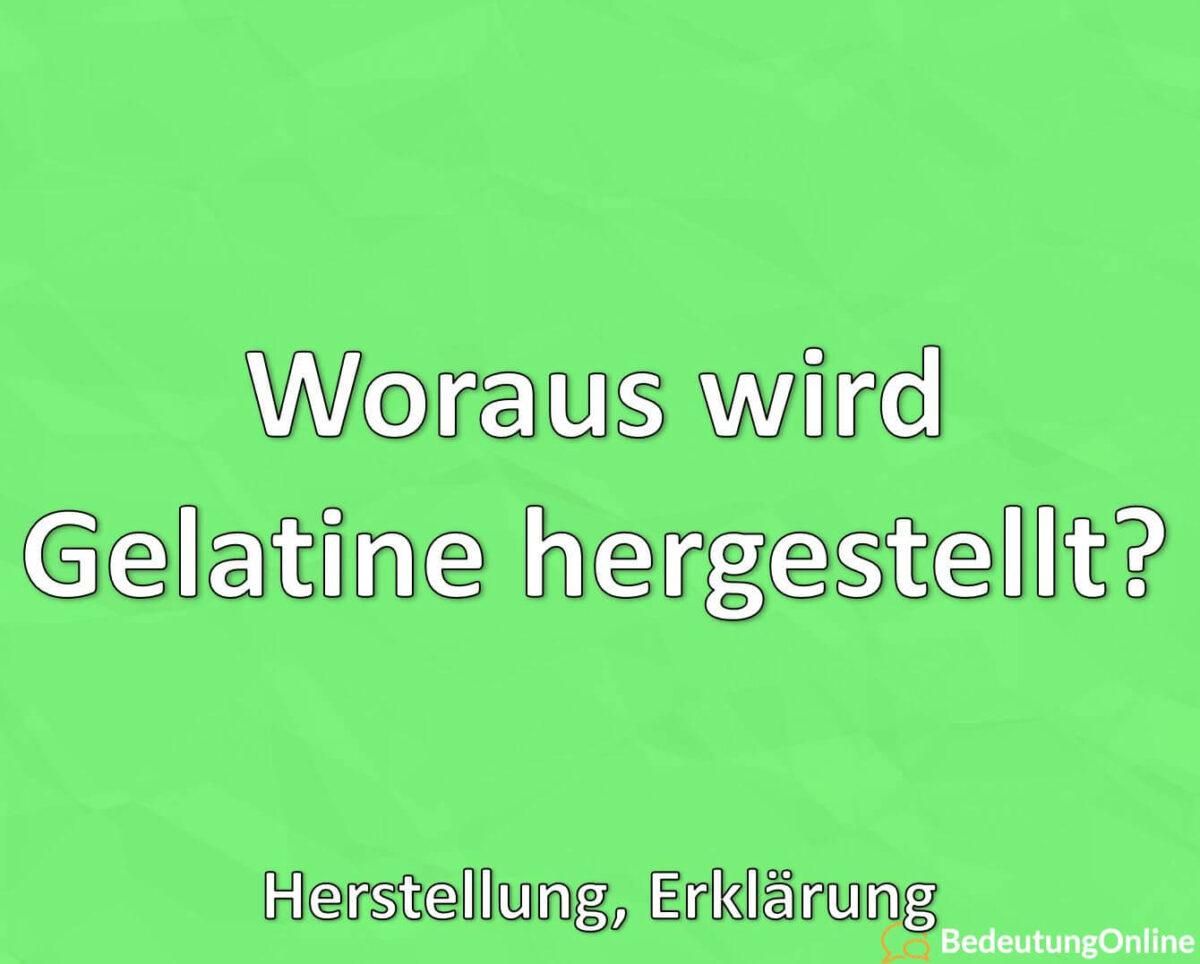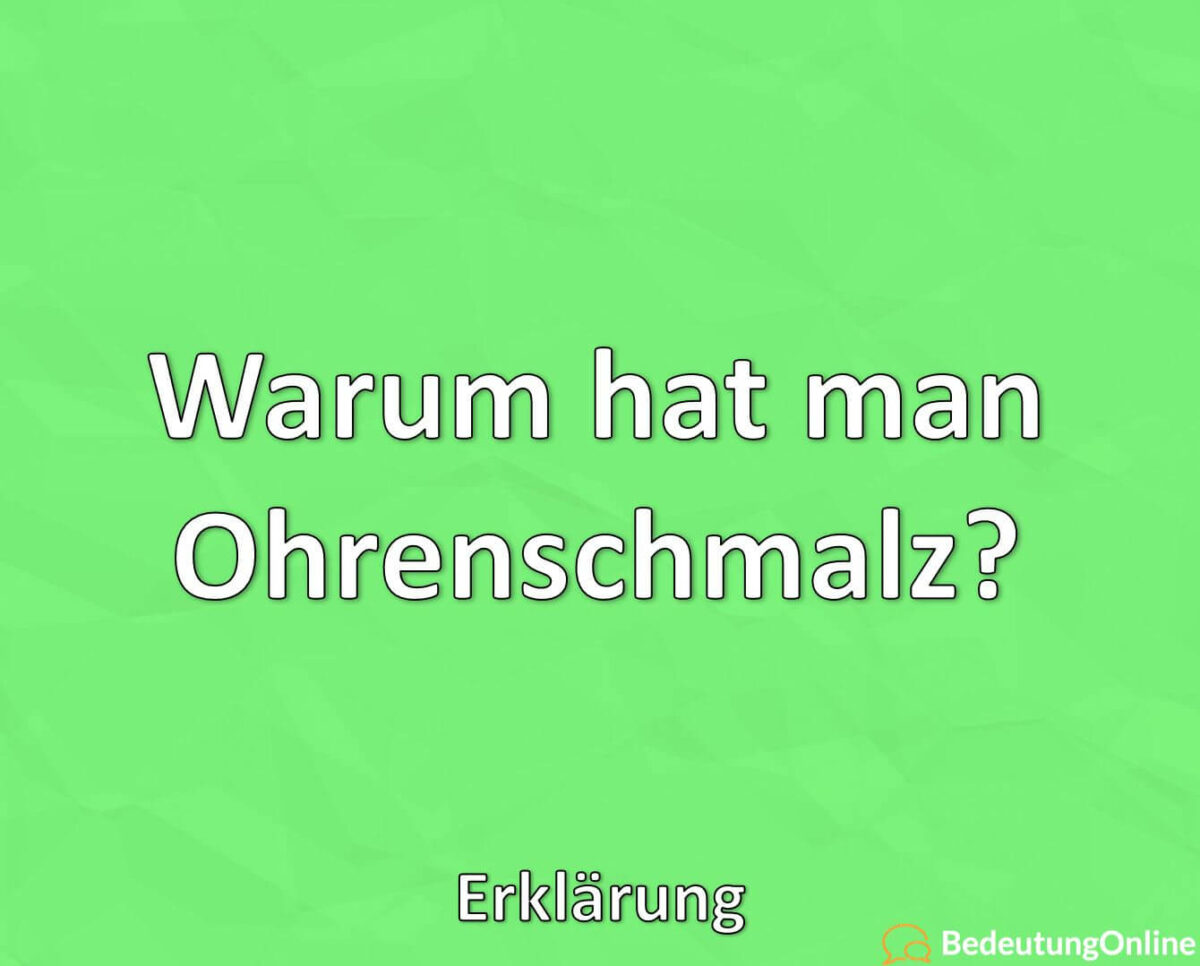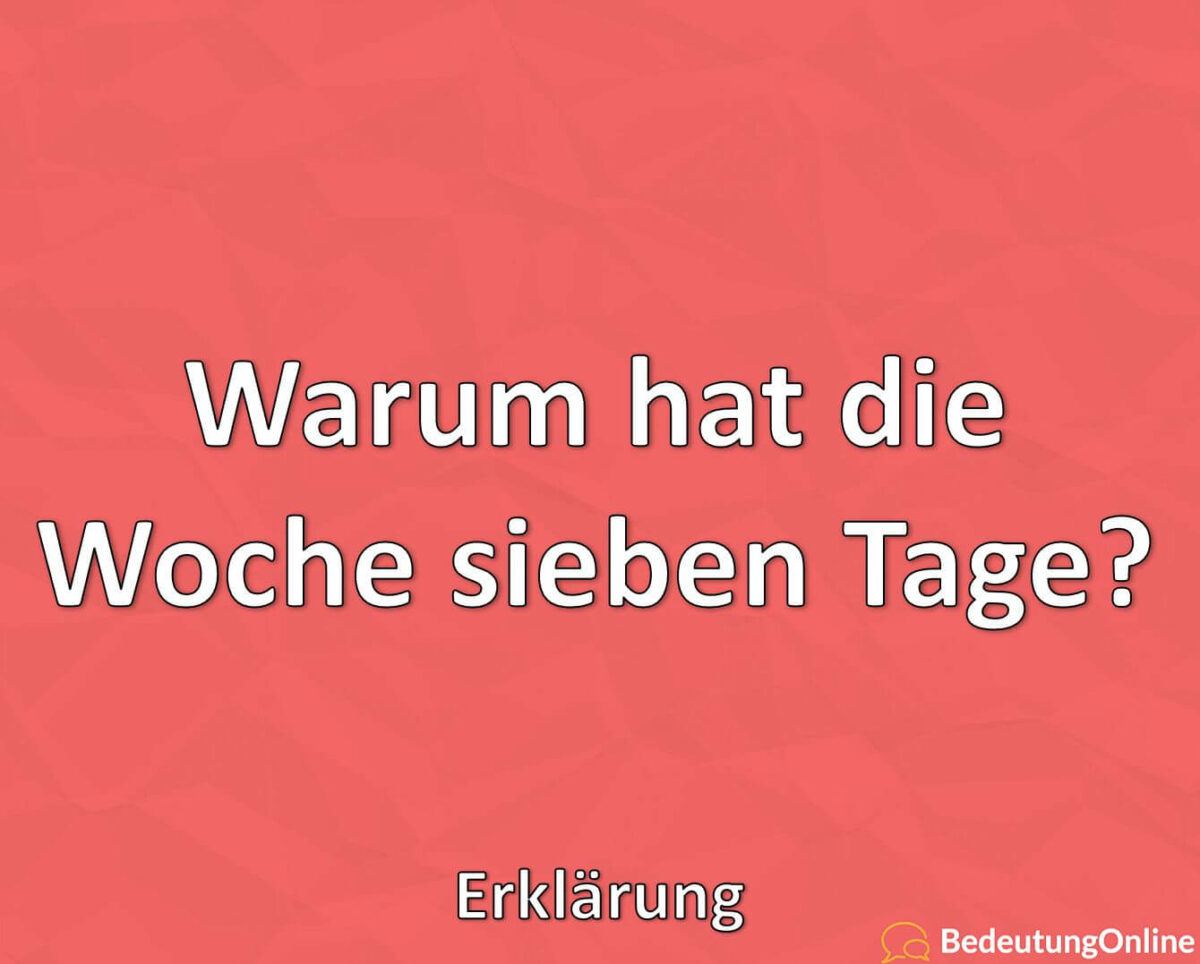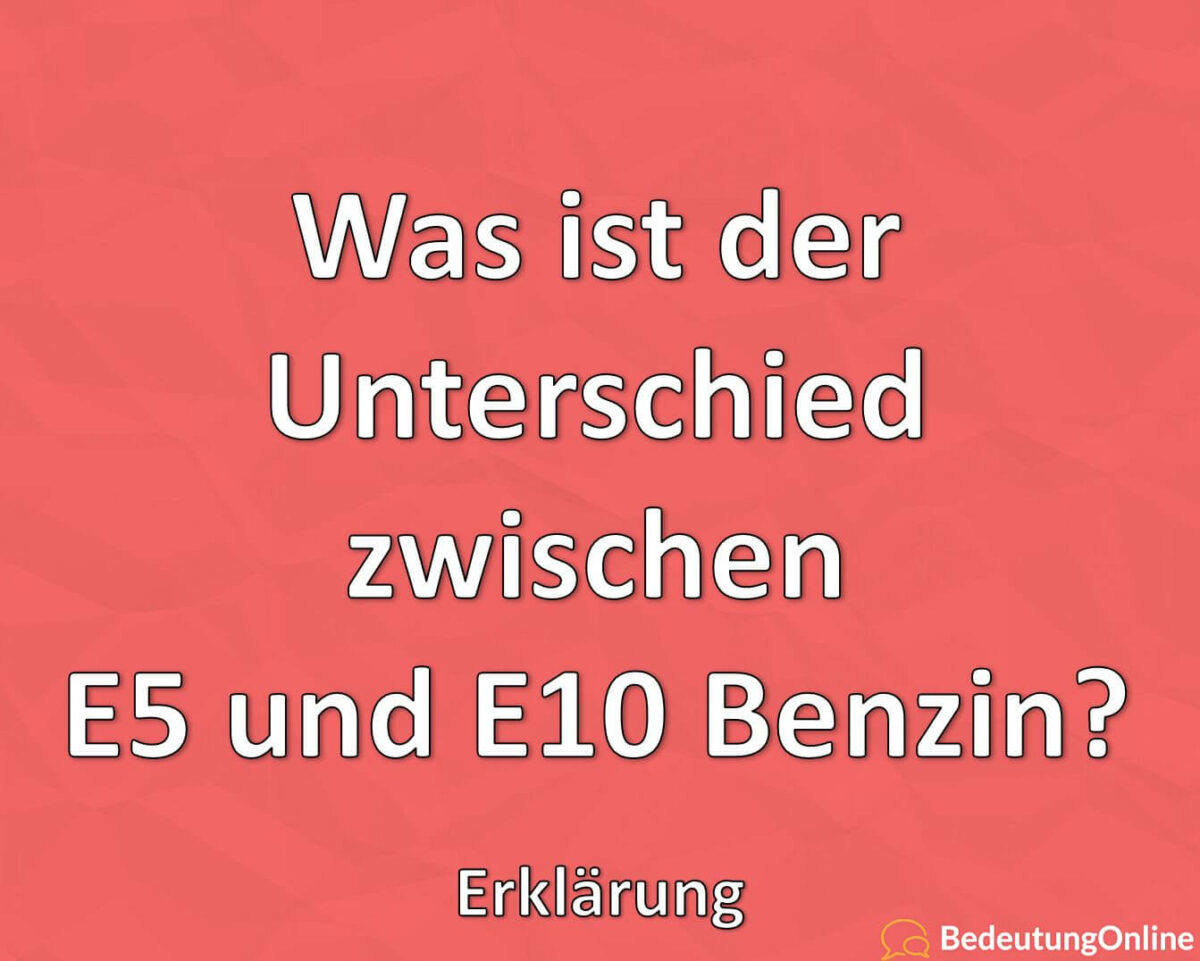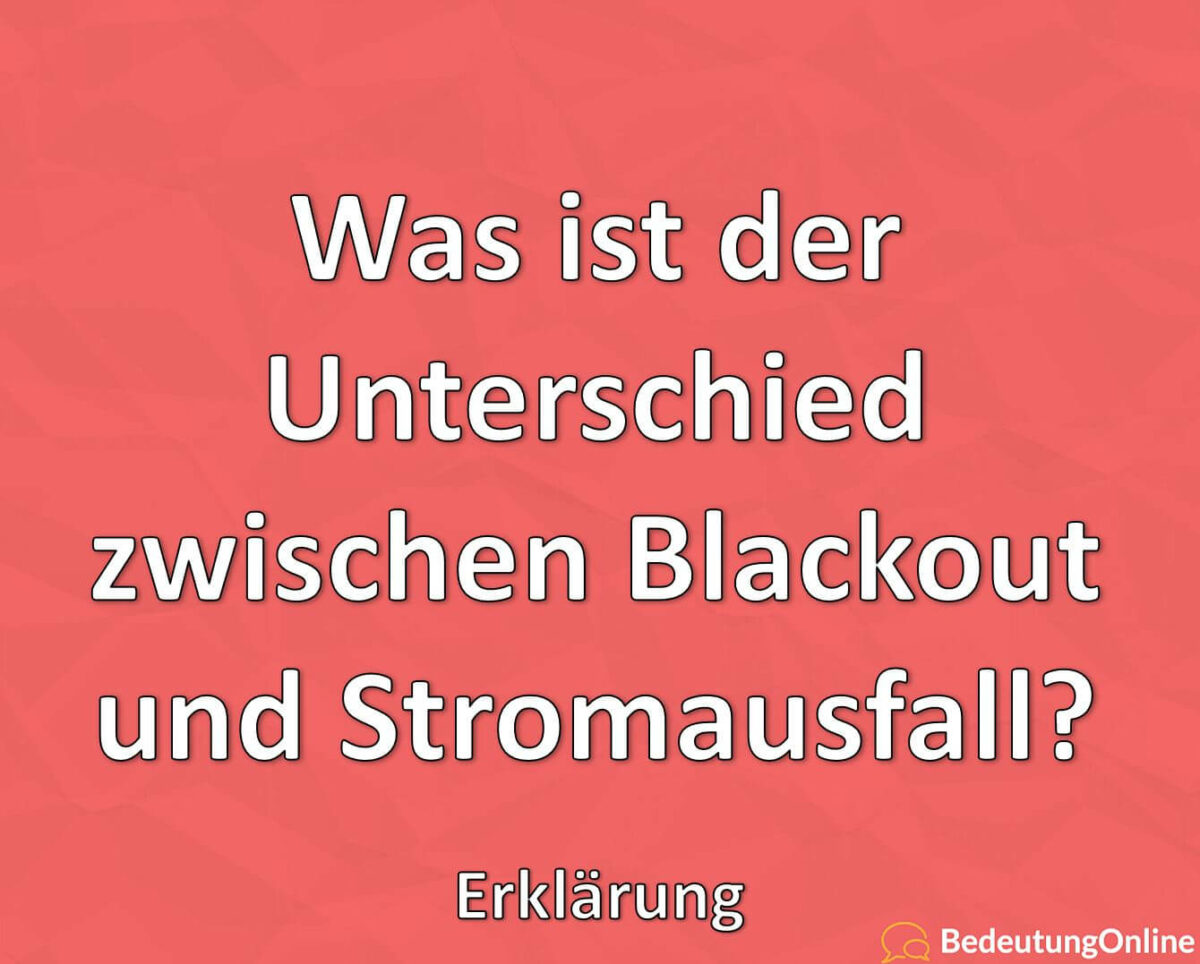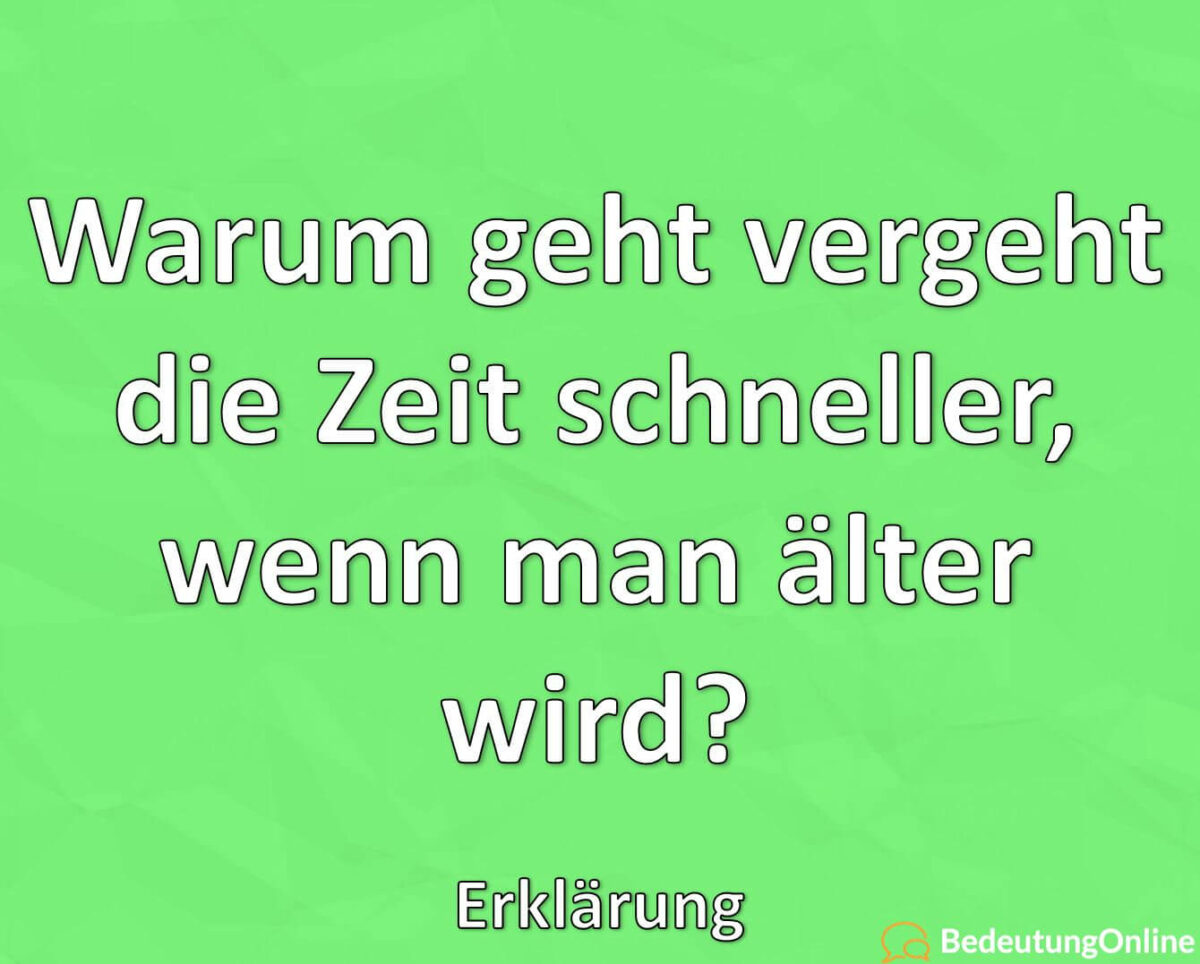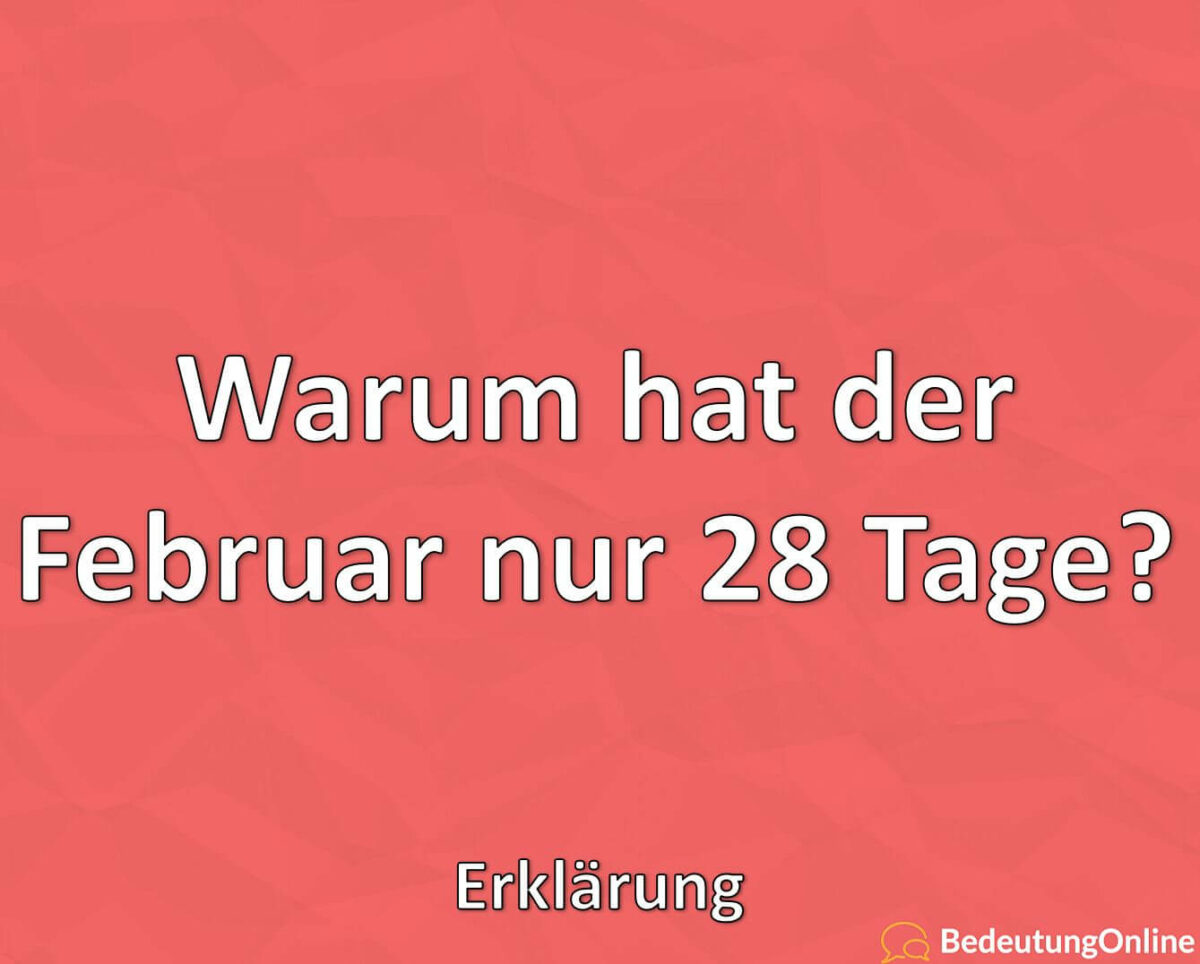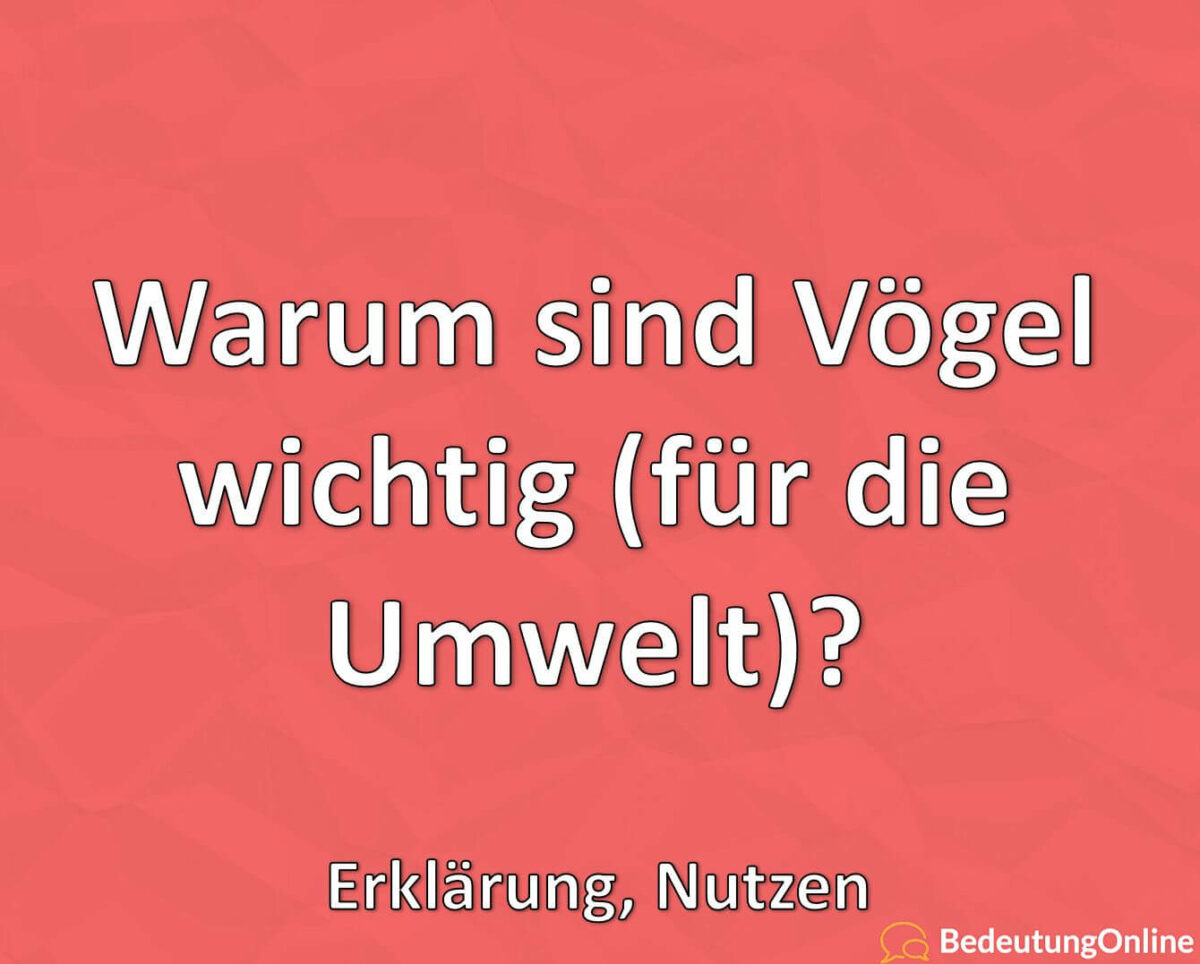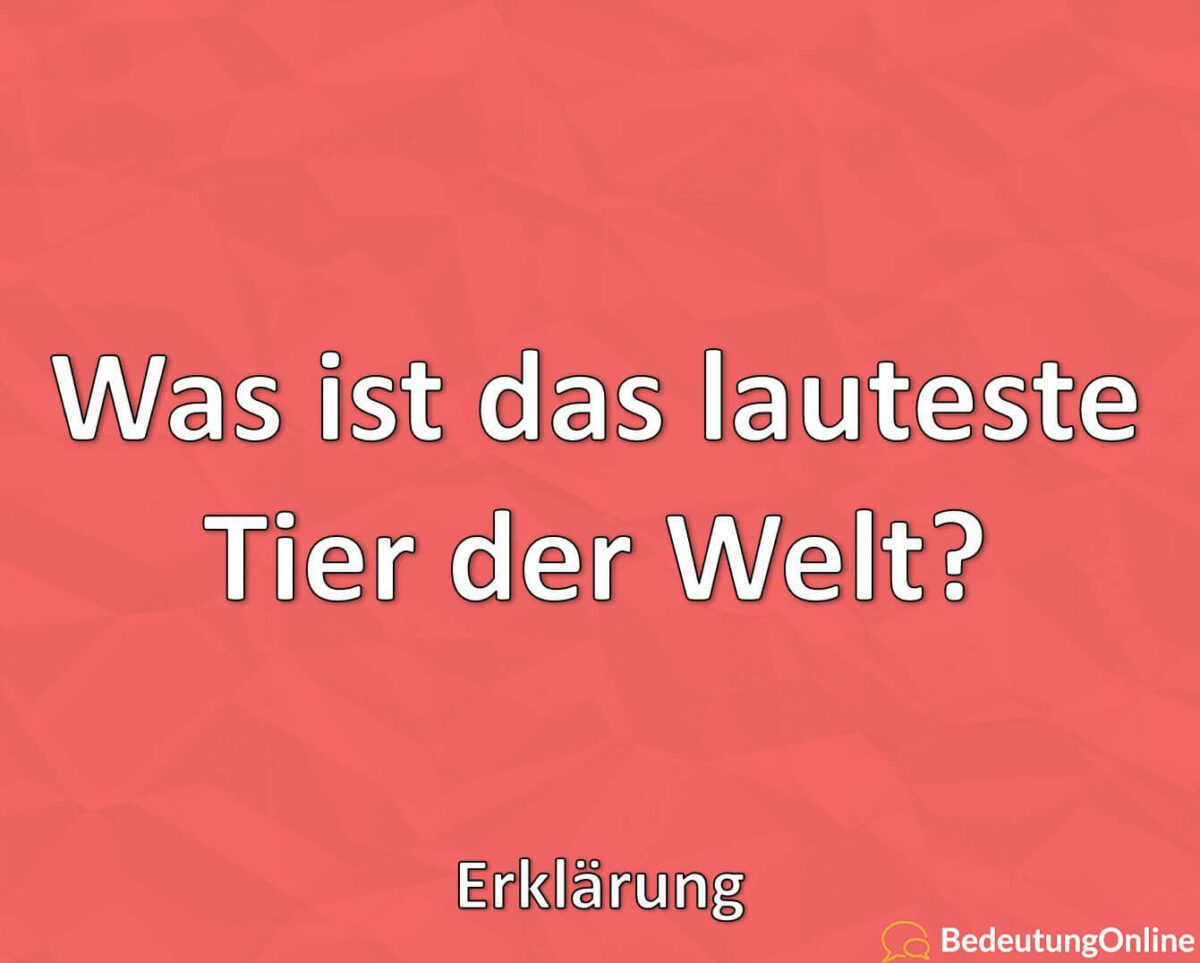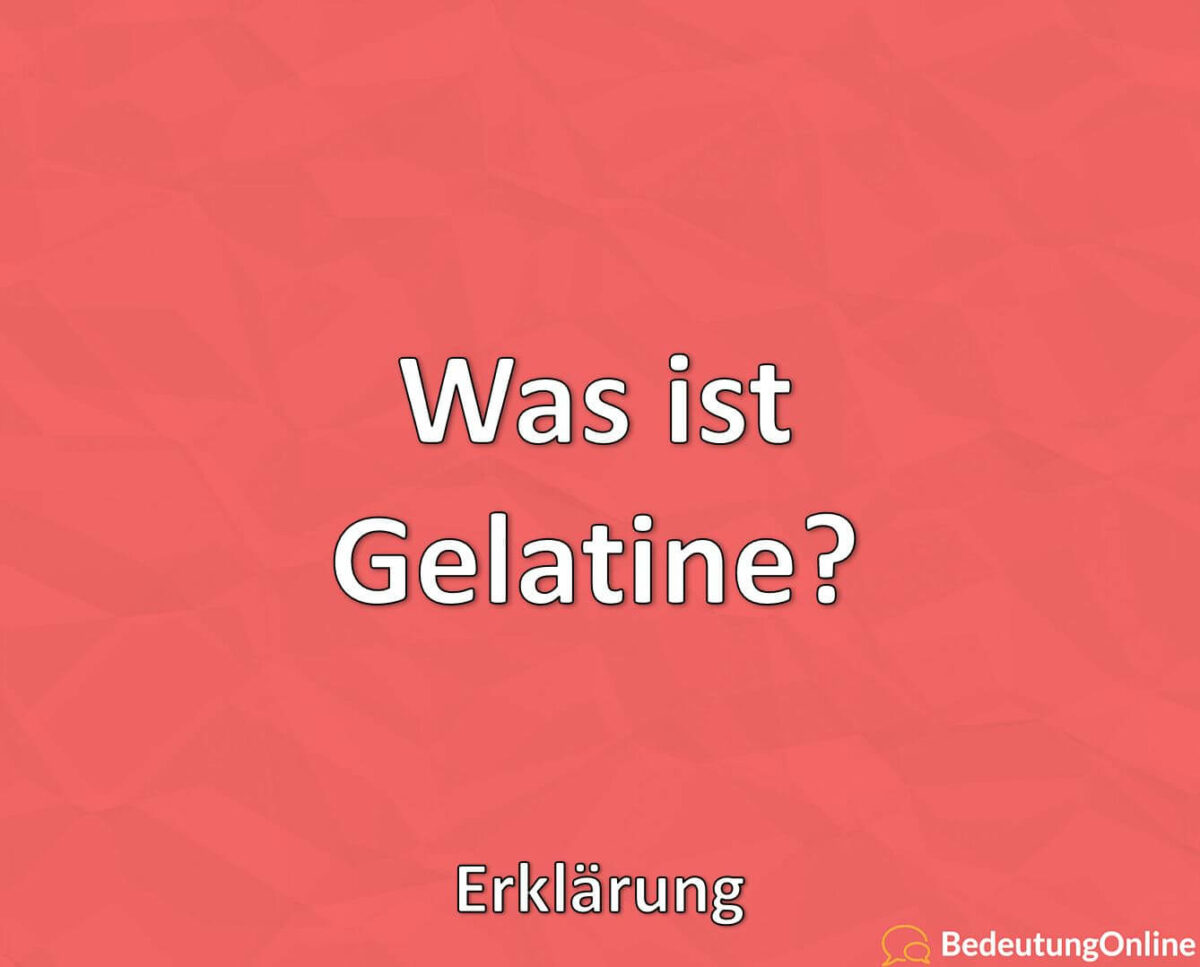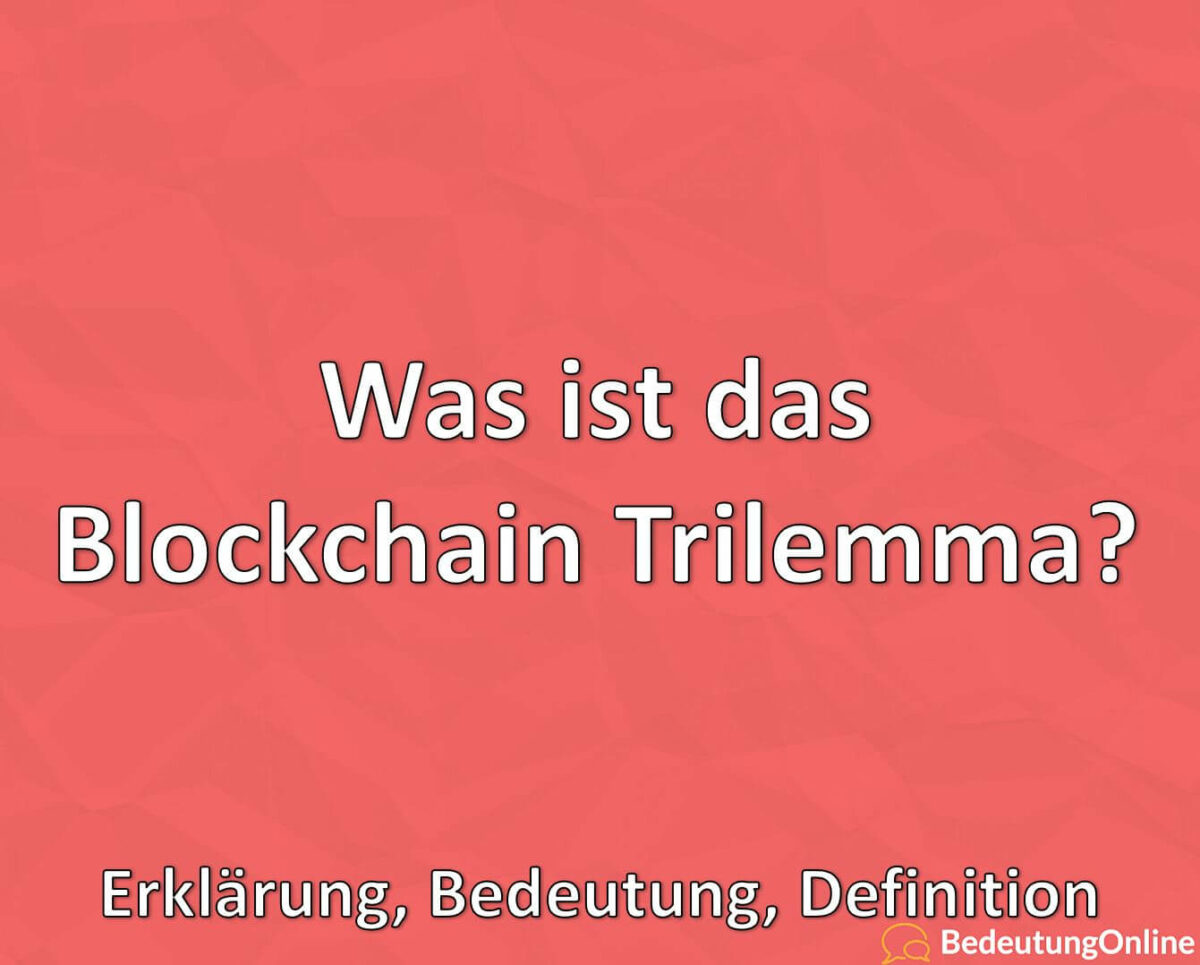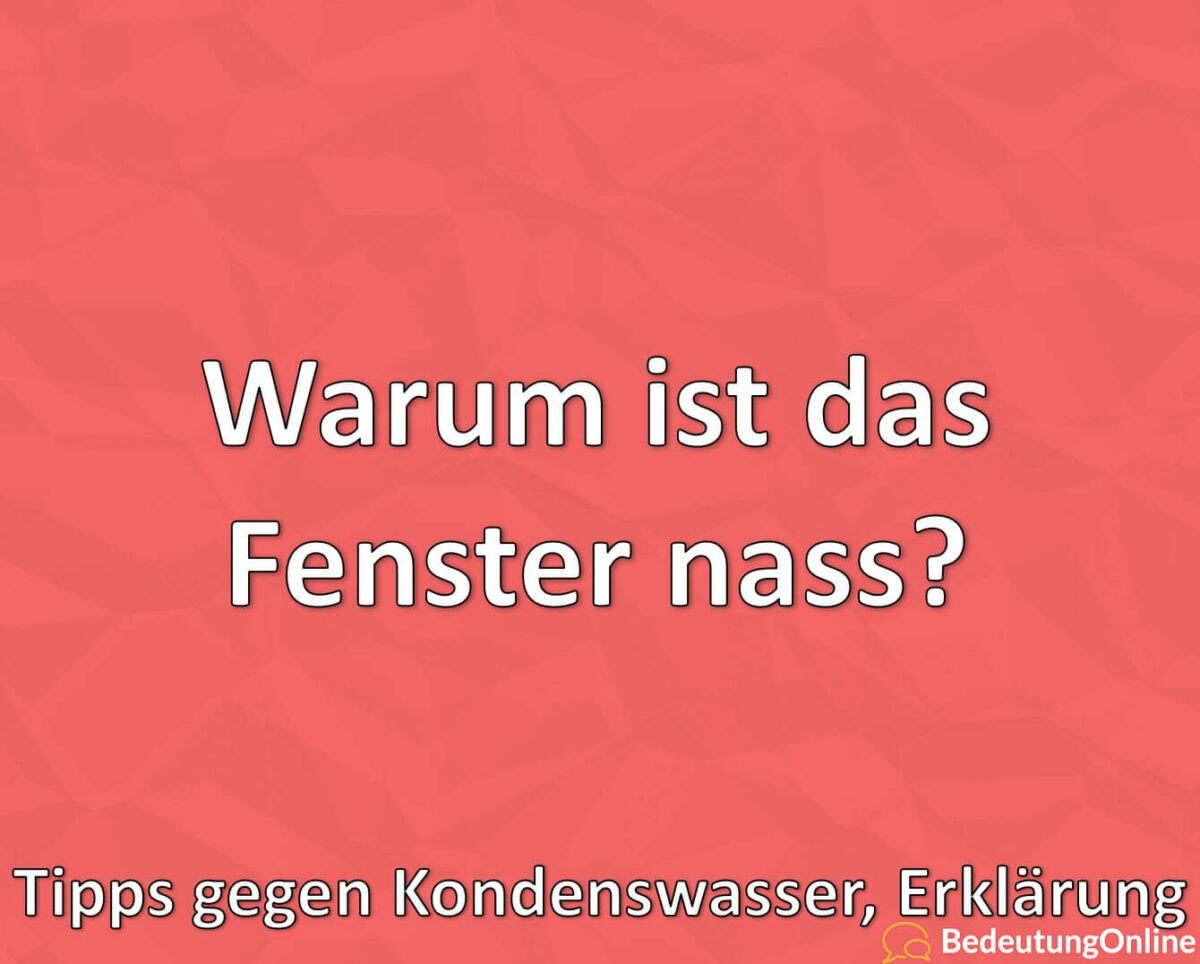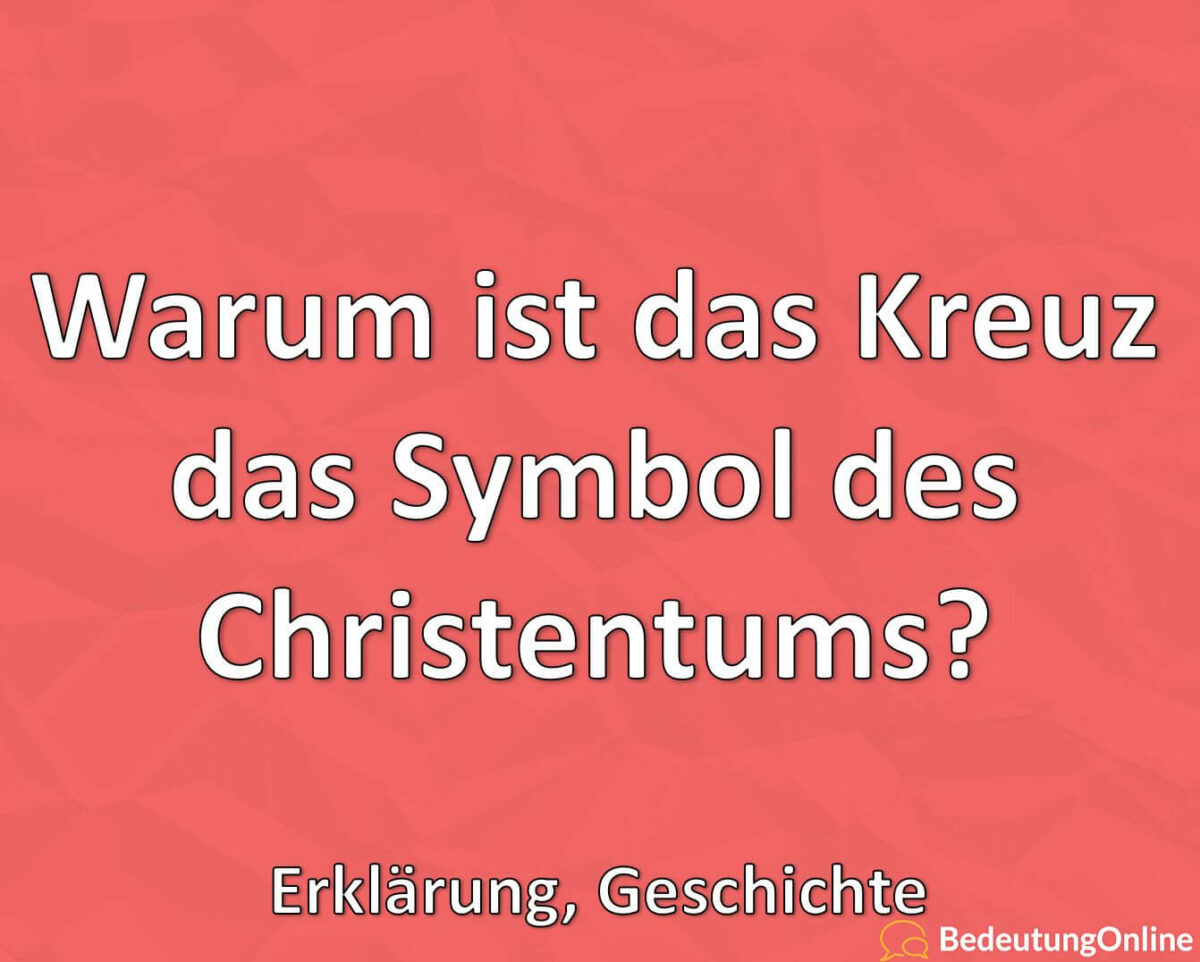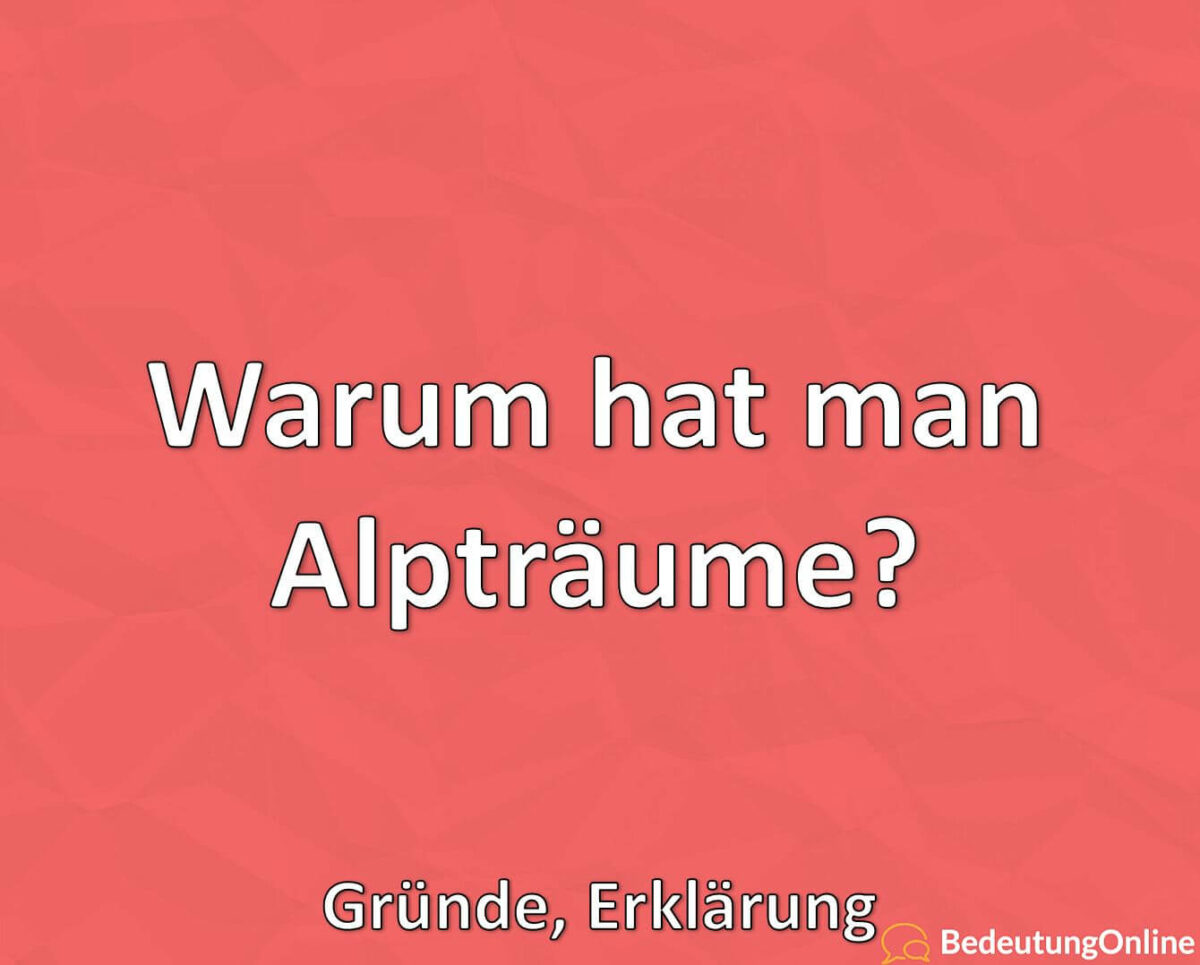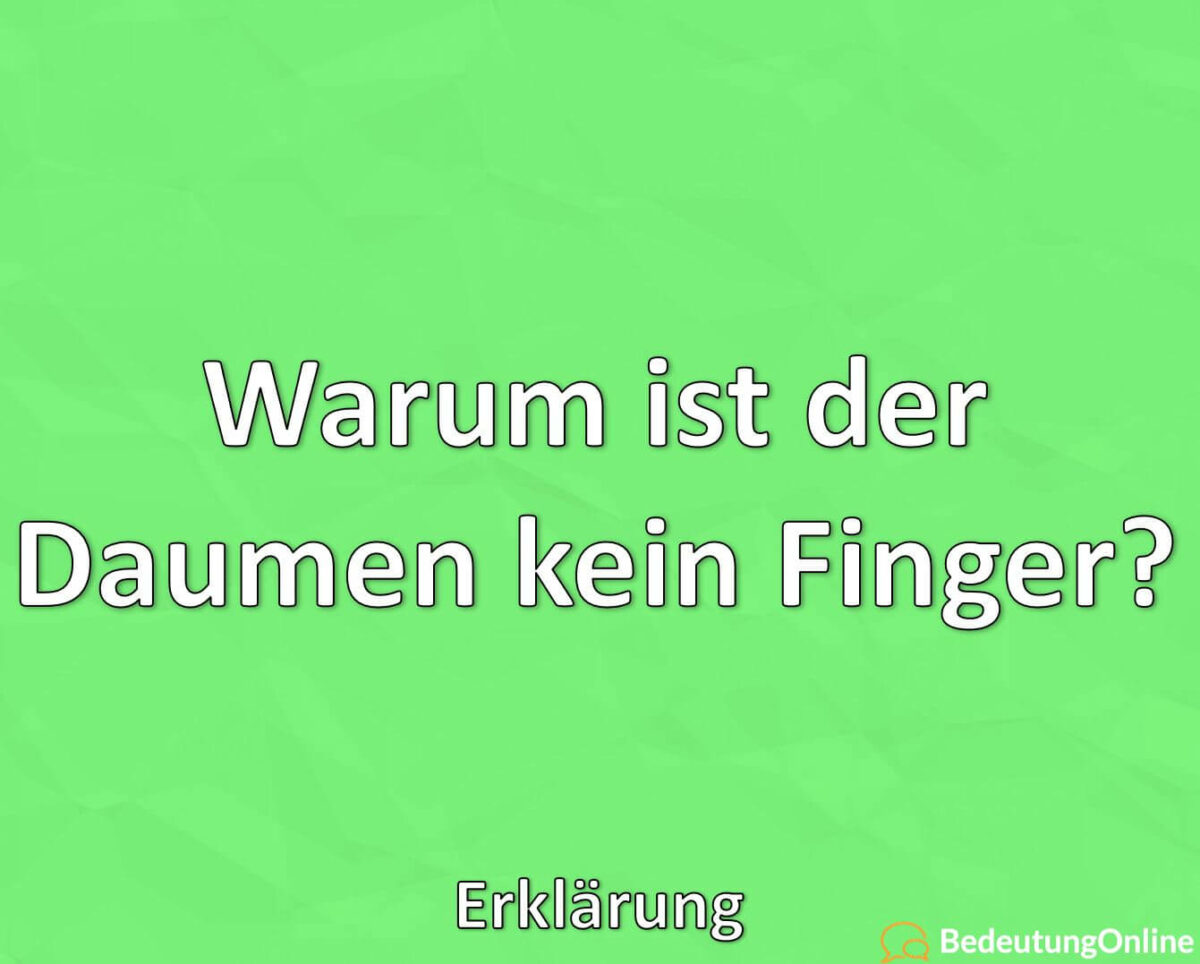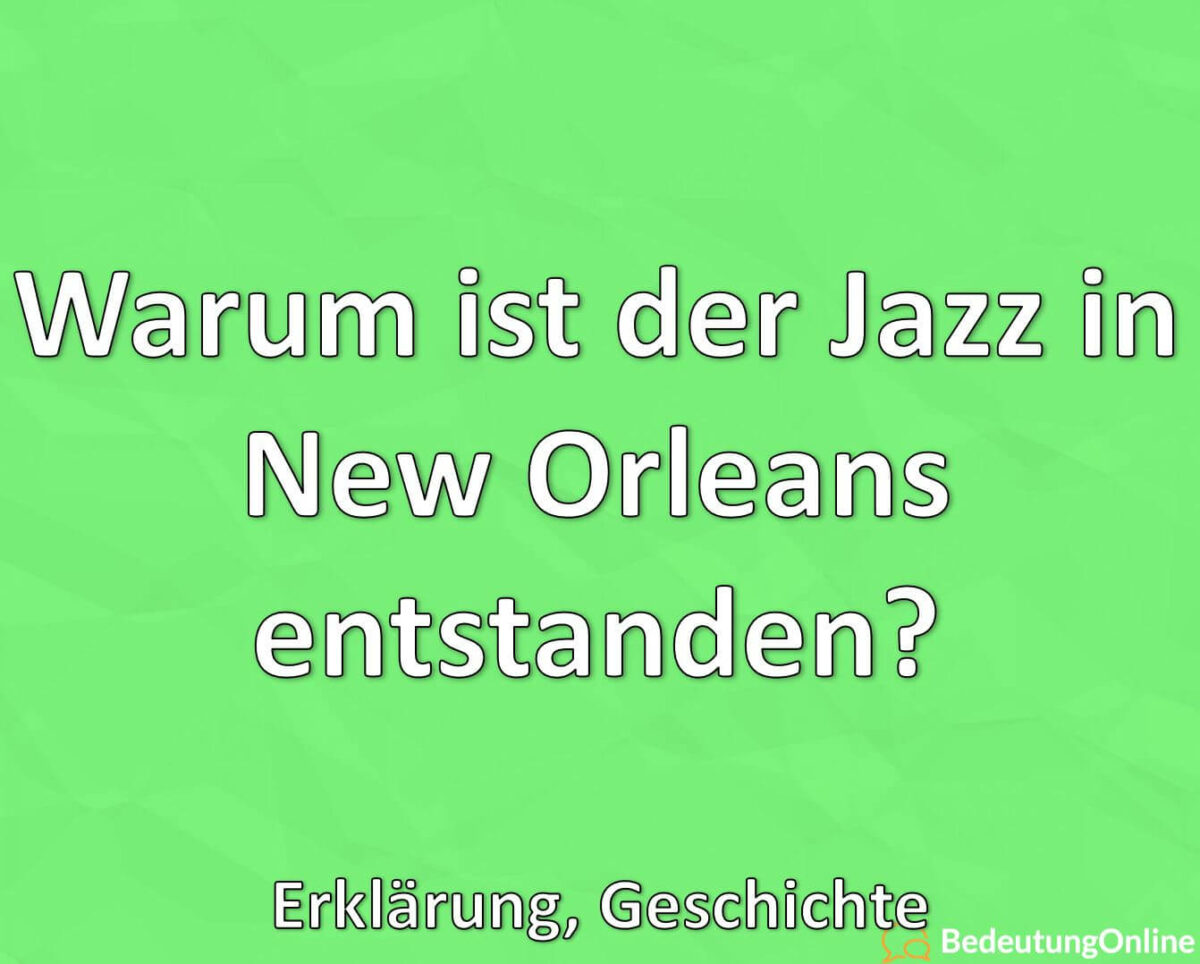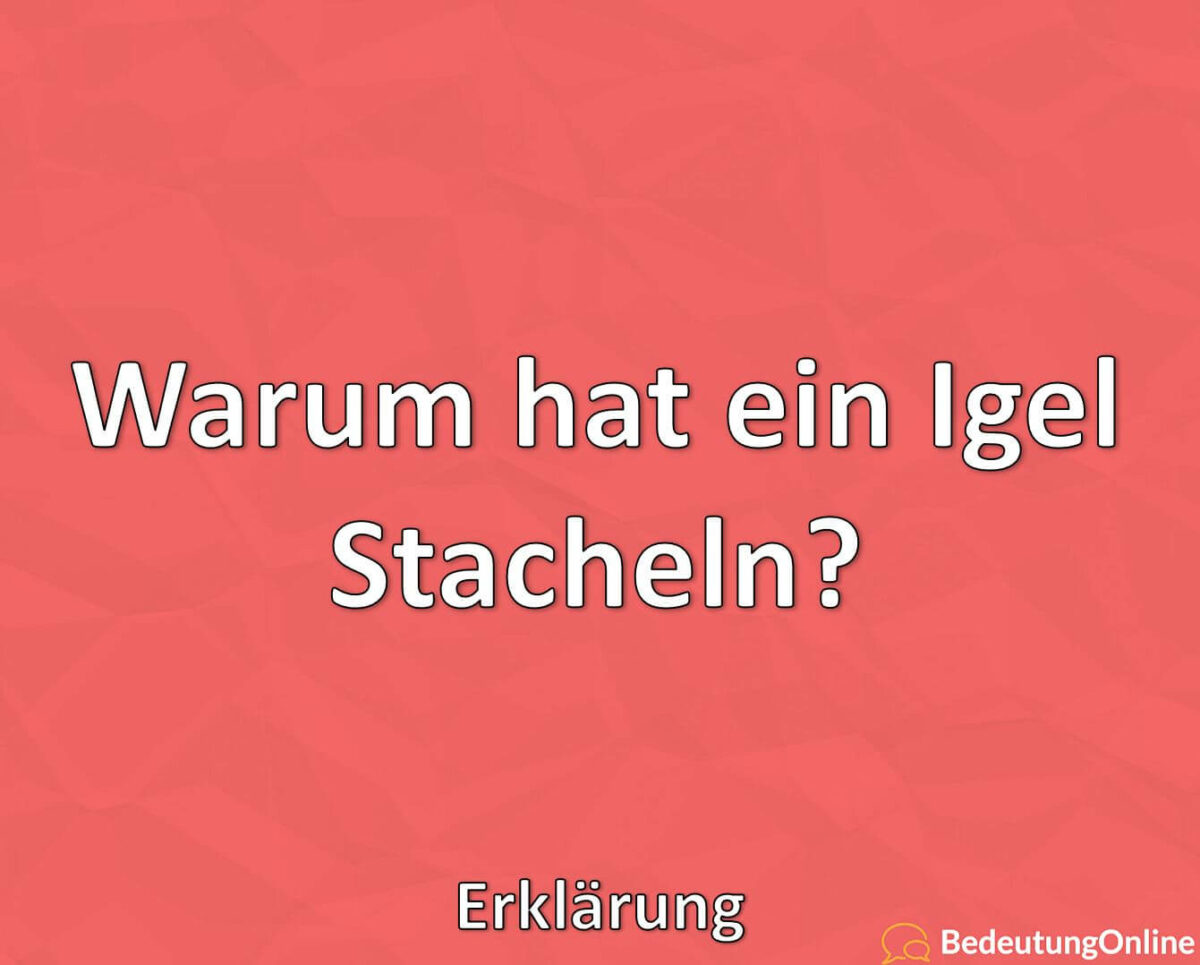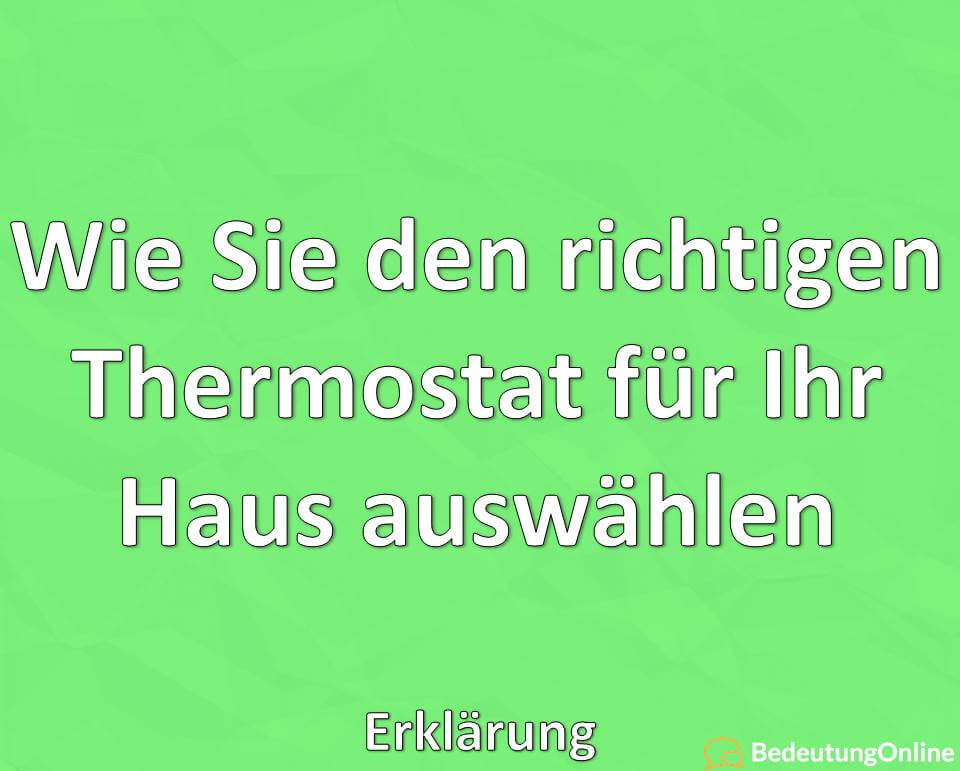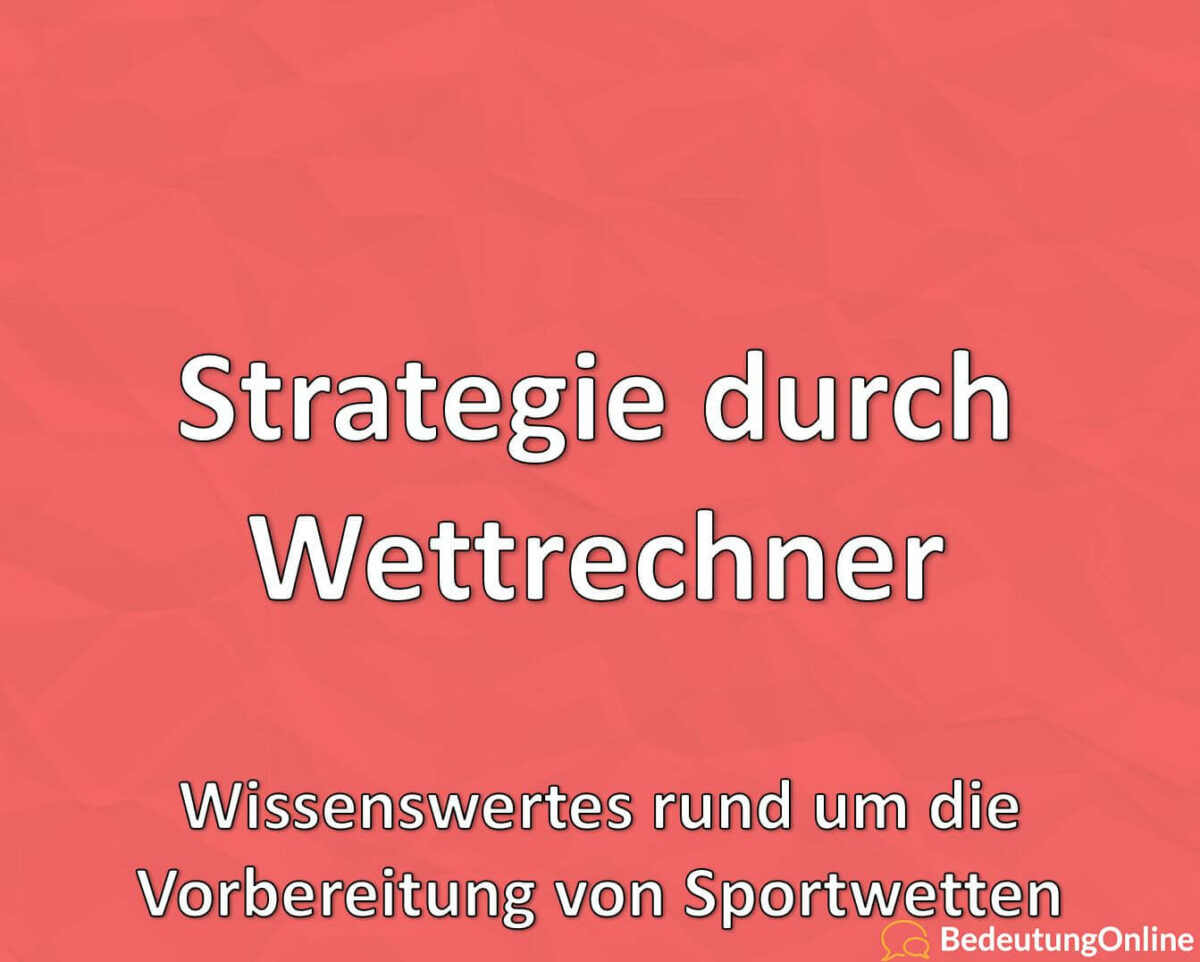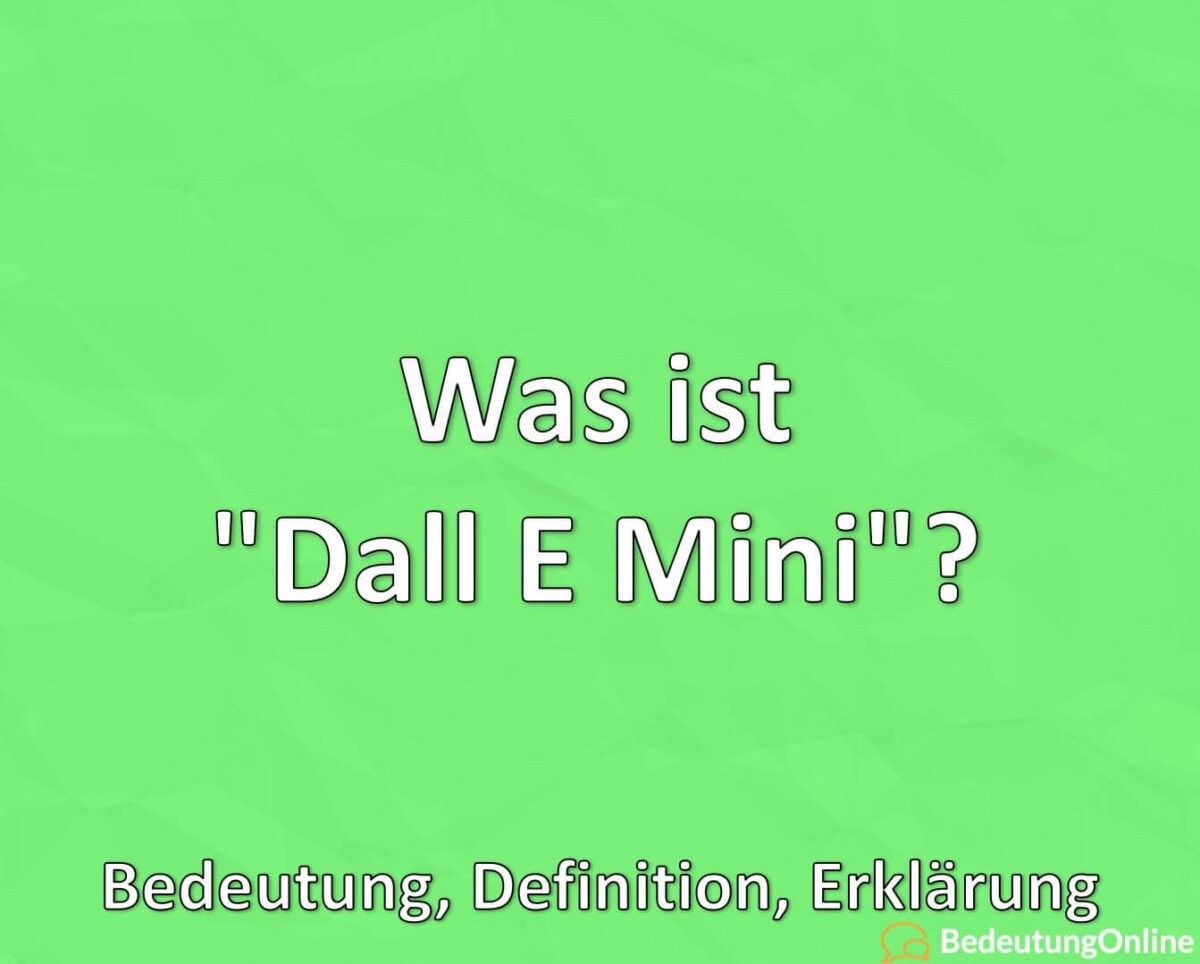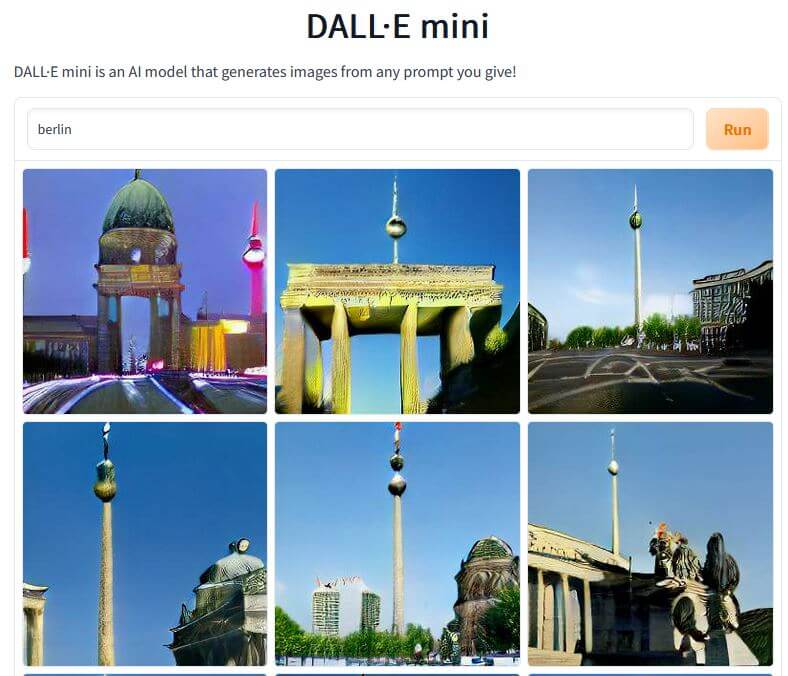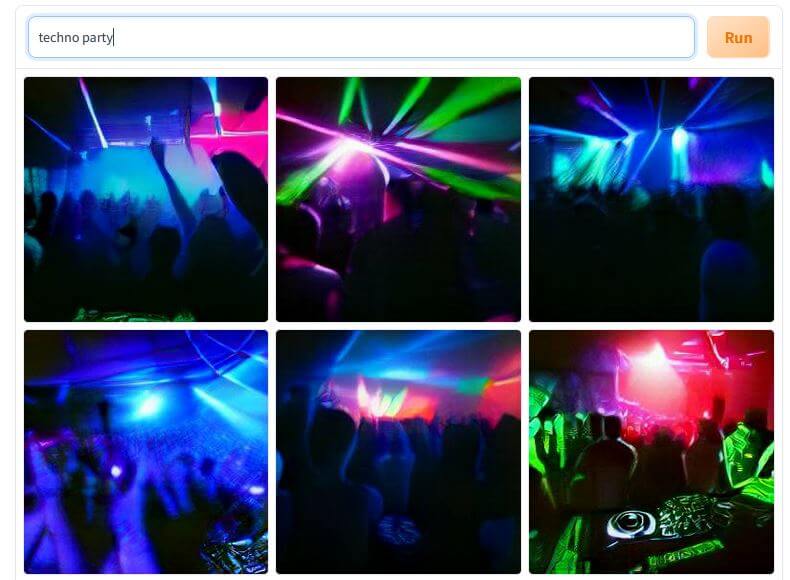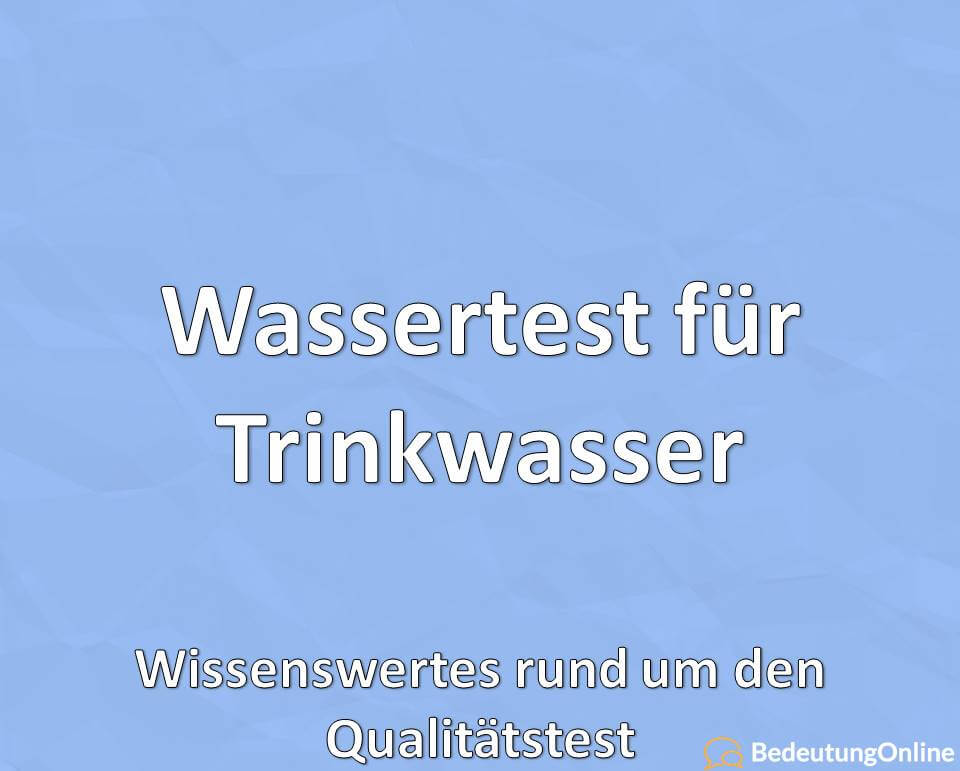Der Begriff „Mittelalter“ bezieht sich auf die Epoche zwischen der Antike und der Neuzeit, beginnend mit der Renaissance, in der europäischen Geschichte. Die Bezeichnung „Mittelalter“ selbst wurde aber erst wesentlich später geprägt. Denn grundsätzlich sah man diese Epoche als eine Art Zwischenperiode zwischen der Klassik, der Antike und der Renaissance an. Dabei wurde die Antike als das „goldene Zeitalter“ angesehen und die Renaissance als Wiedererweckung antiker Ideale.
Das „Mittelalter“ gilt als mystisch, dunkel und erbarmungslos. Heute wird das „Mittelalter“ daher als eine äußerst komplexe Epoche betrachtet, die viele unterschiedliche kulturelle, politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen umfasste, einschließlich der Feudalherrschaft, der Christianisierung Europas, der Kreuzzüge und der Blütezeit der mittelalterlichen Kunst und Literatur.
Der folgende Artikel soll sich daher einmal der Begriffsdefinition des Ausdrucks „Mittelalter“ widmen und diese Epoche umfassend und detailliert erklären. Weiterhin soll sich kritisch mit der Epoche des „Mittelalters“ auseinandergesetzt werden.
Begriffsdefinition „Mittelalter“
Der Name „Mittelalter“ stammt aus der deutschen Sprache und deutet darauf hin, dass diese Periode als eine Art Zwischenzeit zwischen verschiedenen Zeitepochen betrachtet wird. In anderen Sprachen wird das „Mittelalter“ unterschiedlich bezeichnet. Zum Beispiel wird es im Englischen als „Medieval“, im Französischen als „Moyen Âge“, im Spanischen als „Edad Media“ und im Italienischen als „Medioevo“ bezeichnet. Trotz der verschiedenen Namen bleibt der Begriff „Mittelalter“ im deutschen Sprachraum die einzig anerkannte Bezeichnung, um diese historische Periode zu beschreiben.
Nicht zu verwechseln ist das „Mittelalter“ als Zeitepoche mit einer Lebensphase, die das mittlere Alter eines Menschen meint. Der Begriff „Mittelalter“ ist überdies neutral, bis leicht negativ konnotiert, da dieser auf eine düstere und stellenweise brutale Epoche verweist, aber stellenweise auch romantisiert wird.
Wer prägte den Ausdruck „Mittelalter“?
Der Ausdruck „Mittelalter“ wurde erst im 15. Jahrhundert von Renaissance-Gelehrten geprägt. Einer der ersten bekannten Verwender war der italienische Humanist und Geschichtsschreiber Leonardo Bruni (der von 1370 bis 1444 lebte). Er benutzte den Ausdruck „medium aevum“ (zu Deutsch: „Mittelalter“) in seinen Schriften, um die Periode zwischen der Antike und seiner eigenen Zeit zu beschreiben. Die Verwendung des Begriffs wurde auch von anderen Renaissance-Gelehrten, wie beispielsweise Petrarch (der von 1304 bis 1374 lebte) sowie von Lorenzo Valla (der wiederum von 1407 bis 1457 lebte) populär gemacht. Gelehrte betrachteten das „Mittelalter“ oft als eine dunkle Zeit im Vergleich zur glänzenden Kultur der Antike und der beginnenden Renaissance, was den Begriff als Beschreibung dieser Epoche festigte.
Historie des „Mittelalters“
Das „Mittelalter“ begann in Europa nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches im 5. Jahrhundert. Einige wichtige Orte, an denen das Mittelalter begann, waren vor allem die Gebiete des ehemaligen Weströmischen Reiches, insbesondere in Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und dem heutigen Großbritannien. In diesen Regionen entstanden nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches neue politische, wirtschaftliche und soziale Strukturen, die charakteristisch für das „Mittelalter“ waren. Die Hochzeit des Mittelalters brachte Städte, wie beispielsweise Rom, Konstantinopel, Paris, London, Florenz und andere große Zentren hervor, wo Kunst, Kultur und Handel florieren konnten. Das „Mittelalter“ endete ungefähr im 15. Jahrhundert.
Merkmale des „Mittelalters“
Das „Mittelalter“ gilt als eine der bekanntesten Epochen der Weltgeschichte und wird entsprechend häufig als Motiv in Film und Fernsehen eingesetzt. Bedeutende Errungenschaften sowie Merkmale des „Mittelalters“ sind zum Beispiel die Folgenden:
- Feudalismus (ein hierarchisches System der Lehnsherrschaft, das politische und wirtschaftliche Beziehungen regelte)
- Rittertum (adlige Krieger, die oft in Rüstung und auf Pferden kämpften und eine zentrale Rolle in der mittelalterlichen Gesellschaft spielten)
- Burgen und Festungen (Verteidigungsbauten, die von Adligen als Wohnstätten und zur Sicherung ihres Landes errichtet wurden)
- Kirche und Religion (die dominante Rolle der katholischen Kirche im Alltagsleben und in der Politik, einschließlich der Macht der Geistlichkeit)
- Kathedralen und Klöster (monumentale religiöse Gebäude, die das Zentrum des spirituellen Lebens waren und oft beeindruckende architektonische Meisterwerke darstellten)
- Handwerk und Handel (die Entwicklung von Gilden und Handelsrouten förderte die wirtschaftliche Entwicklung)
- technologische Innovationen (trotz des verbreiteten Mythos eines dunklen Zeitalters gab es bedeutende Fortschritte in Bereichen wie Landwirtschaft, Architektur und Medizin)
Trotz seiner recht düsteren Retrospektive kann das „Mittelalter“ insgesamt als eine Epoche großen Umschwungs betrachtet werden, in der viele Neuerungen stattfanden und sich allmählich staatsähnliche Bünde (vor allem in Europa) formierten.
Welche düsteren Ereignisse geschahen im „Mittelalter“?
Die Epoche des „Mittelalters“ war geprägt von düsteren Ereignissen und Zuständen. Dazu gehörten Epidemien, wie beispielsweise die Pest, die im 14. Jahrhundert Abermillionen von Menschenleben forderte und ganze Regionen entvölkerte. Außerdem waren das „Mittelalter“ und insbesondere das „Hochmittelalter“ von gewaltsamen Konflikten, wie beispielsweise den Kreuzzügen und zahlreichen Kriegen gekennzeichnet, die zu massiven Zerstörungen und Verlusten führten. Die Inquisition, eine Institution zur Bekämpfung von Häresie und Ketzerei, führte zu Folterungen und Hinrichtungen von Andersdenkenden. Auch Hexenverfolgungen, Aberglaube und soziale Ungerechtigkeiten waren charakteristisch für diese Zeit. Trotz der kulturellen und technologischen Fortschritte gab es also viele düstere Aspekte, die das Leben im Mittelalter prägten.
Kritiken am „Mittelalter“
Kritiker des „Mittelalters“ argumentieren vor allem, dass der Begriff „Mittelalter“ eine voreingenommene Sichtweise auf diese Epoche widerspiegelt, die als dunkle Periode zwischen der Antike und der Renaissance betrachtet wird. Kritiker weisen darauf hin, dass die Bezeichnung eine Vereinfachung einer äußerst vielfältigen Zeit darstellt und komplexe kulturelle und intellektuelle Entwicklungen unterschätzt. Zudem wird oft darauf hingewiesen, dass der Begriff „Mittelalter“ in erster Linie von Renaissance-Humanisten geprägt wurde, deren Ansichten stark von antiken Idealen beeinflusst waren. In der modernen Geschichtsschreibung wird daher vermehrt dazu aufgerufen, das Mittelalter differenzierter und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, um ein umfassenderes Verständnis dieser Epoche zu erlangen.
Fazit zum Thema „Mittelalter“ und weitere Epochen
Insgesamt stellt das „Mittelalter“ eine Zeitepoche in Europa, zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert nach Christi Geburt dar. Sie brachte vor allem gesellschaftliche Neuerungen hervor, gilt aber bis heute als eine der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, die in den Augen von Kritikern häufig zu Unrecht romantisiert wird.
Neben dem „Mittelalter“ existieren beispielsweise noch die Epochen „Renaissance“ sowie „Aufklärung“. Die „Renaissance“ war das Zeitalter der Wiedergeburt von Kunst, Wissenschaft und Humanismus im 14. bis 17. Jahrhundert in Europa, gekennzeichnet durch eine Wiederbelebung des Interesses an antiker Kultur und dem Streben nach menschlicher Perfektion. Die „Aufklärung“ war wiederum eine geistige Bewegung des 17. und 18. Jahrhunderts, die die Vernunft, Wissenschaft und Individualität betonte und zu politischen, sozialen und intellektuellen Reformen führte.