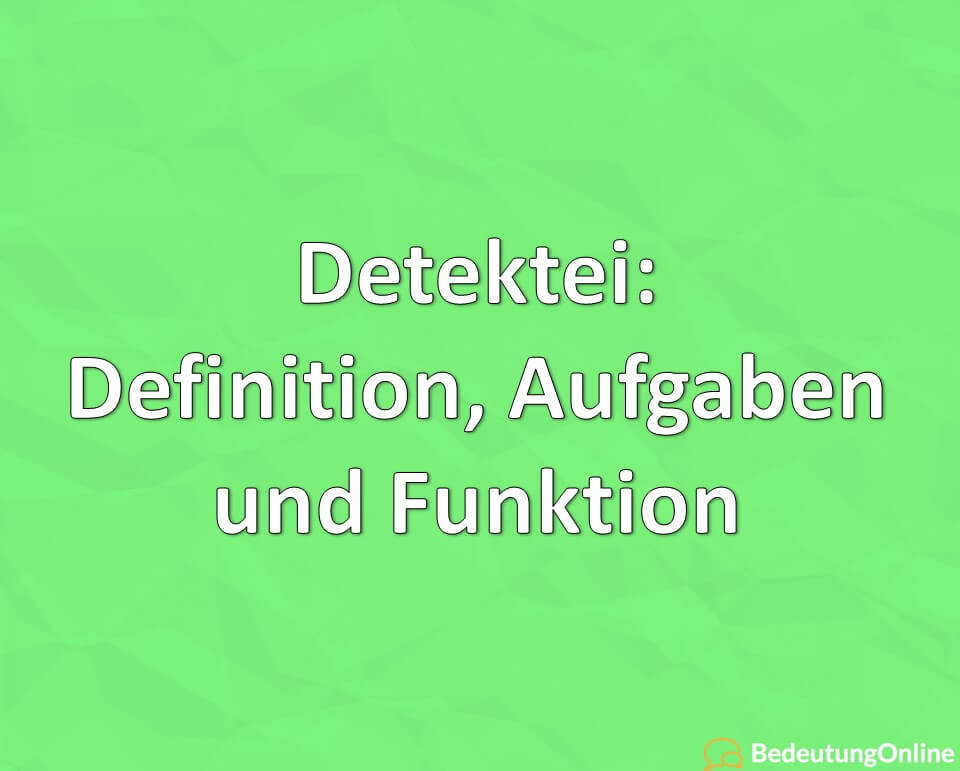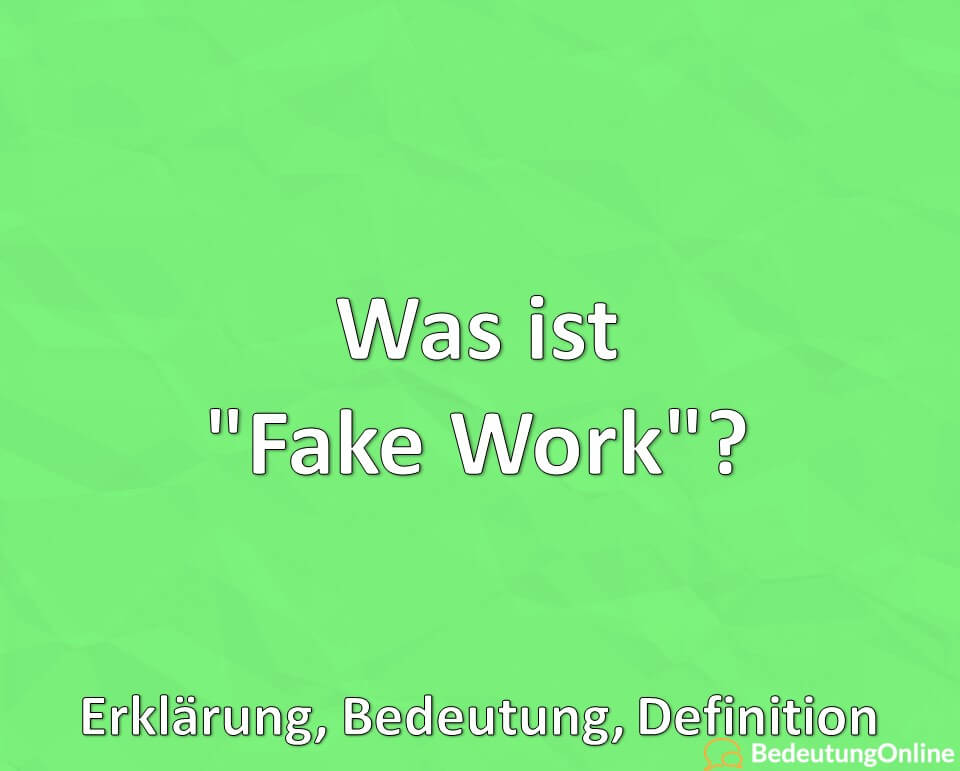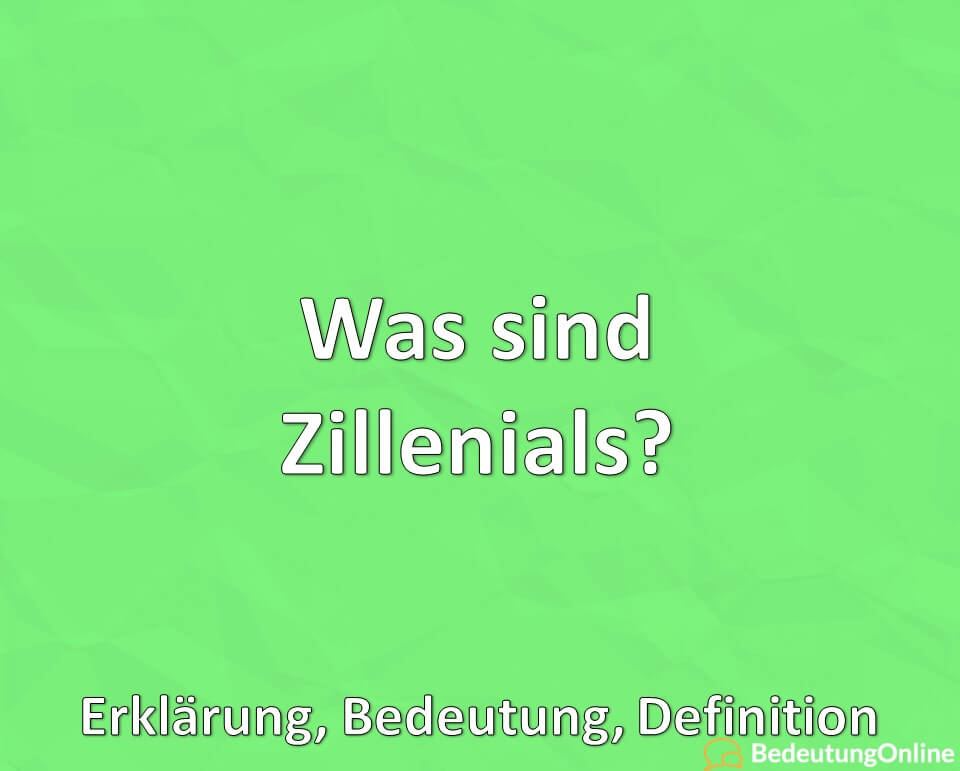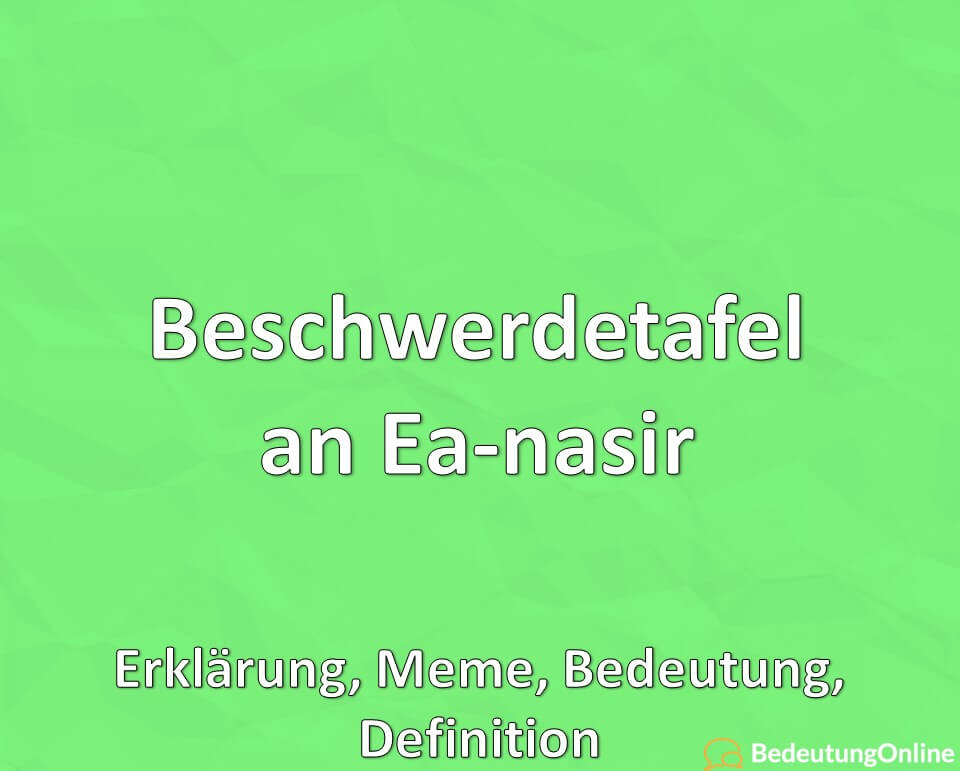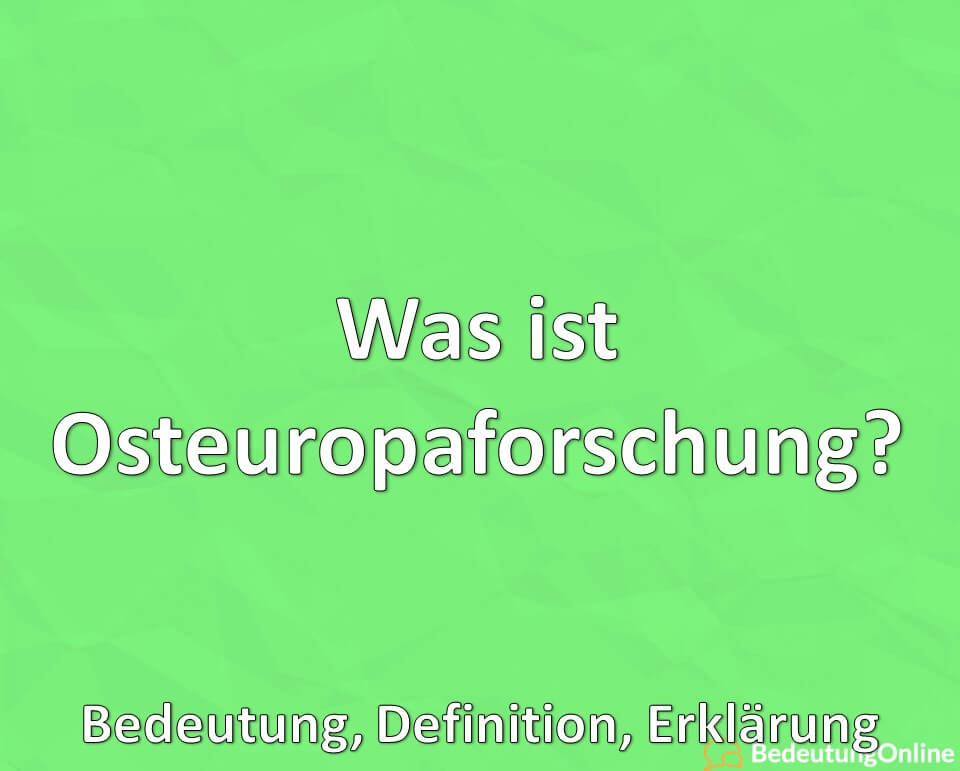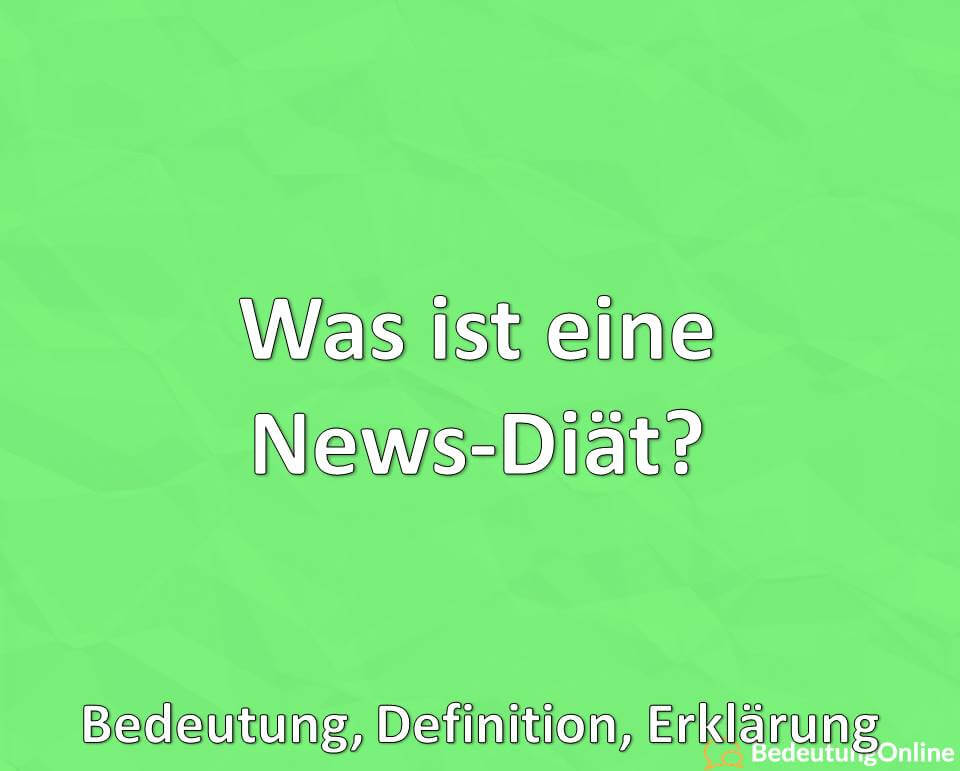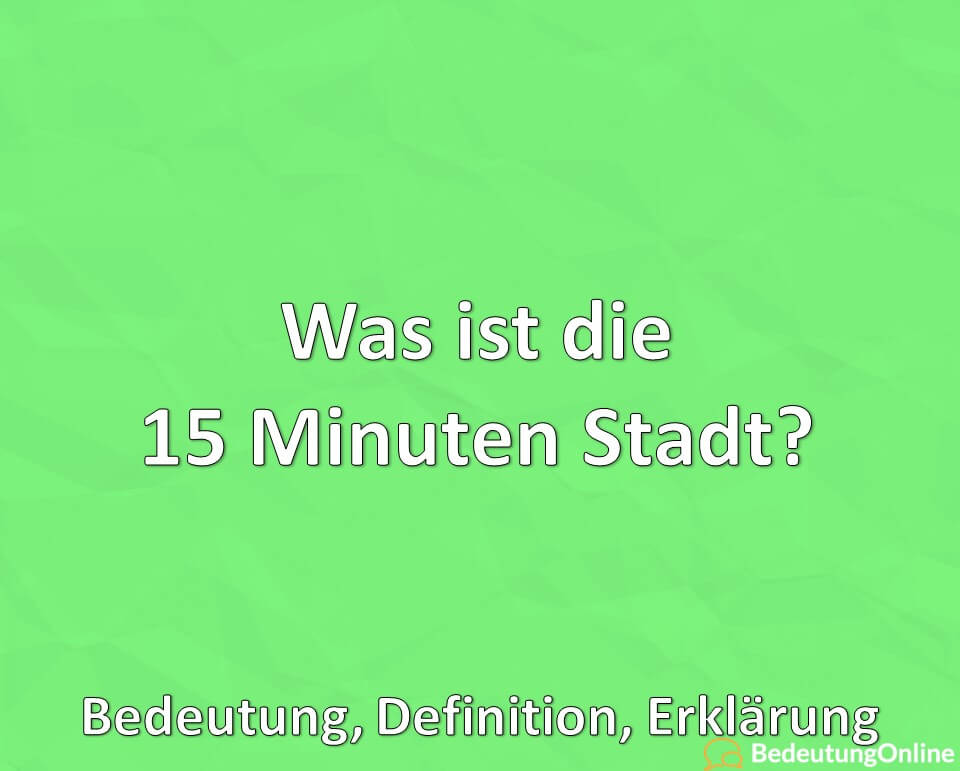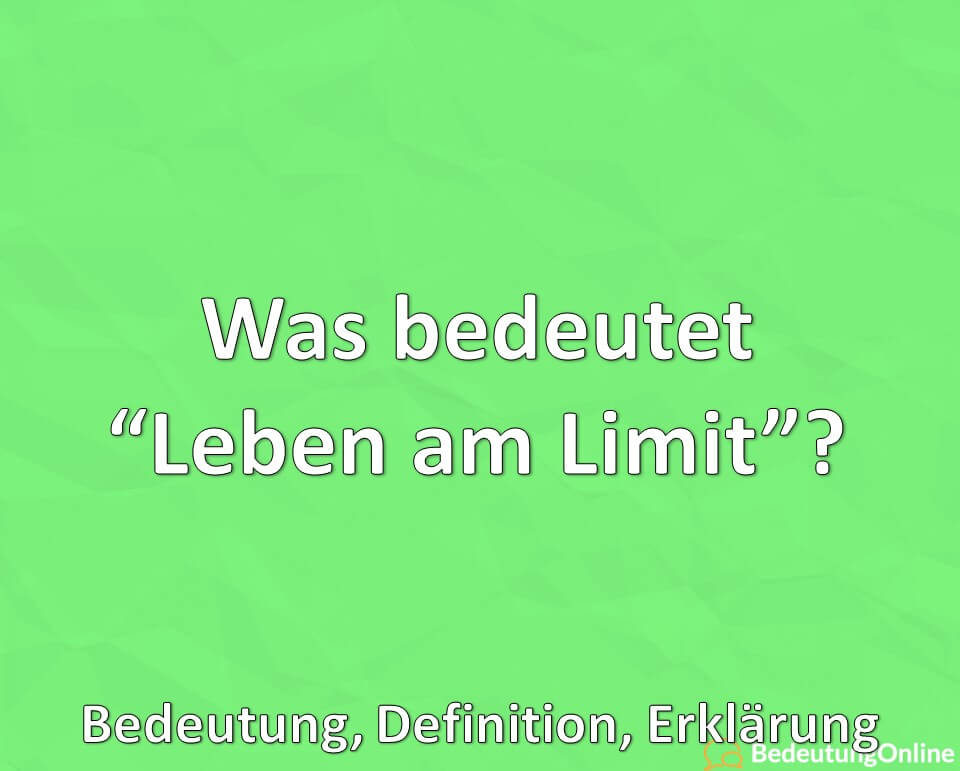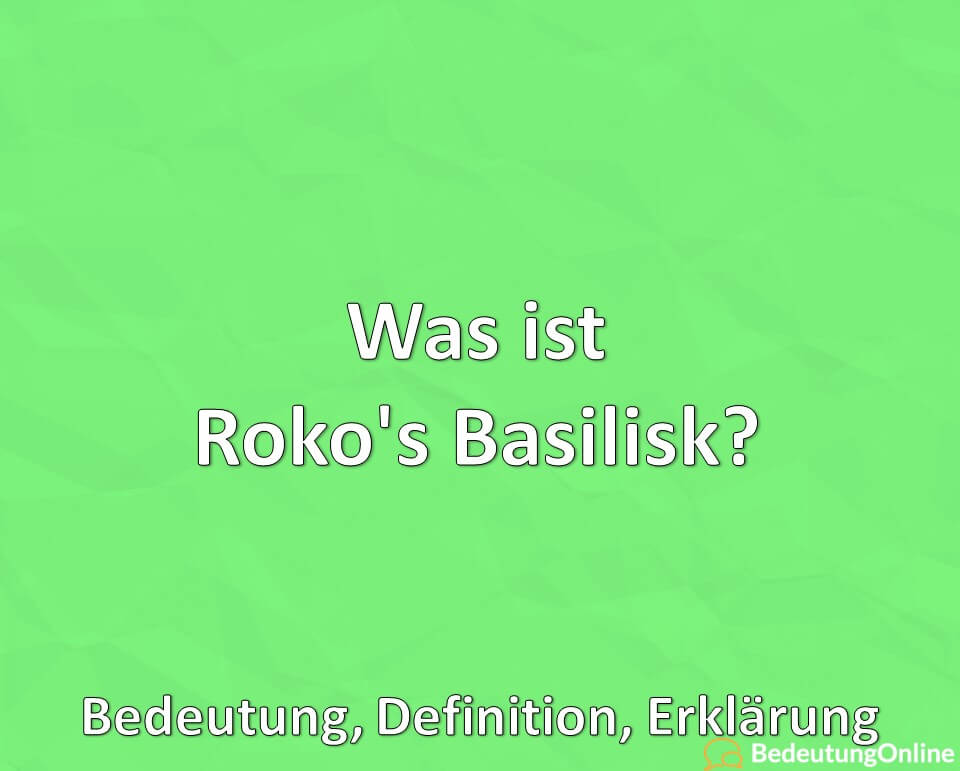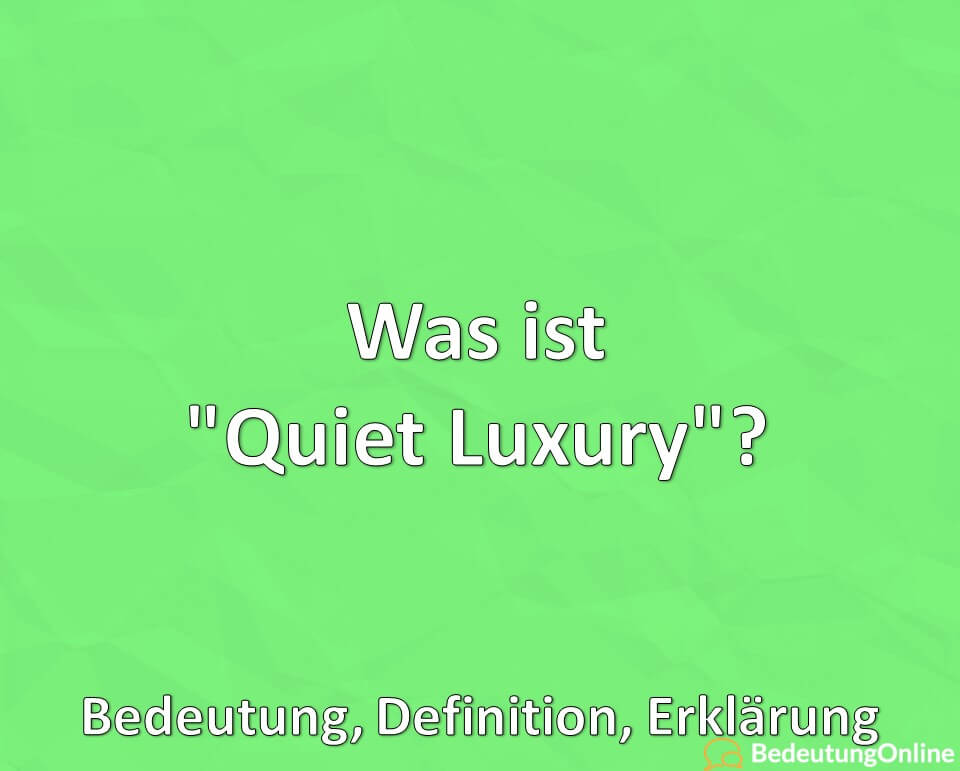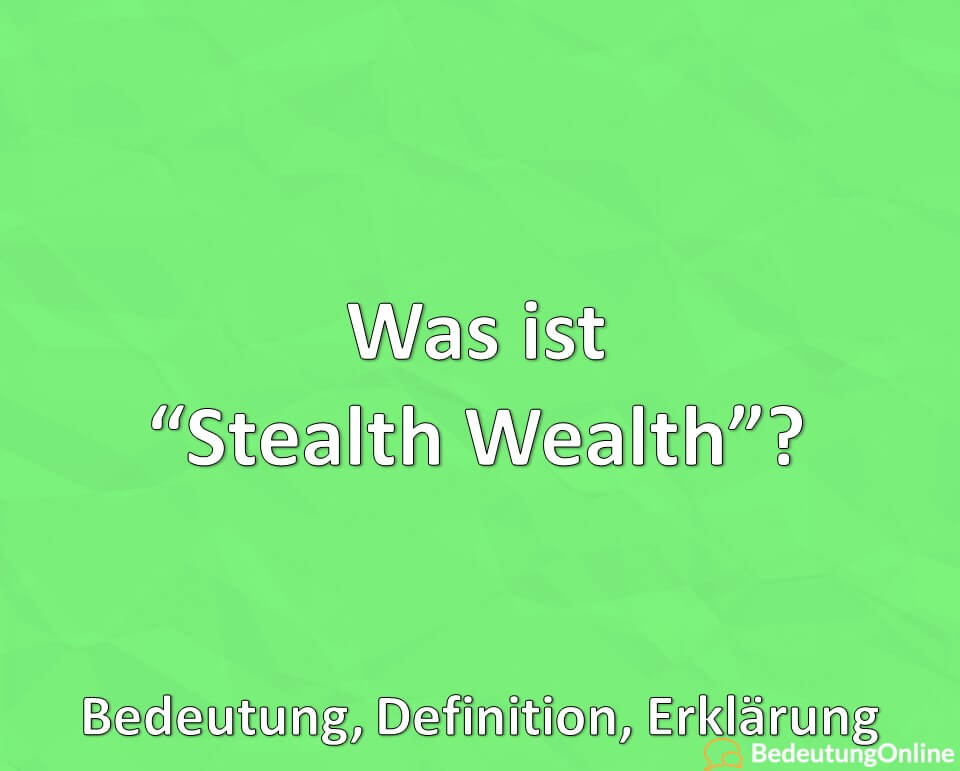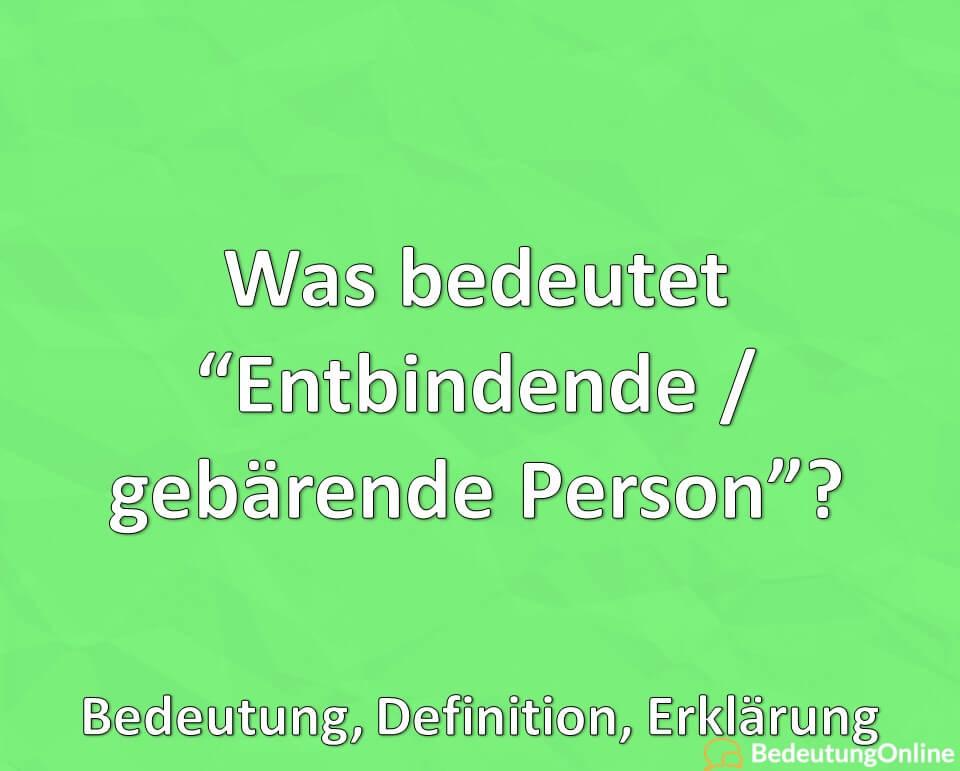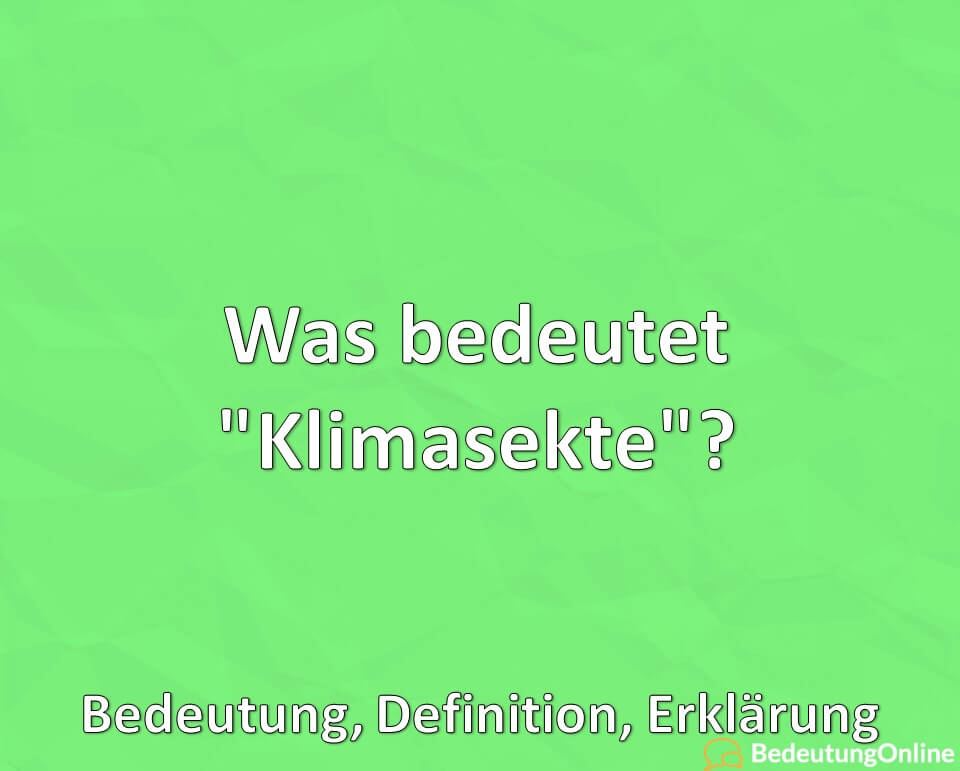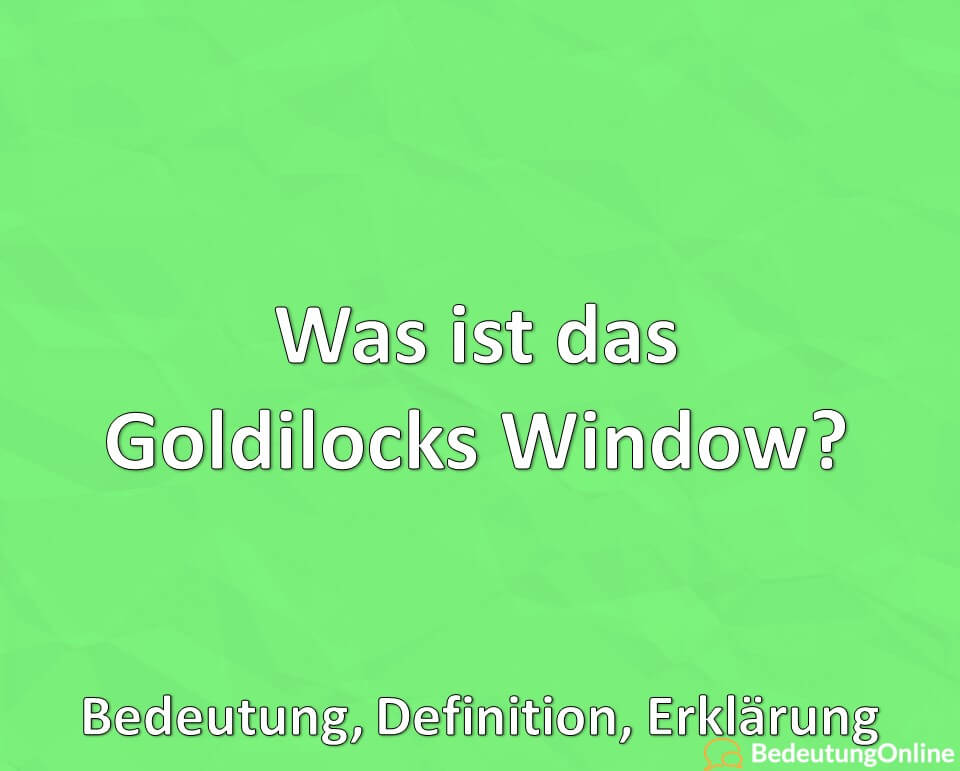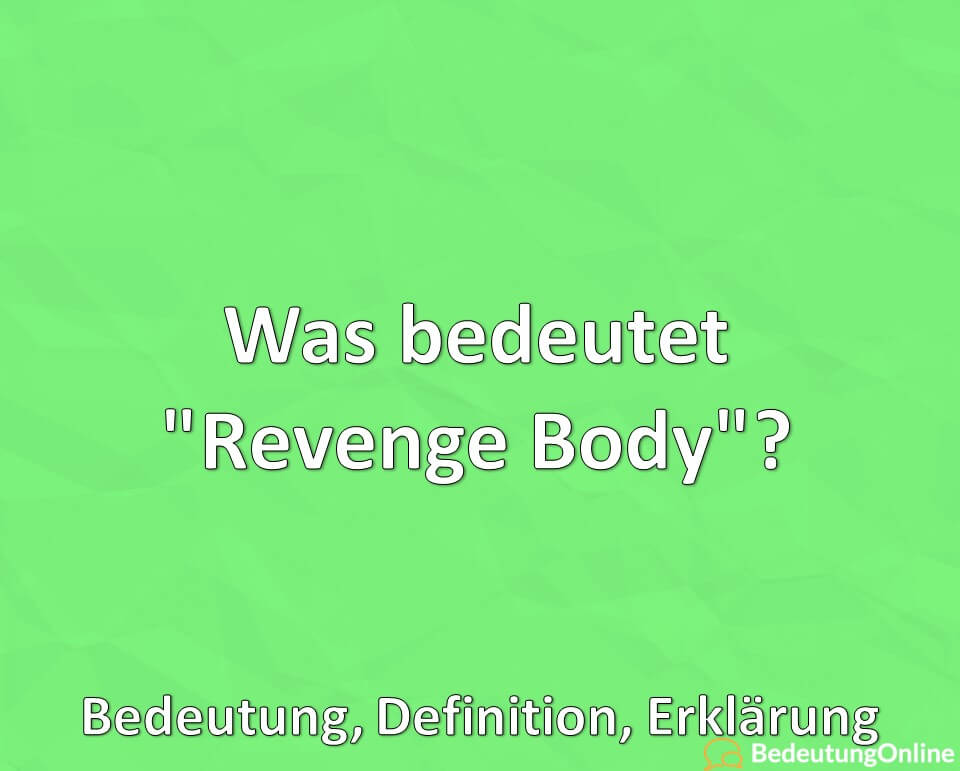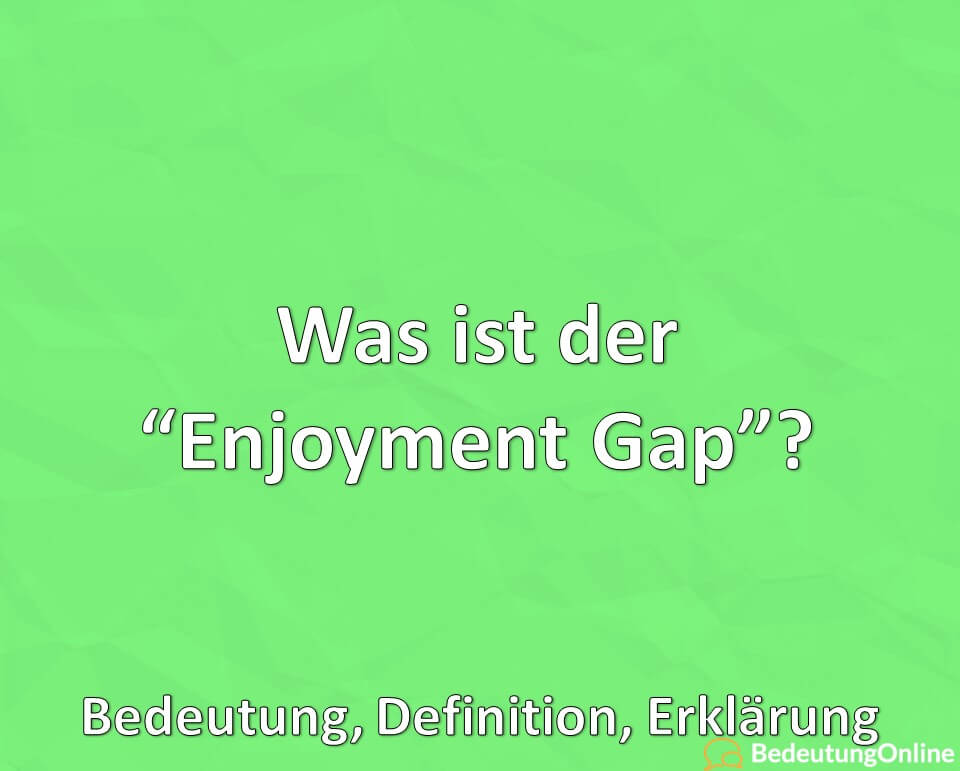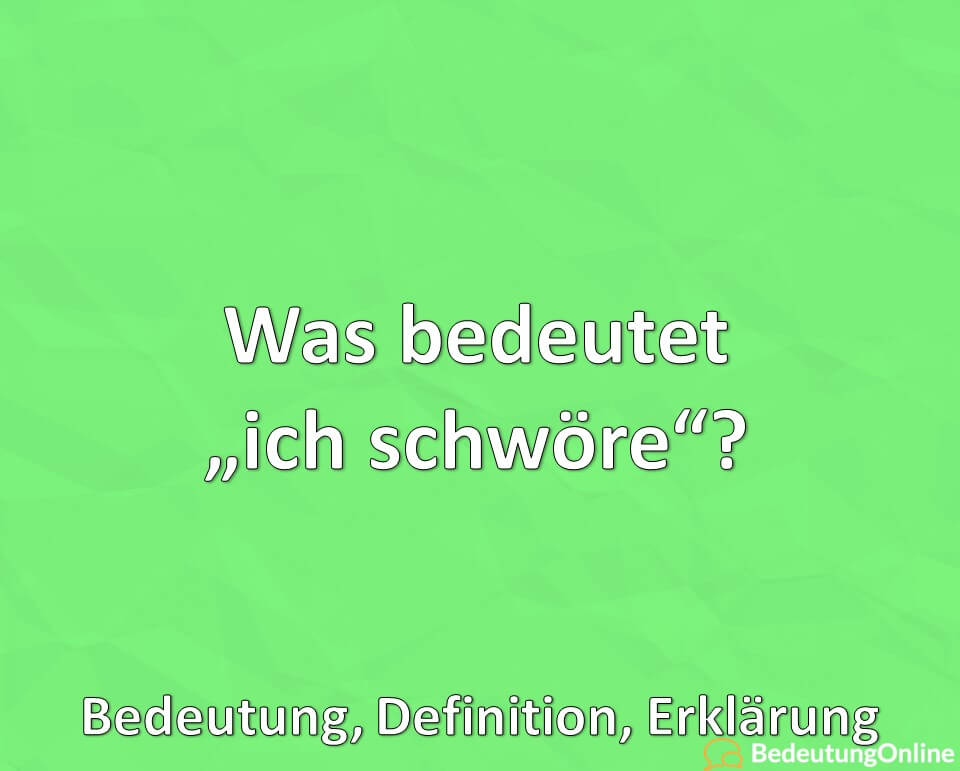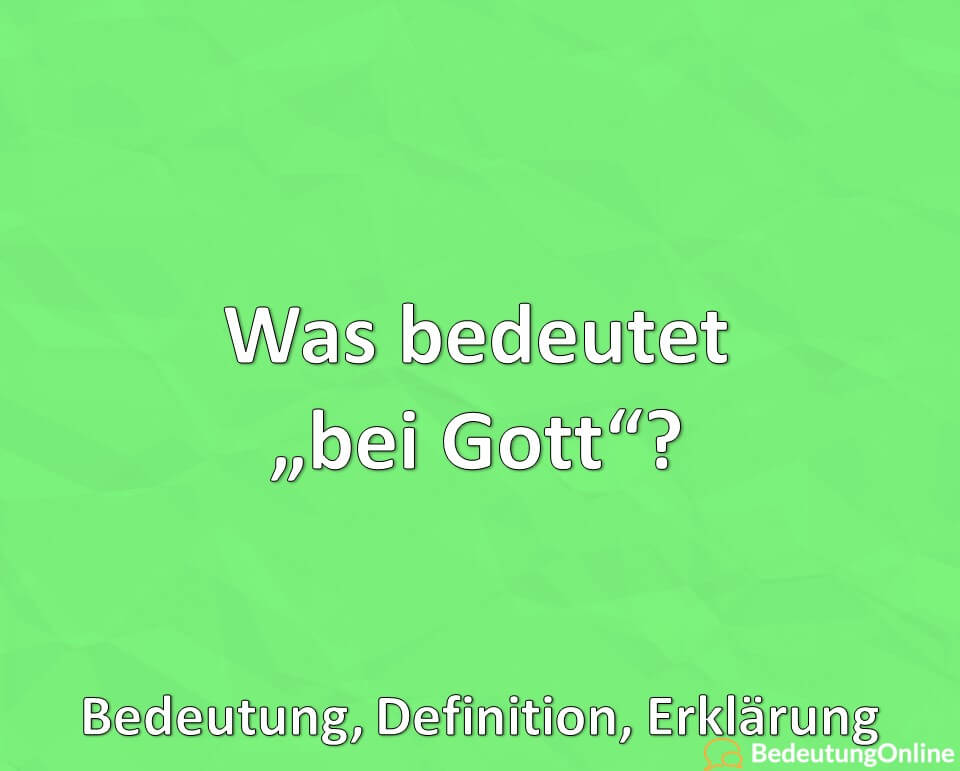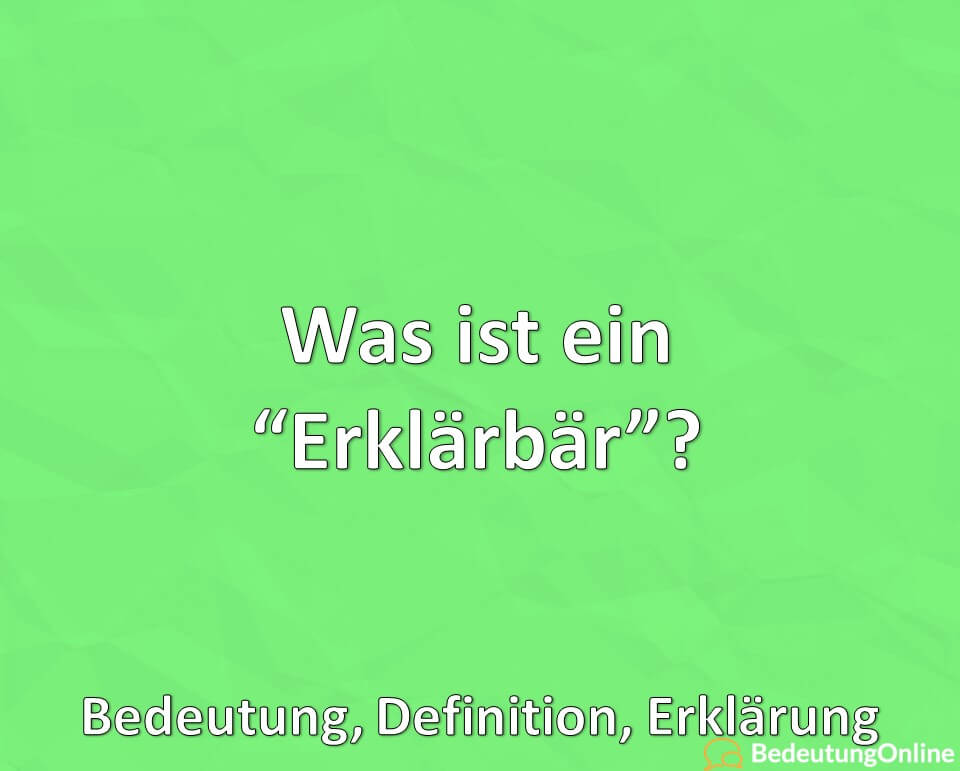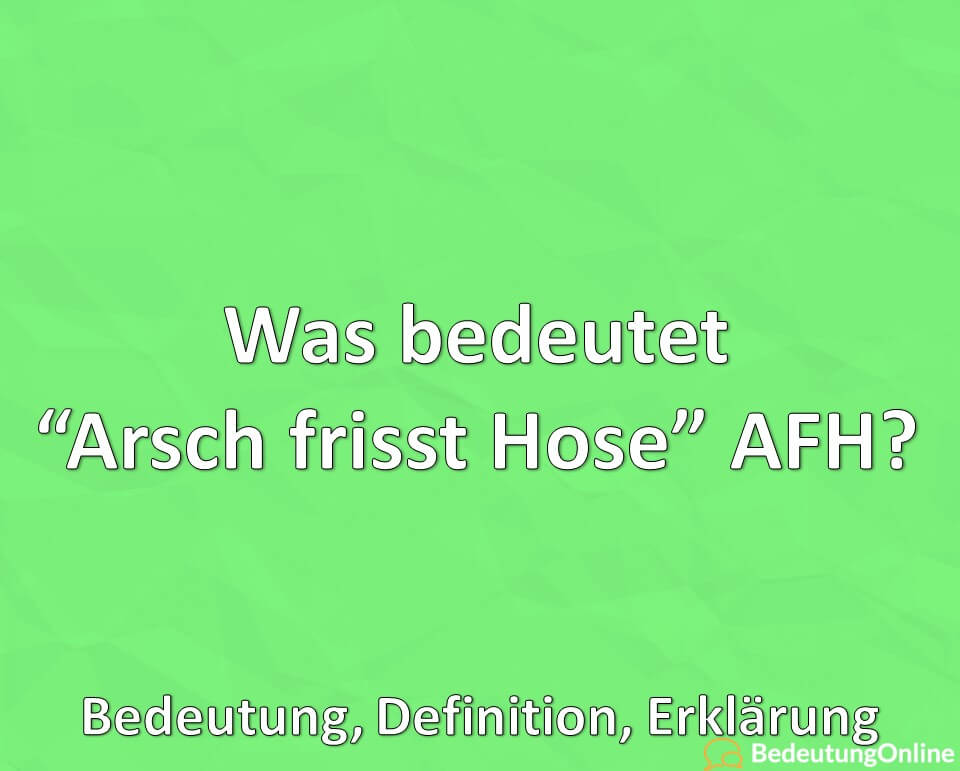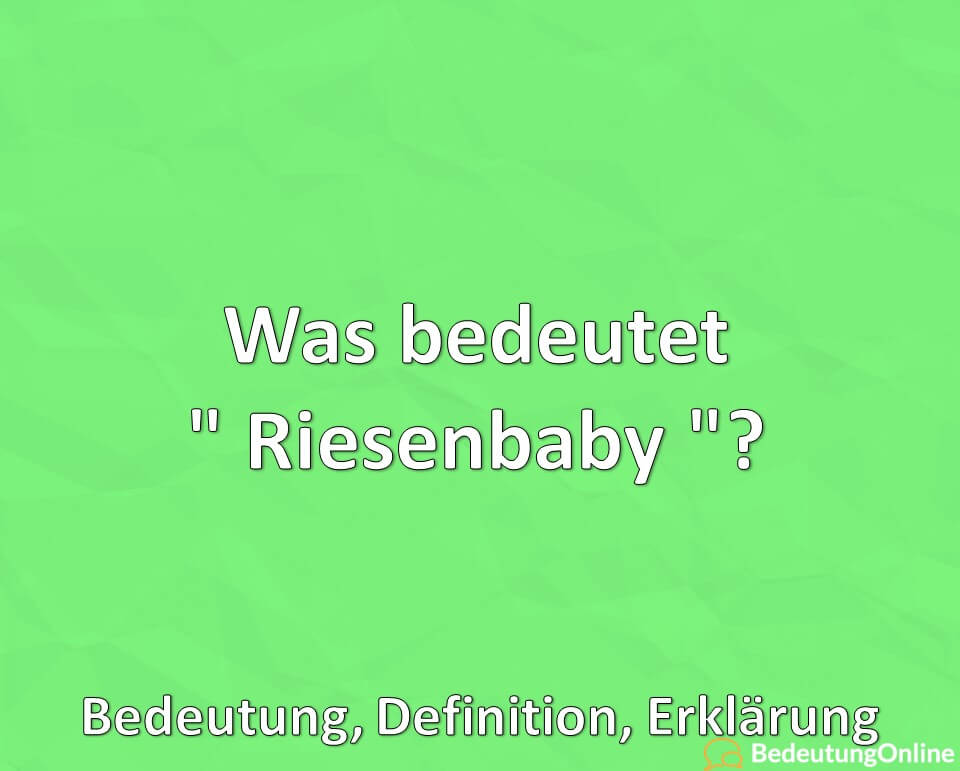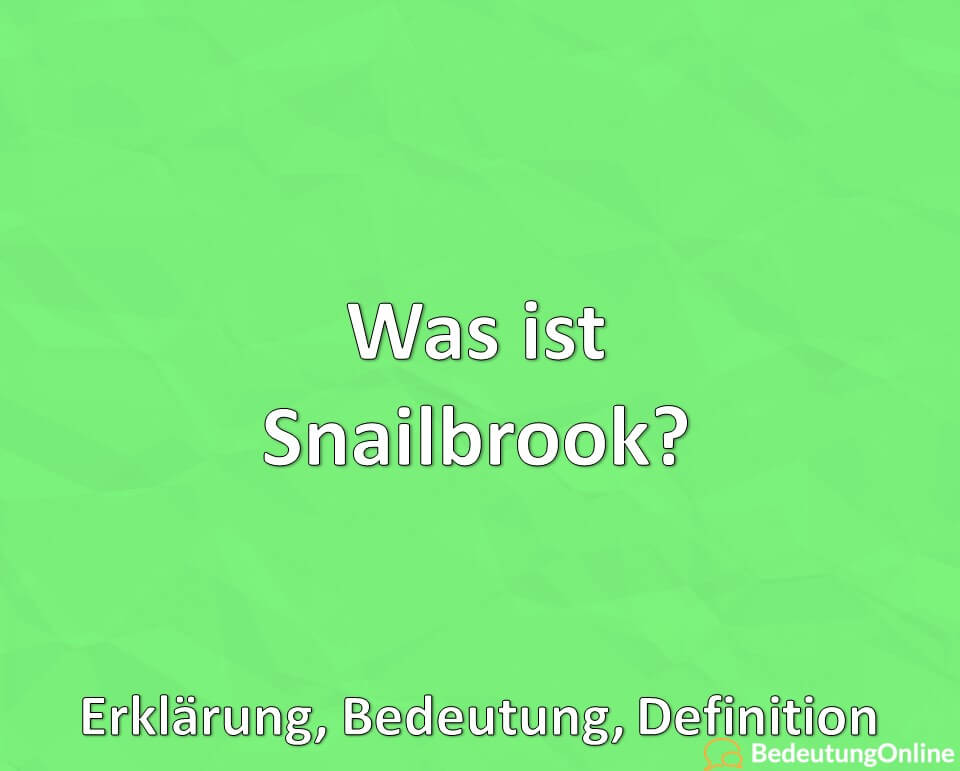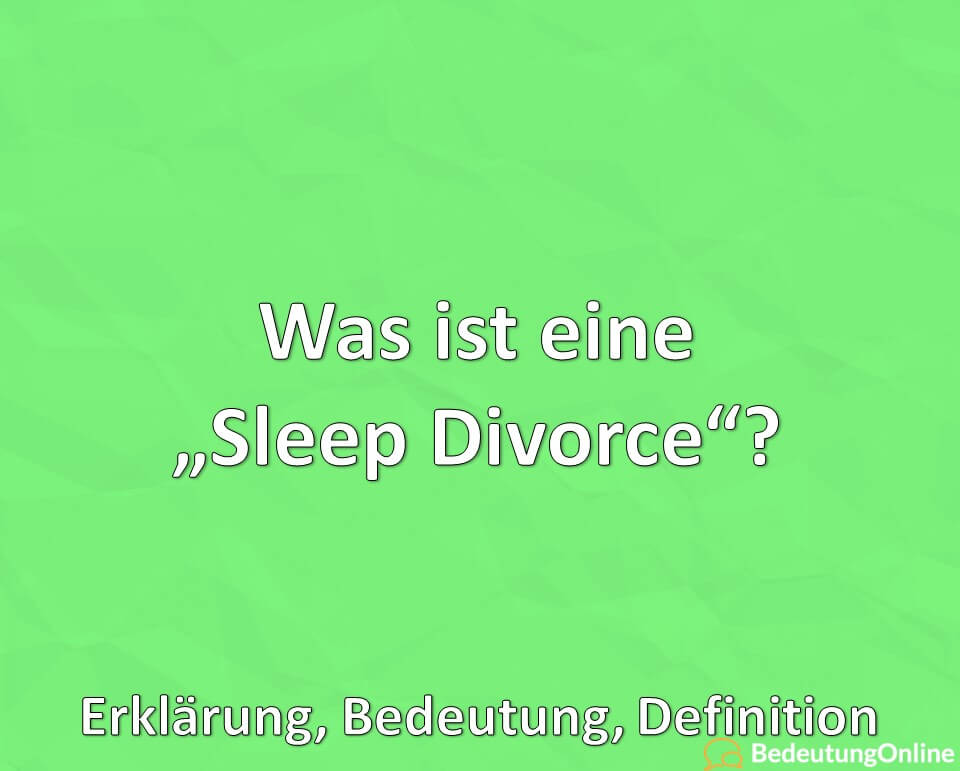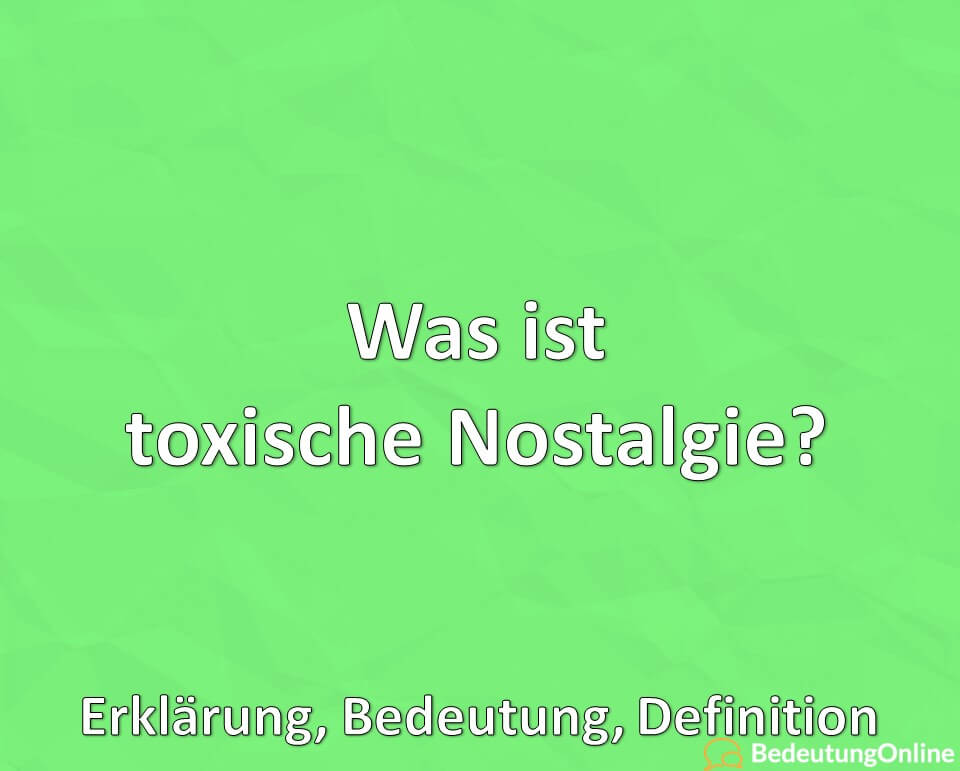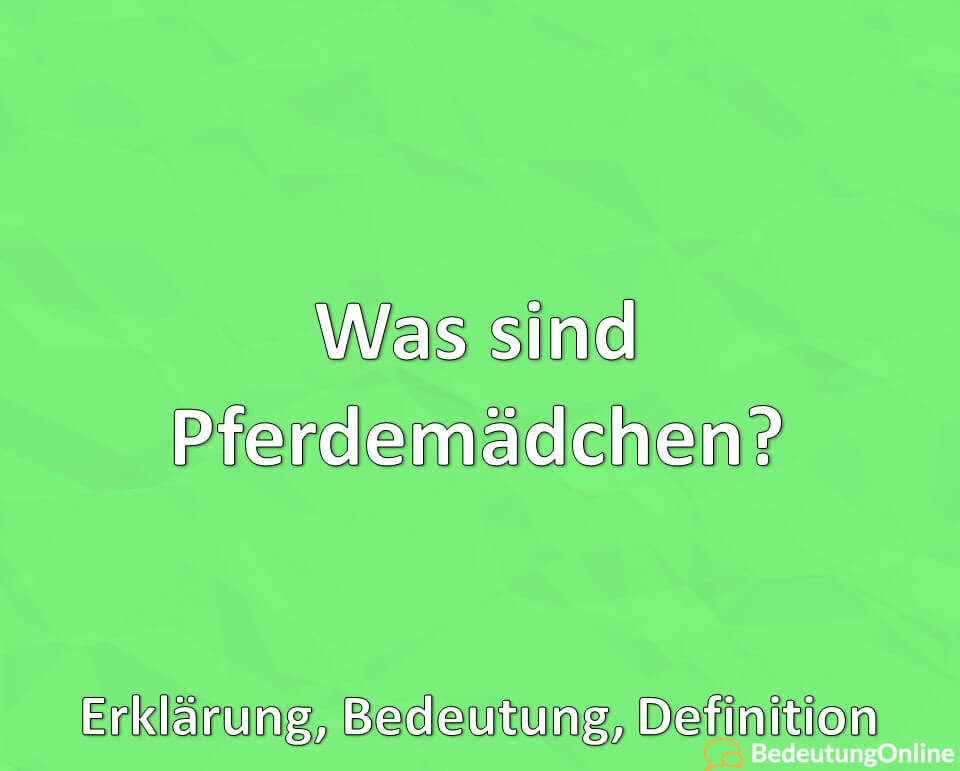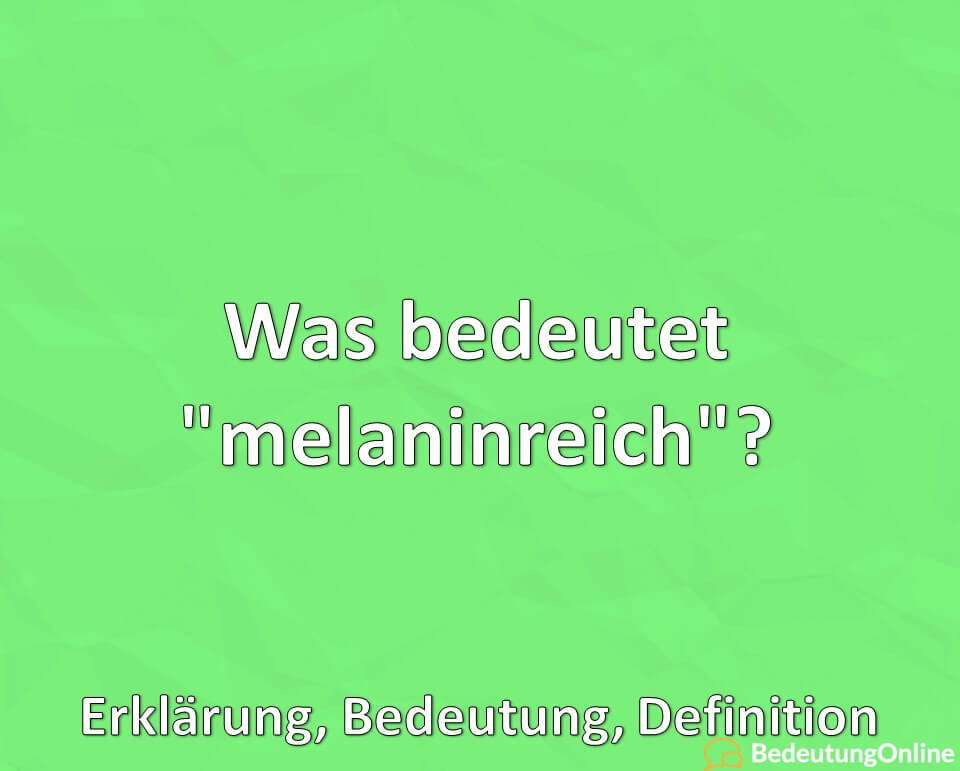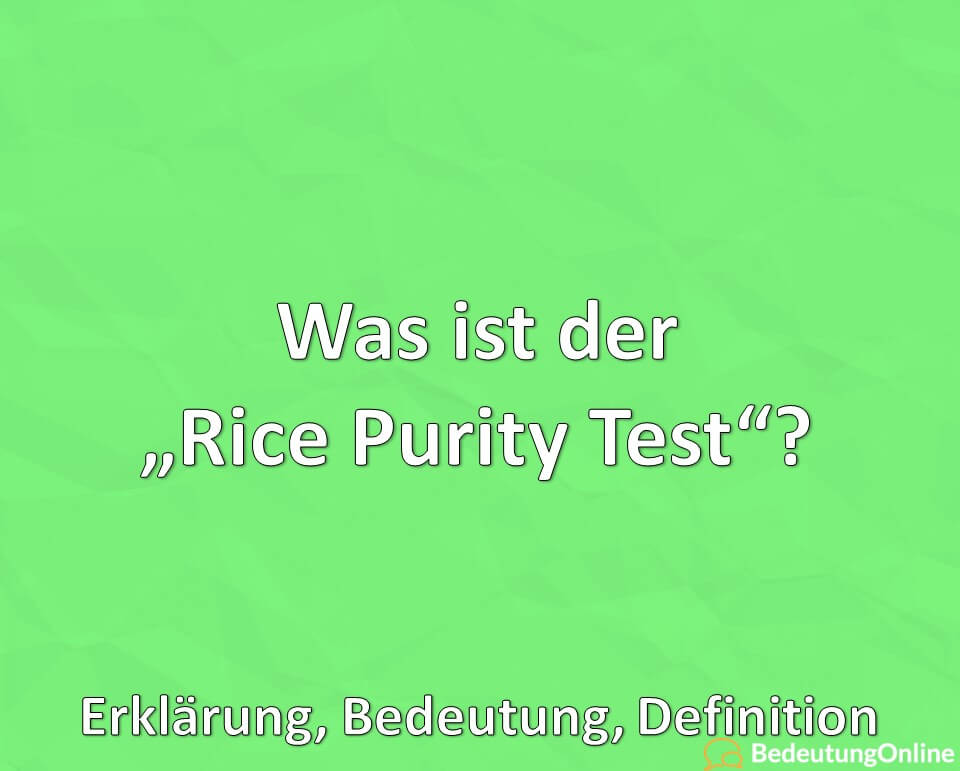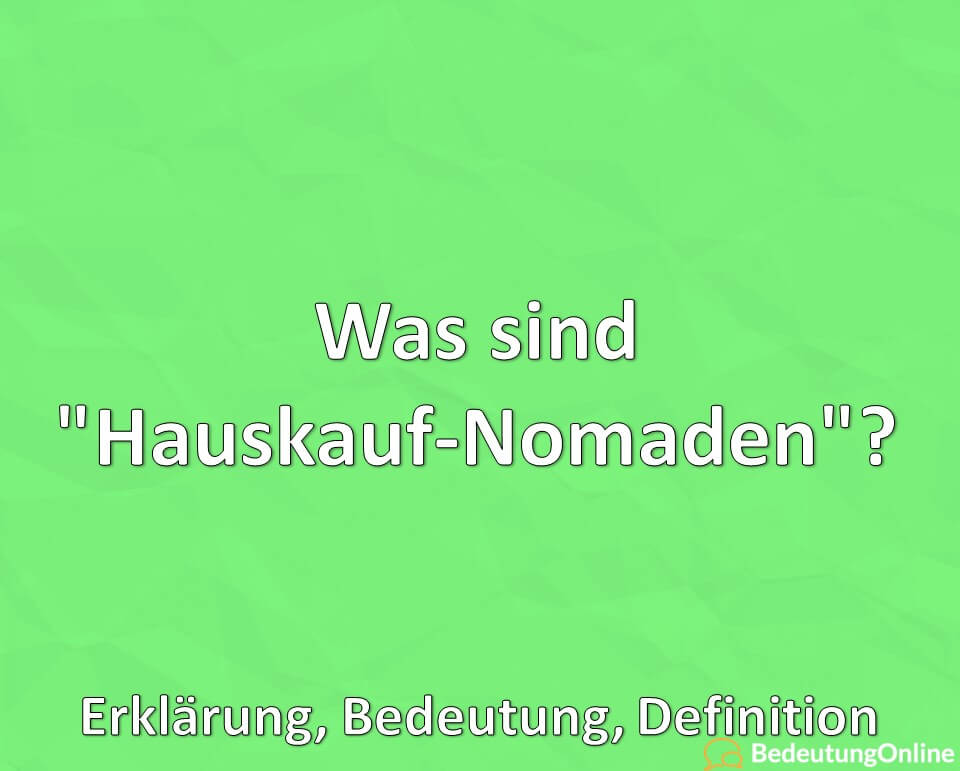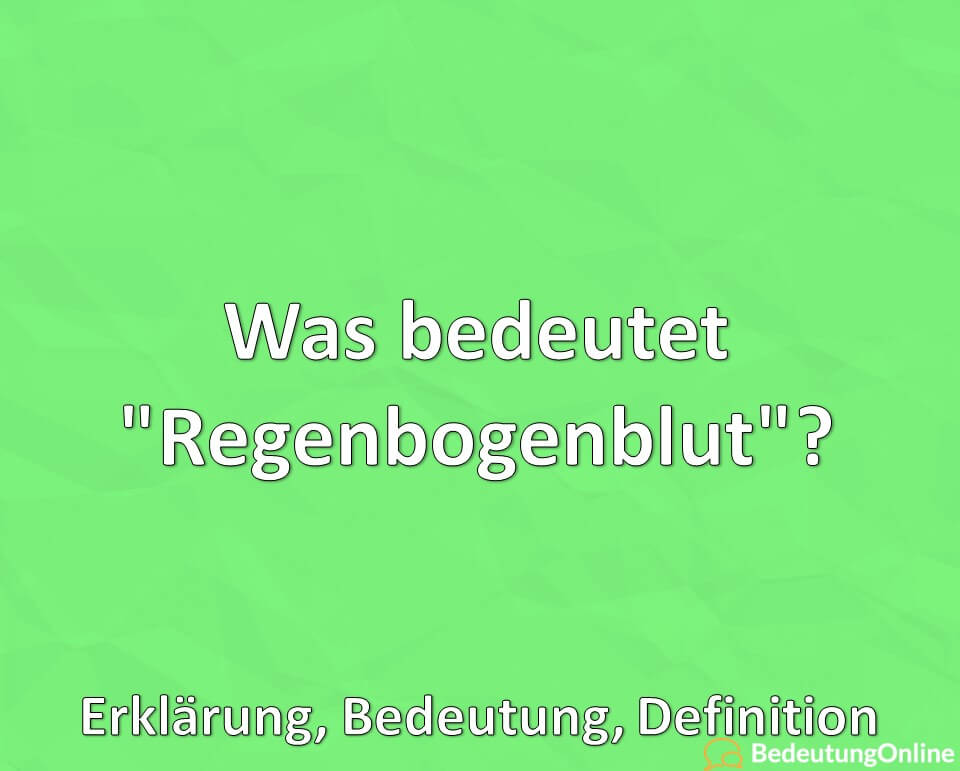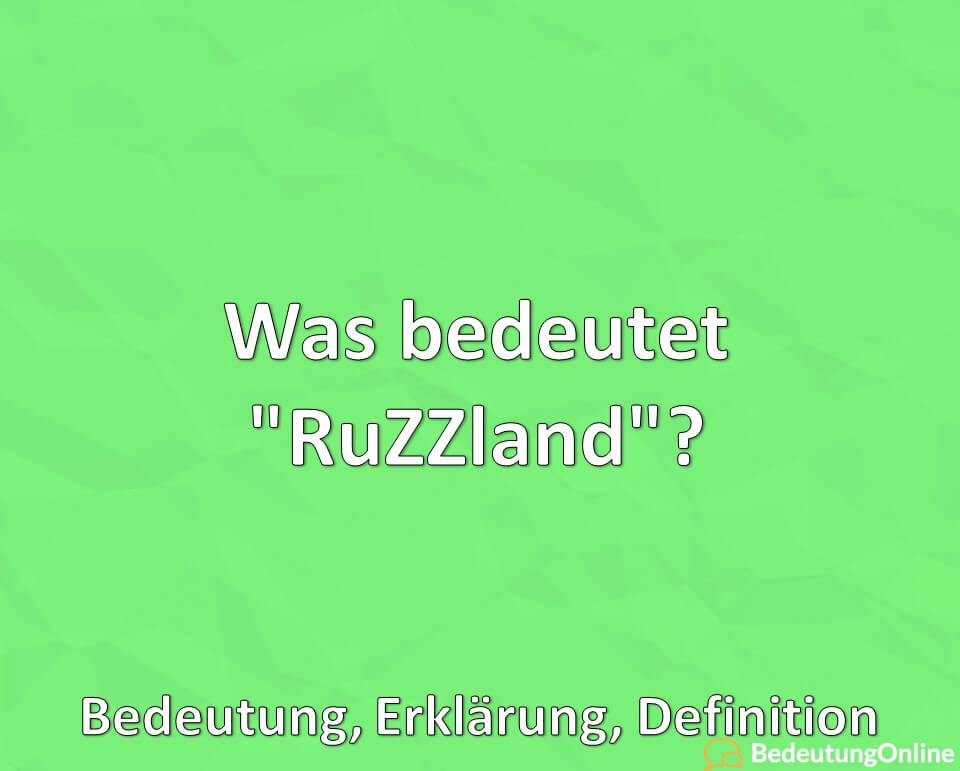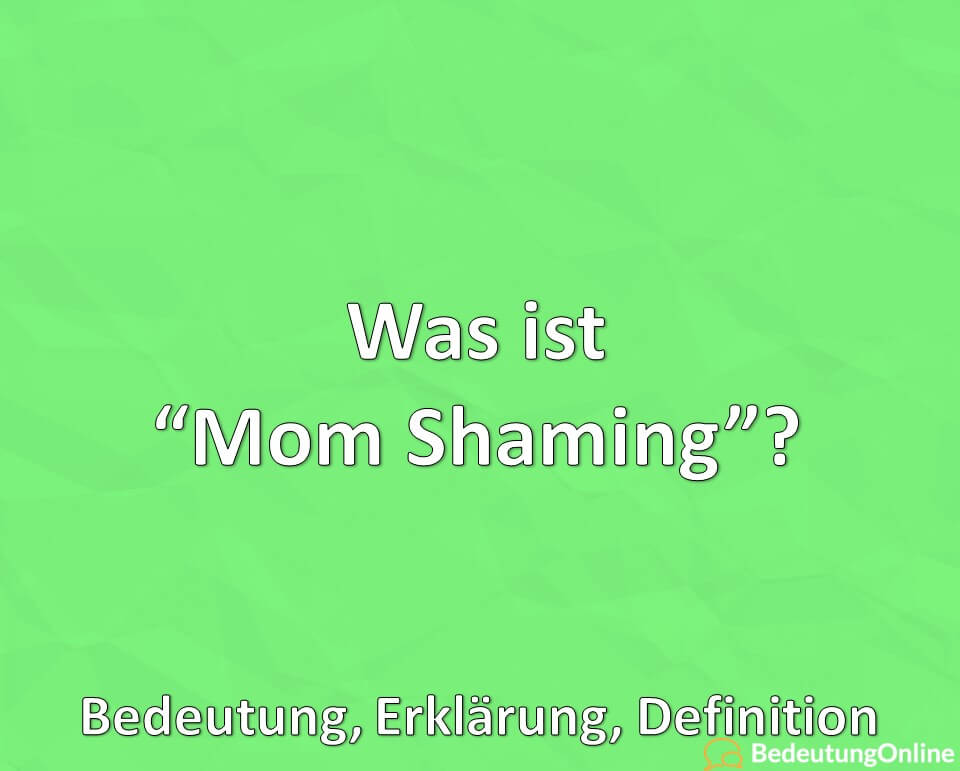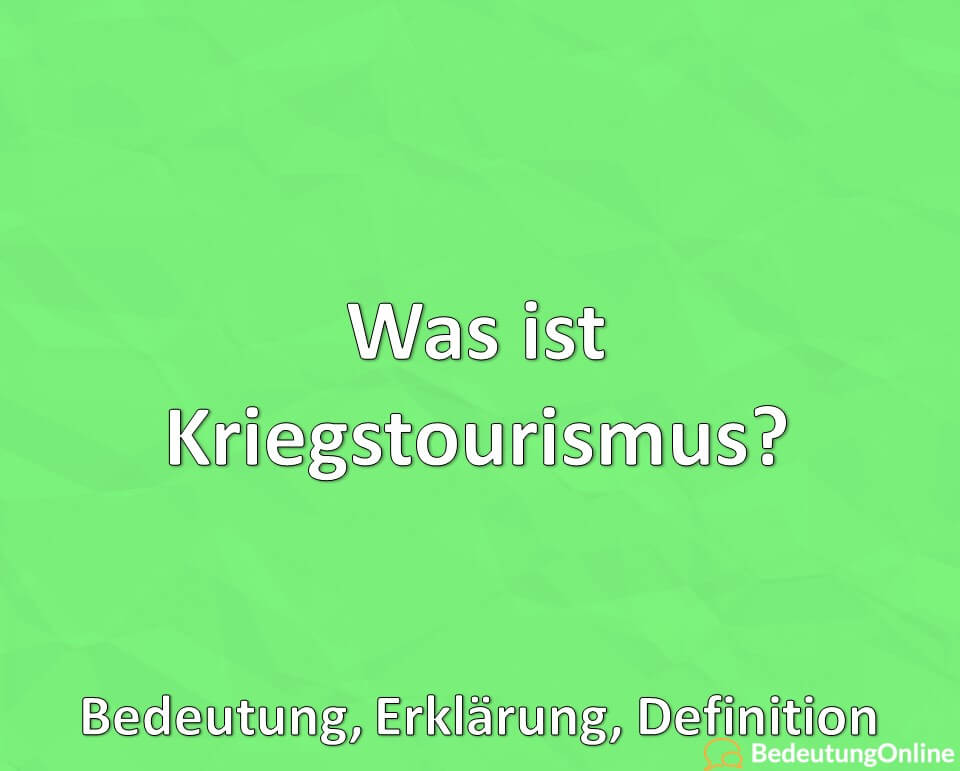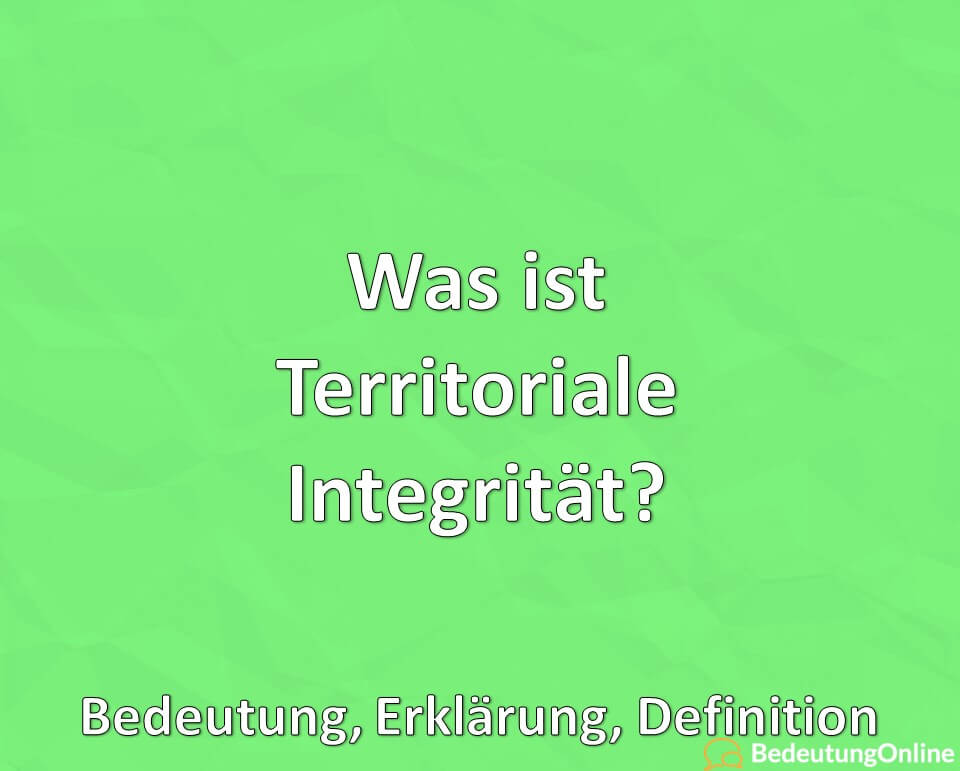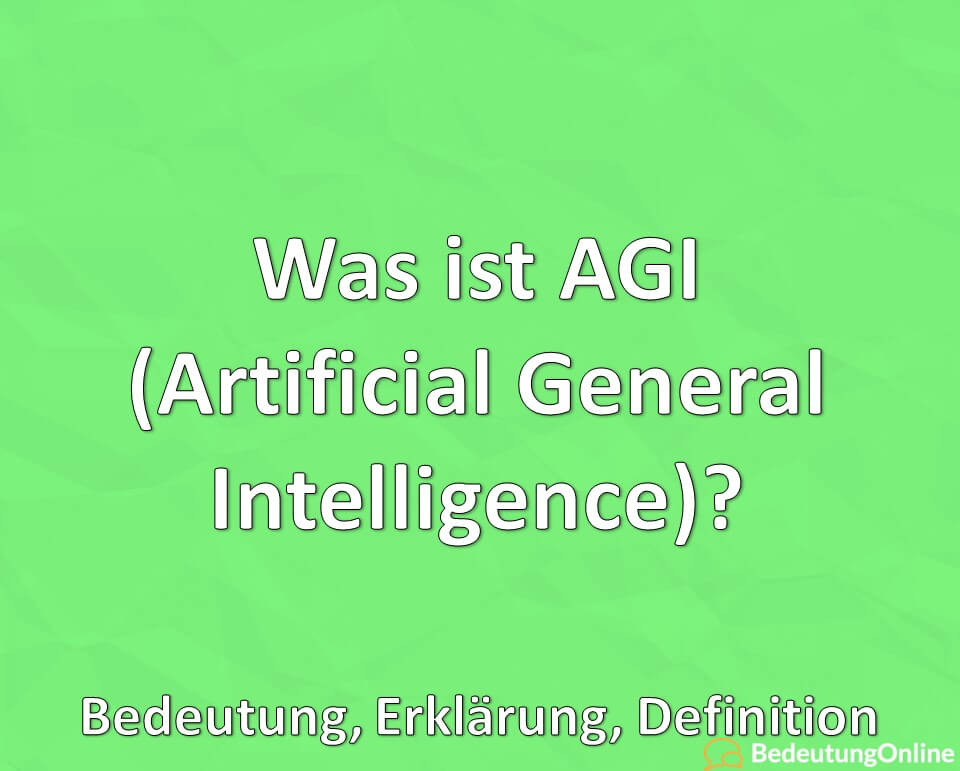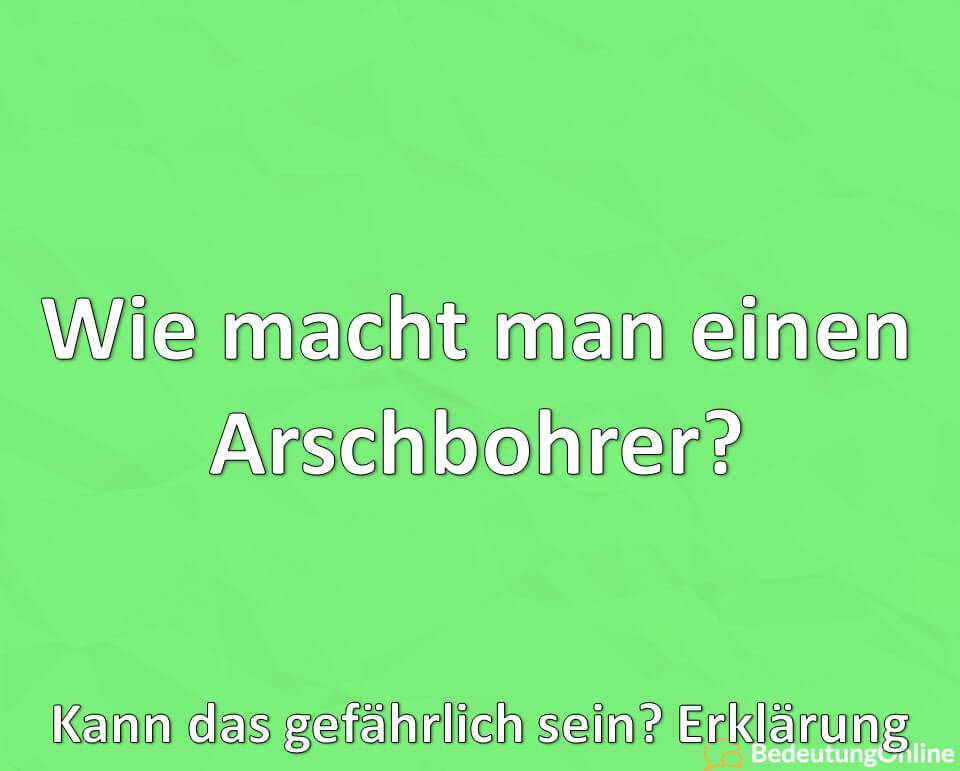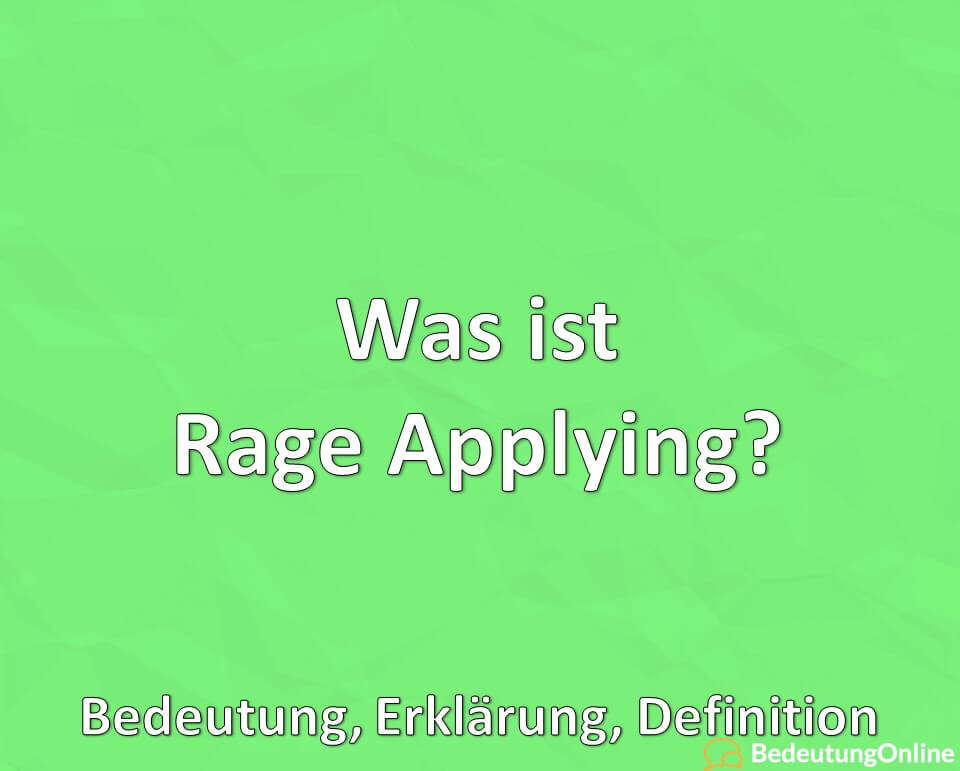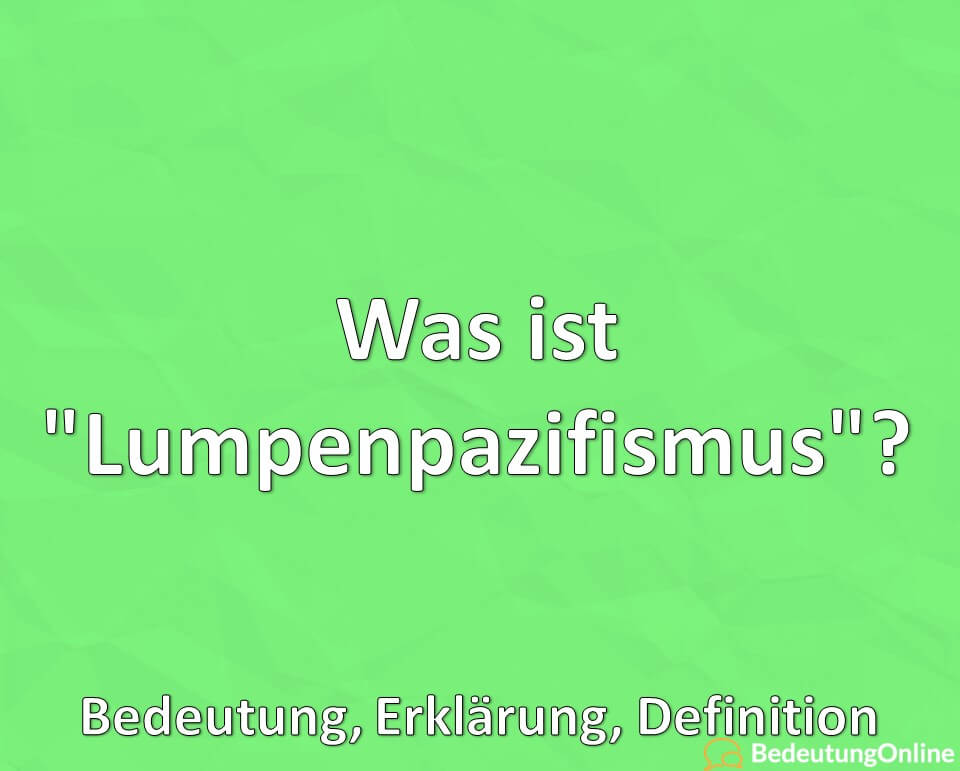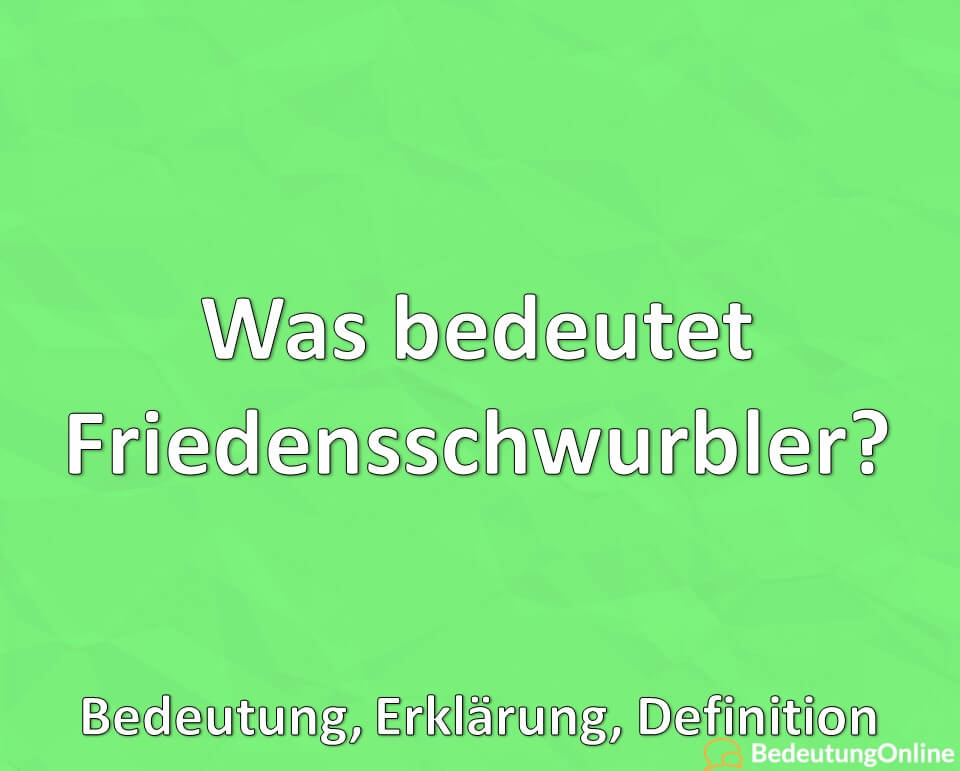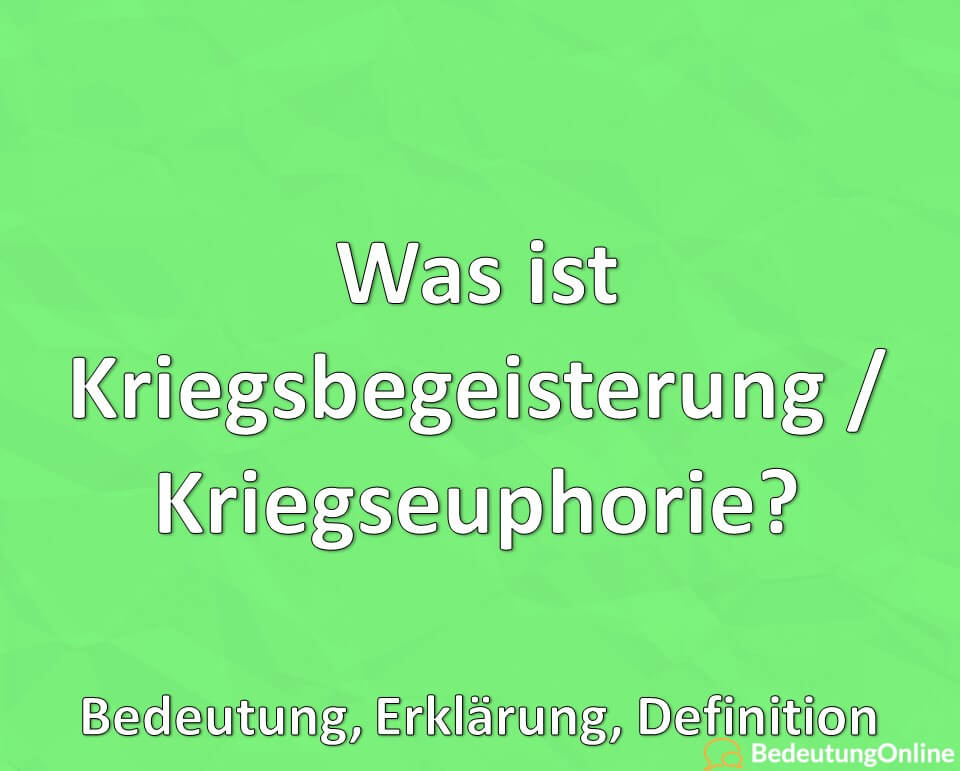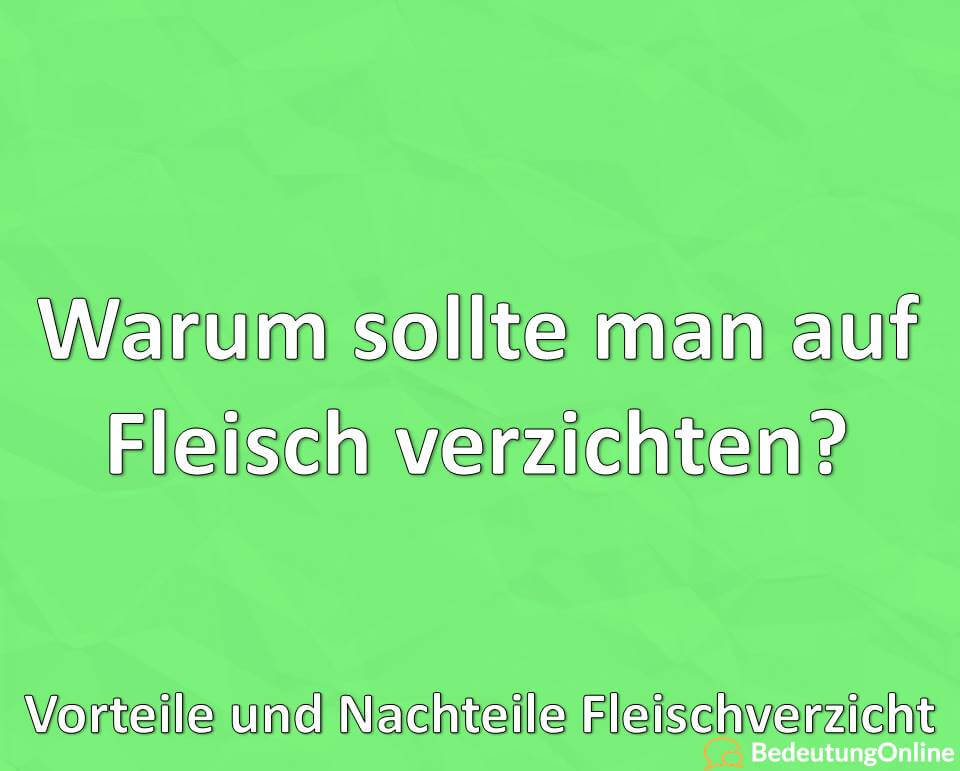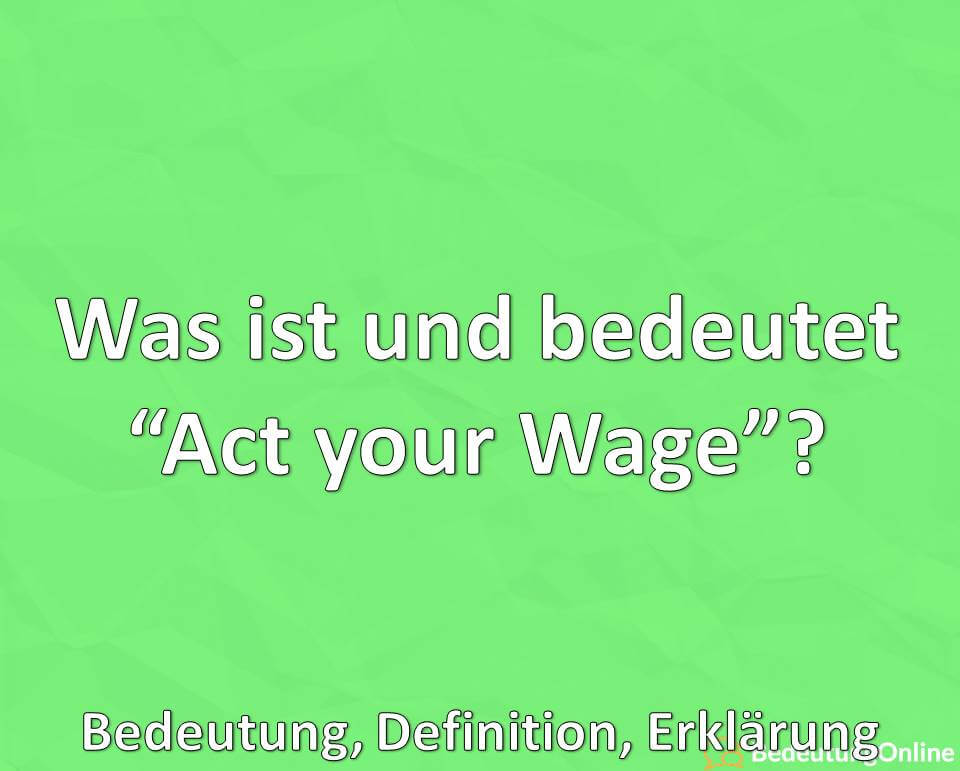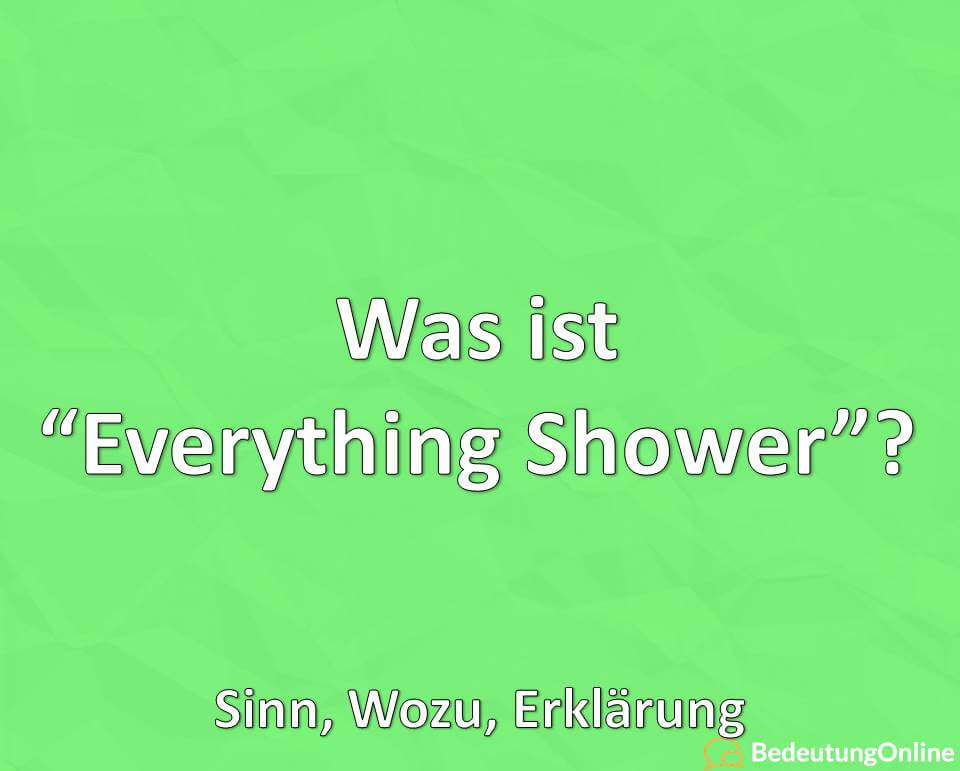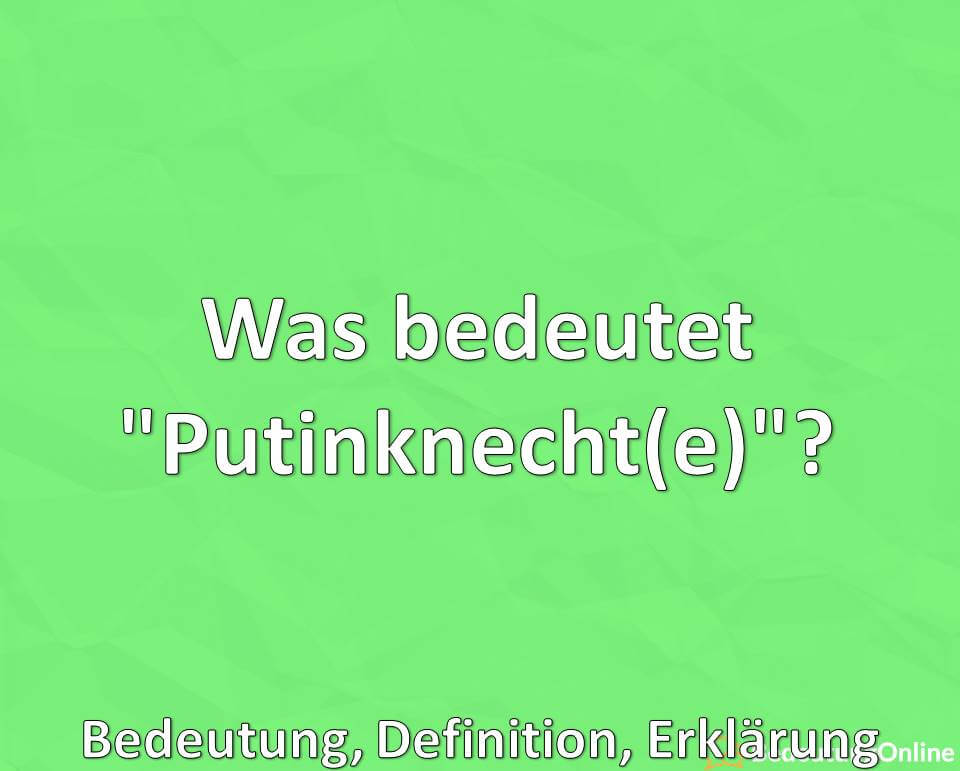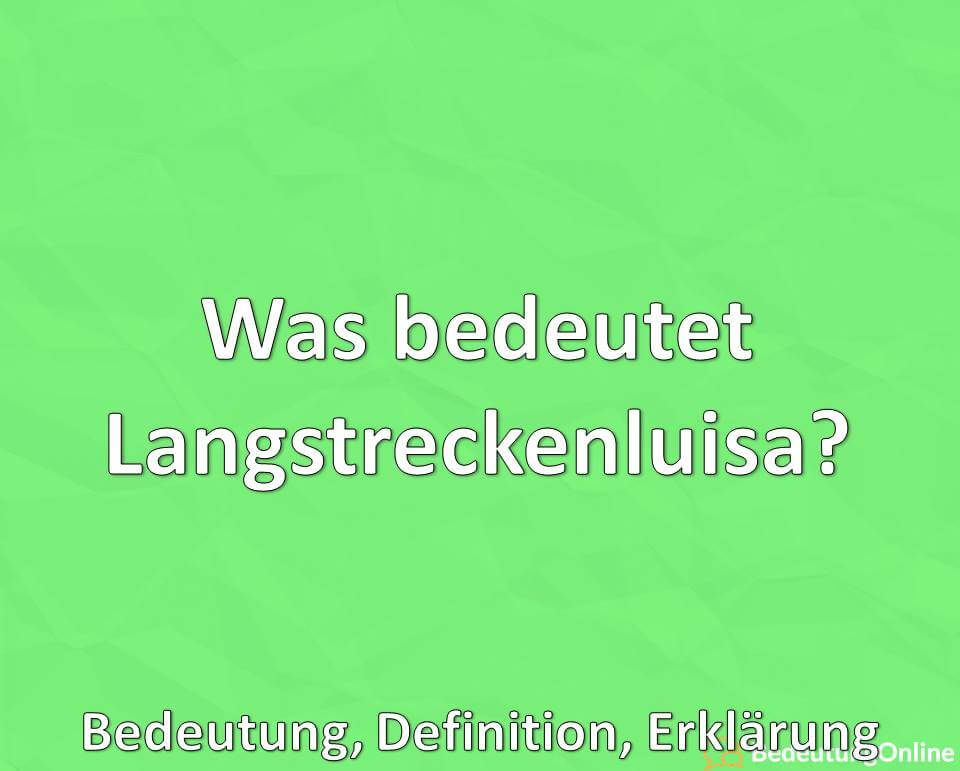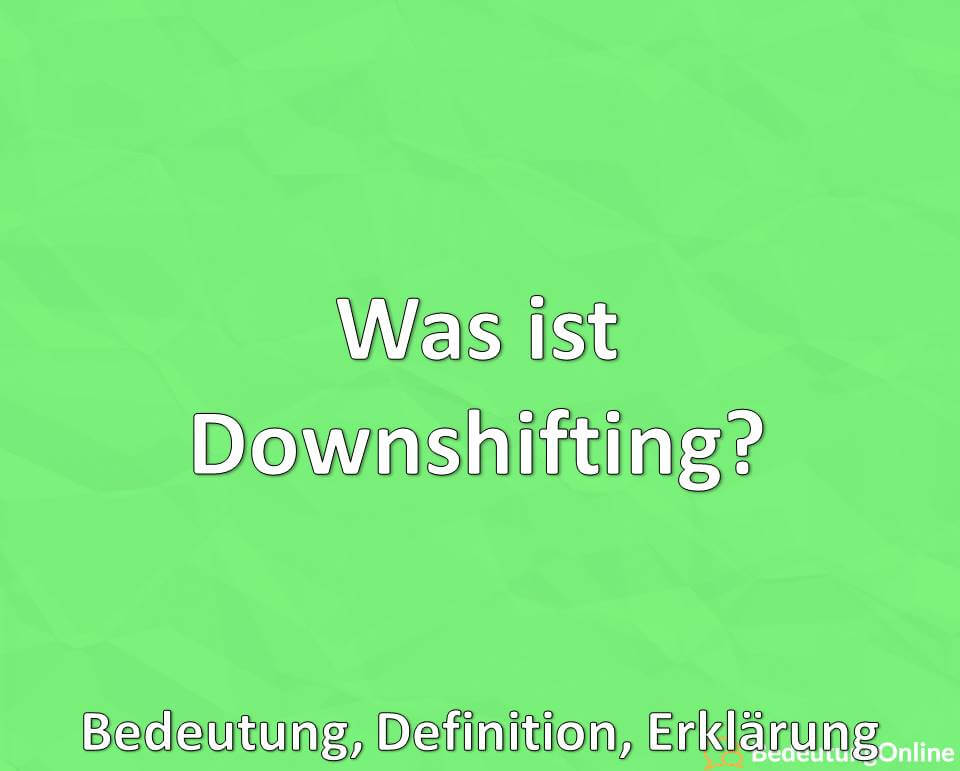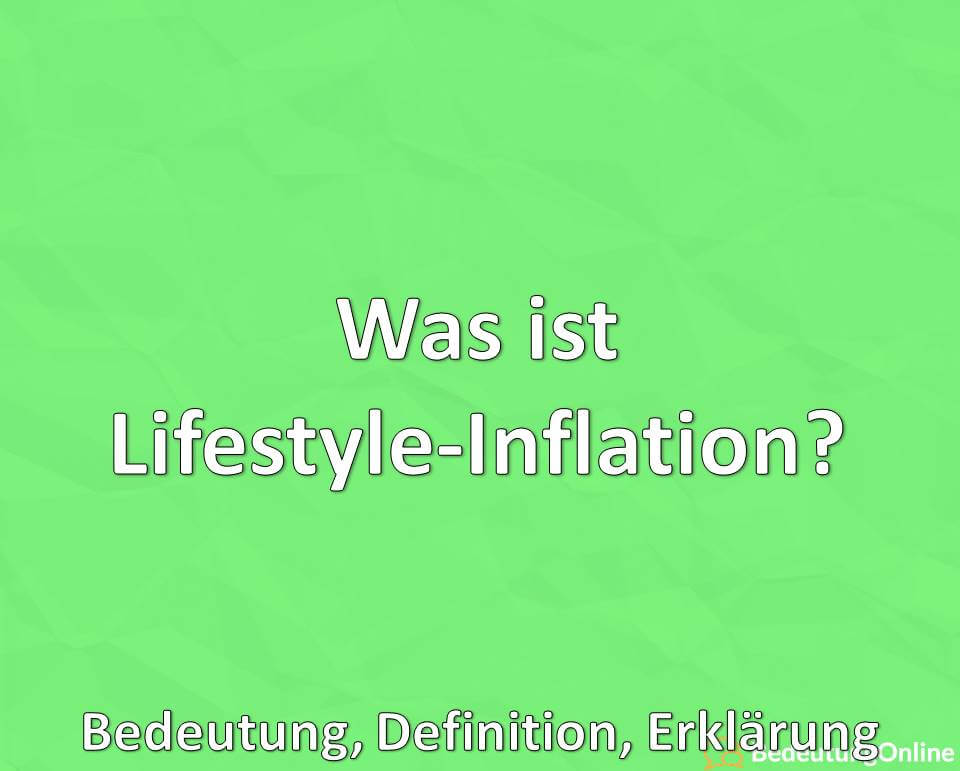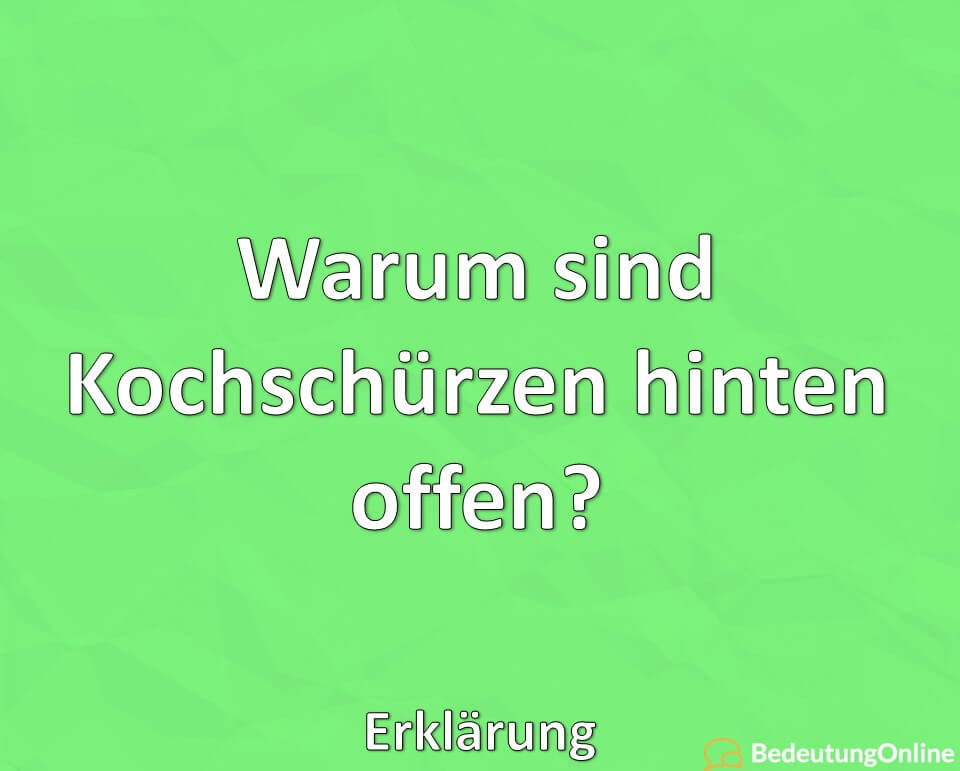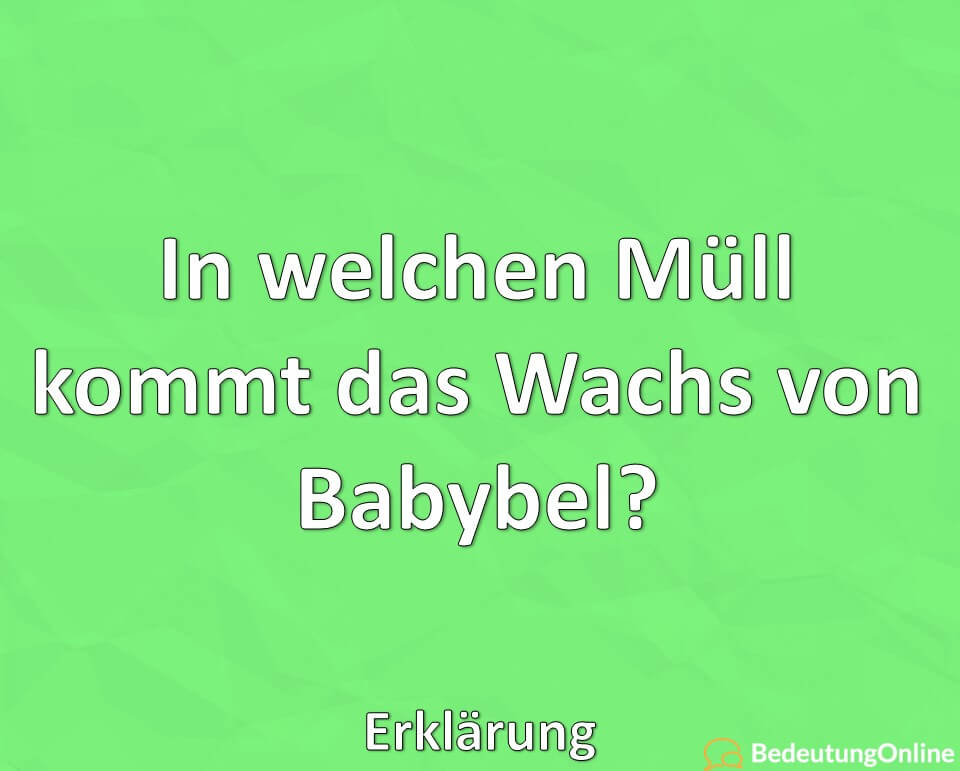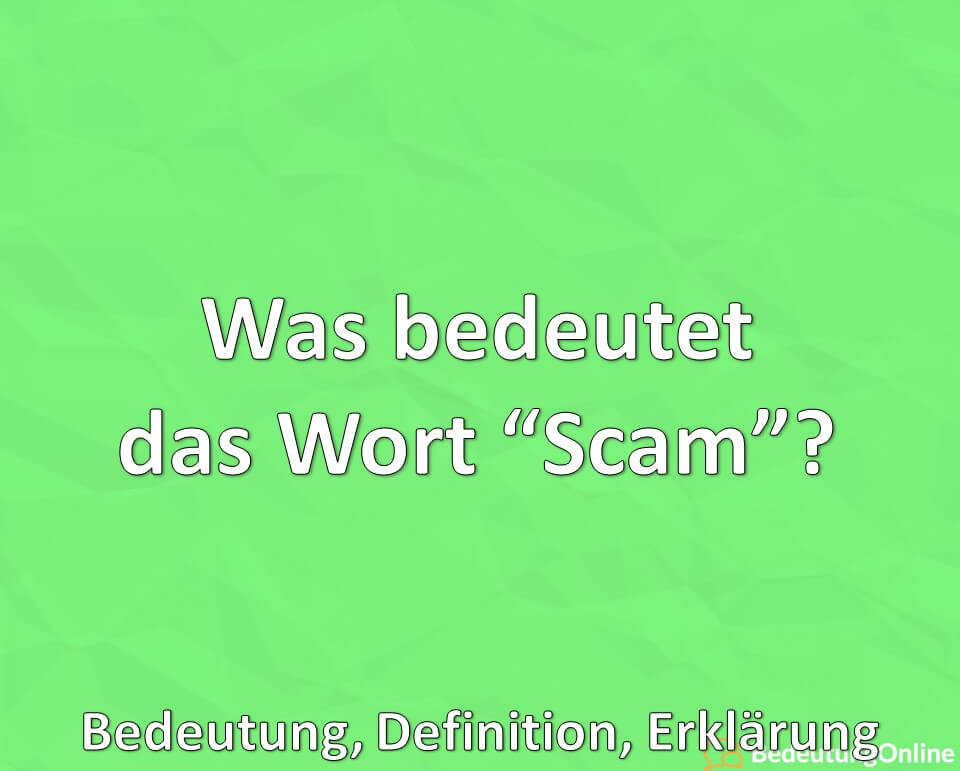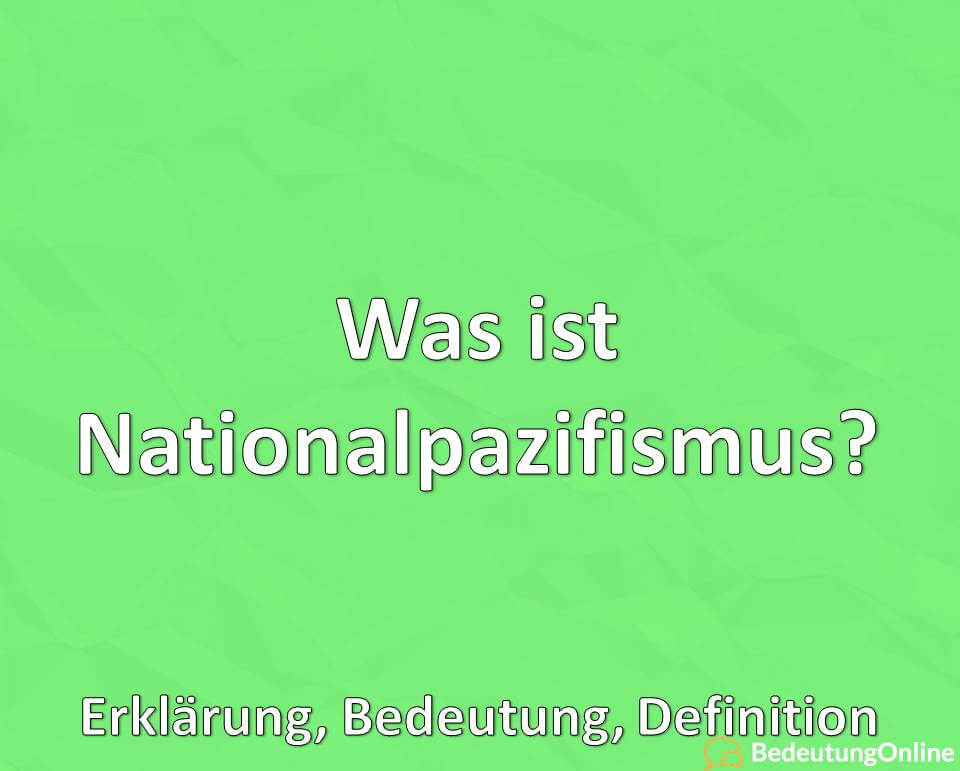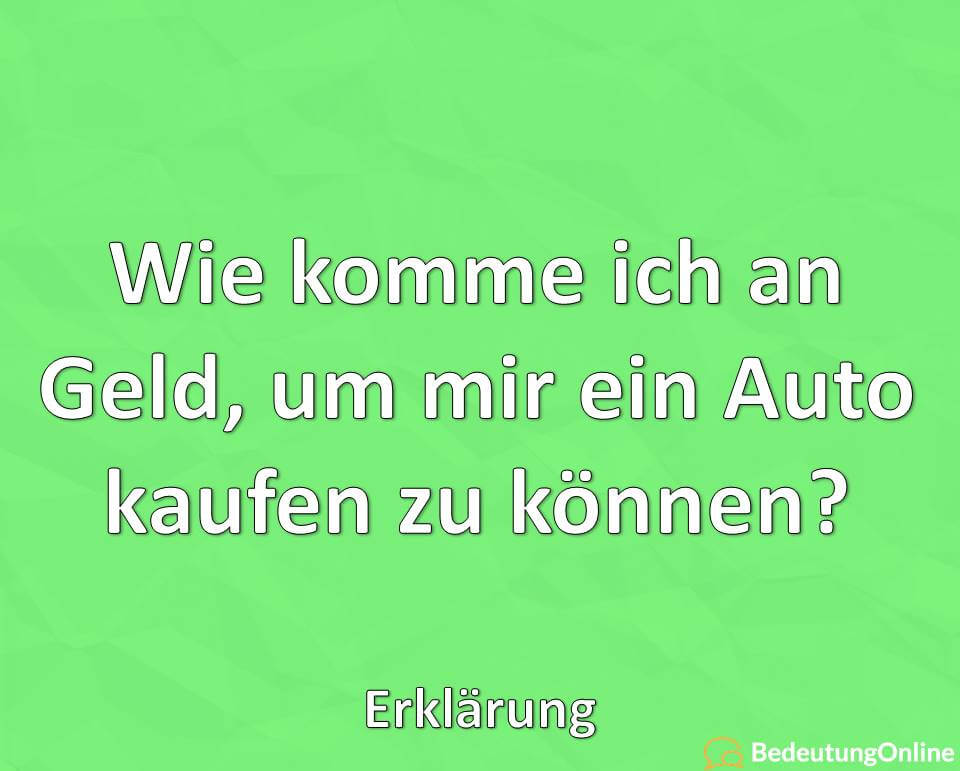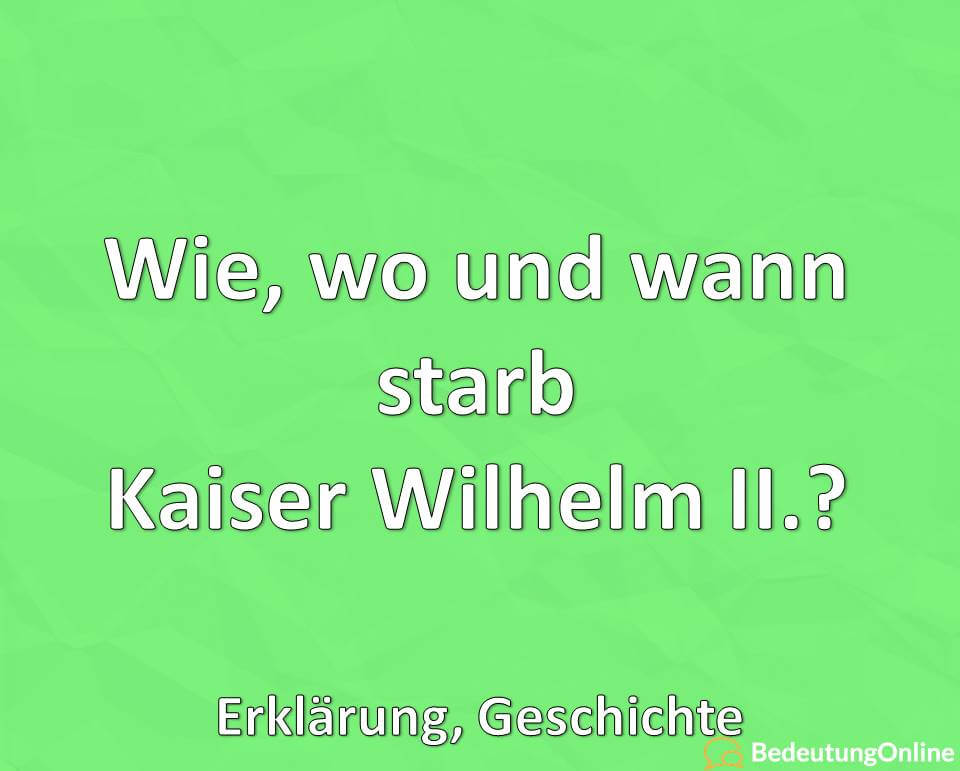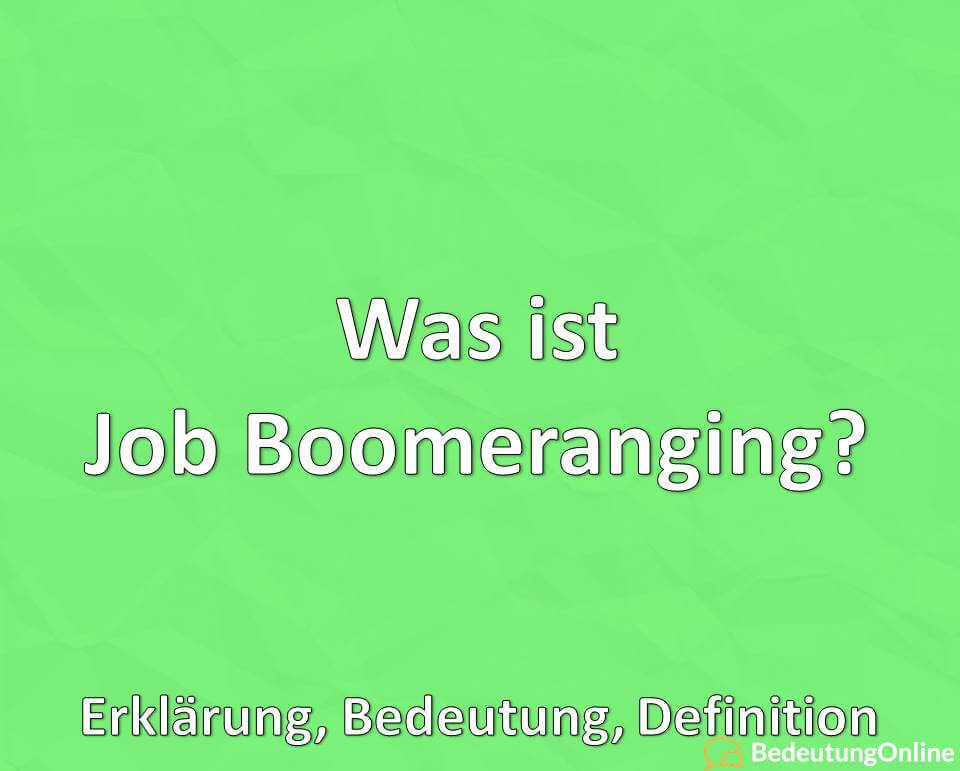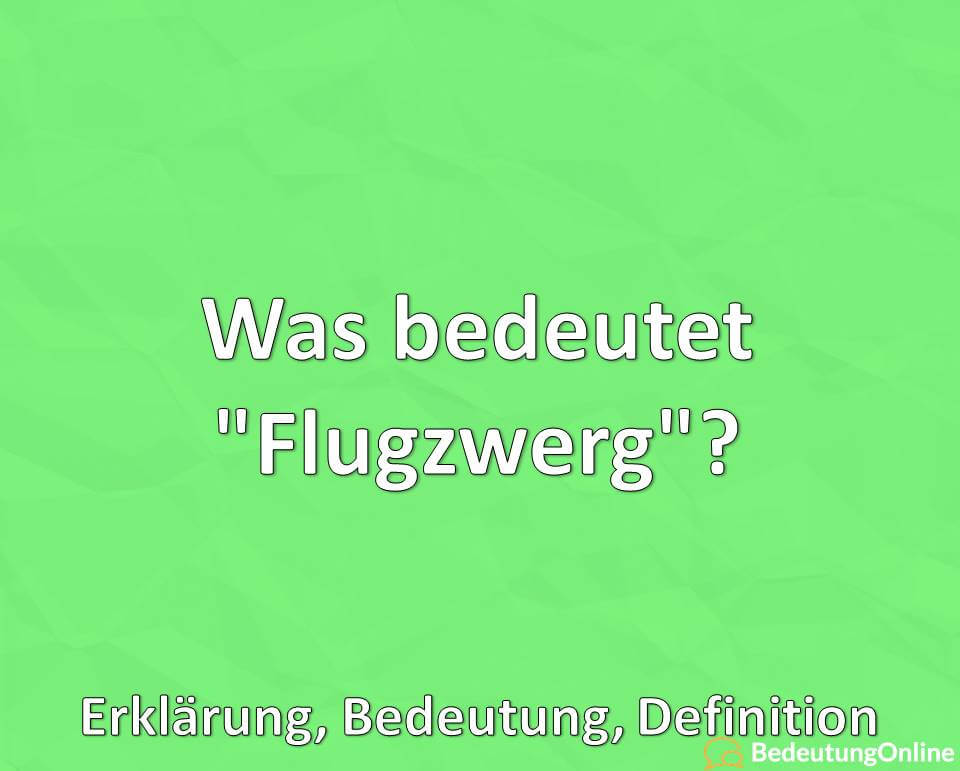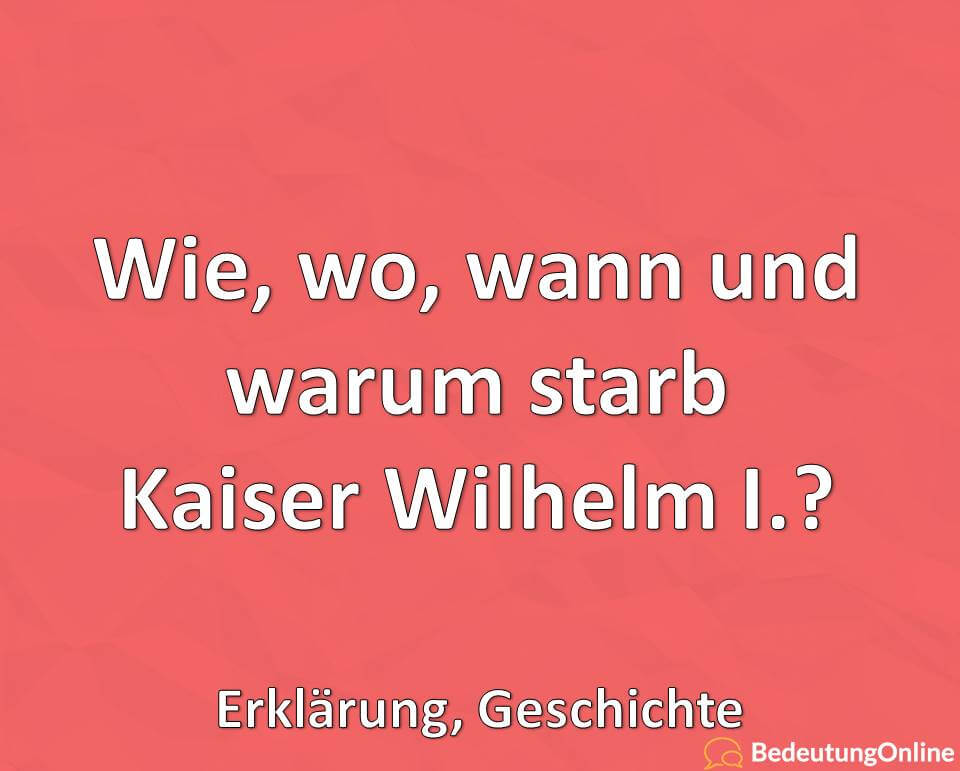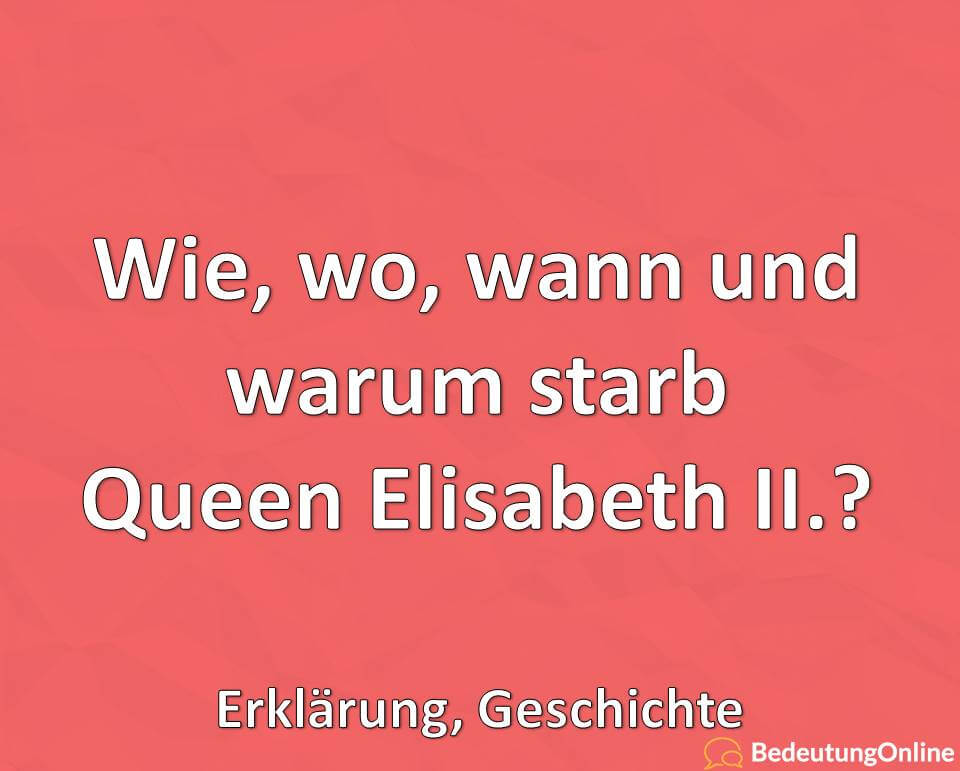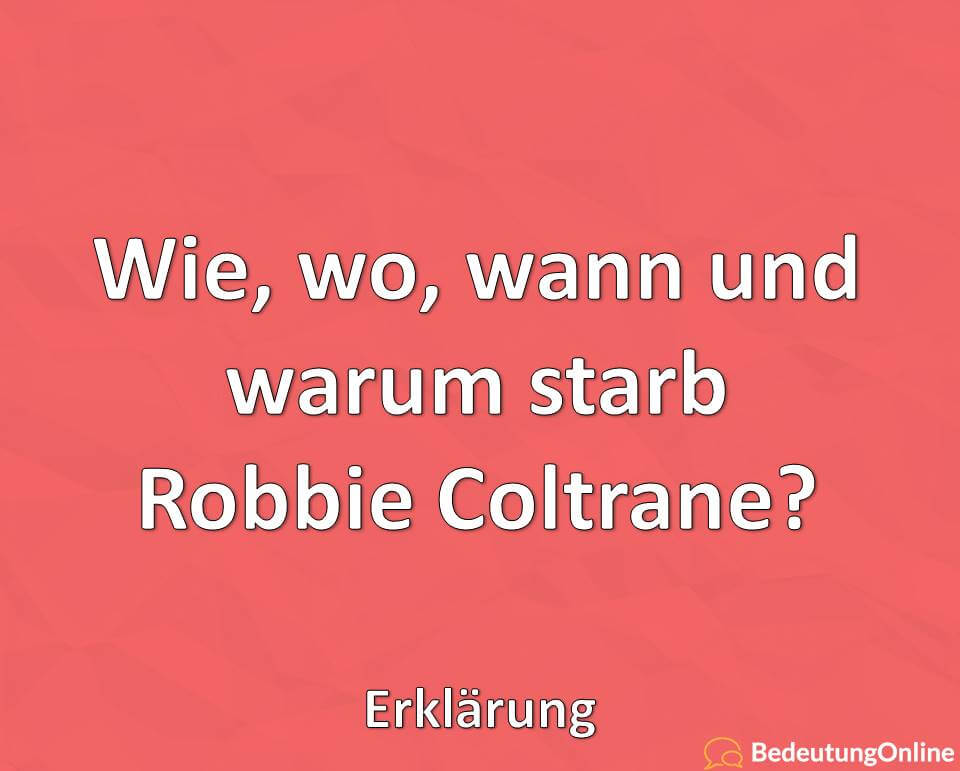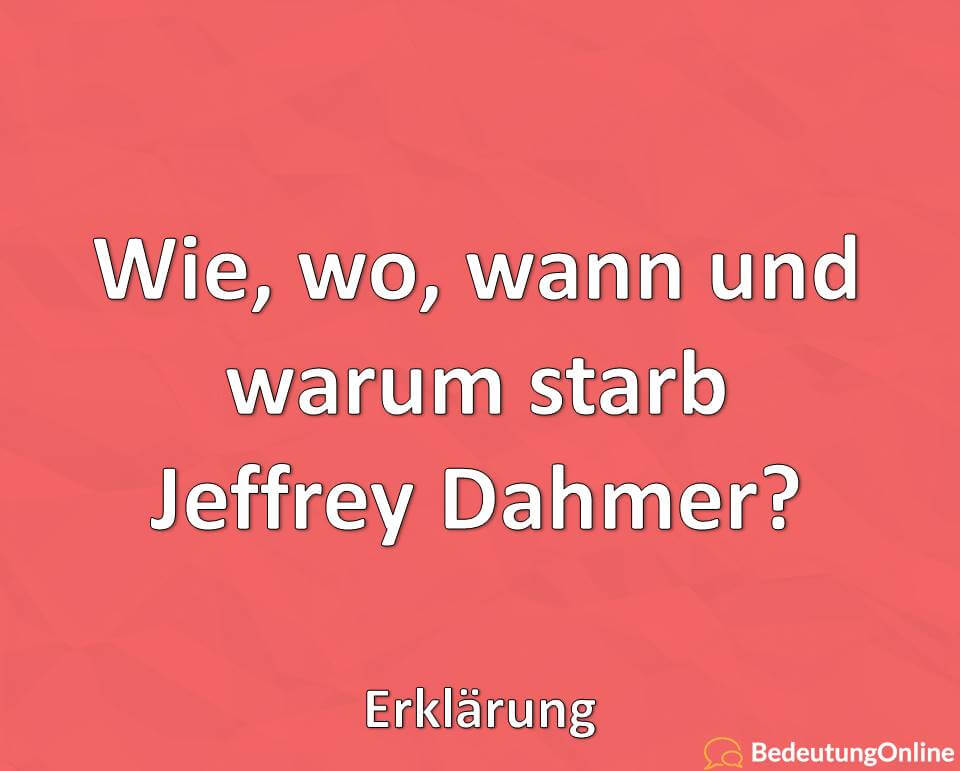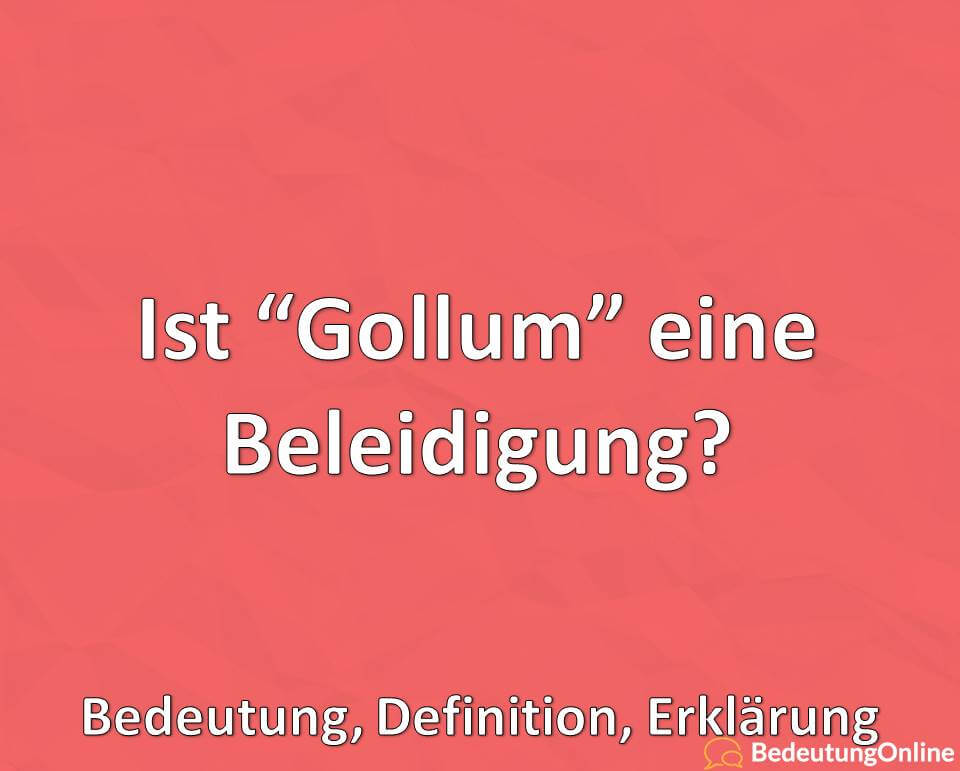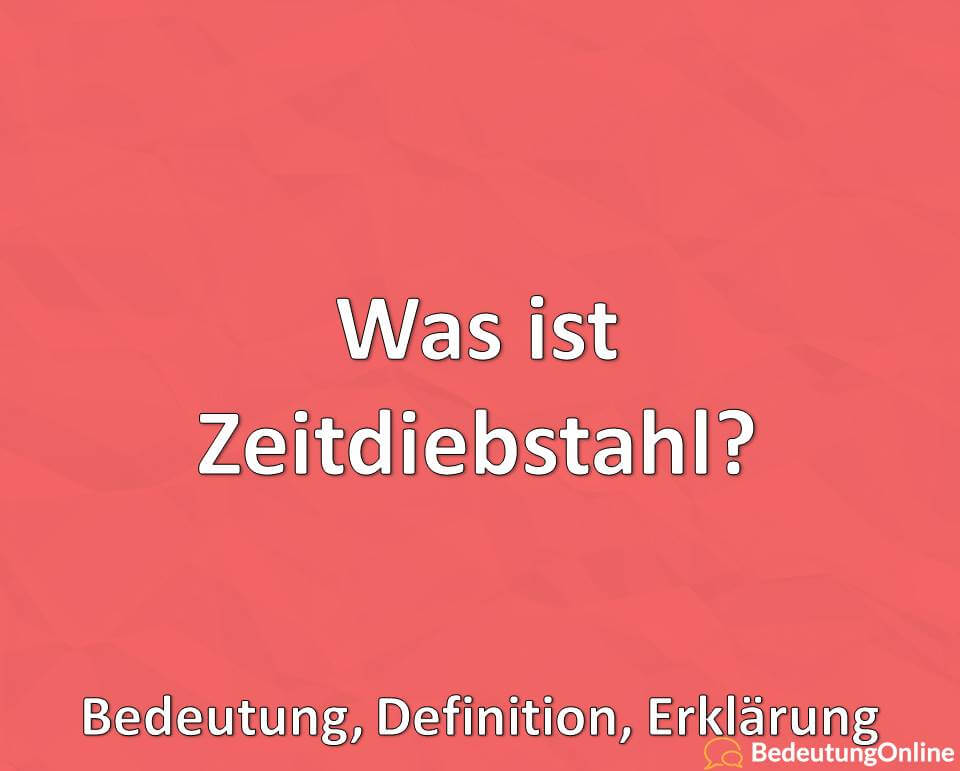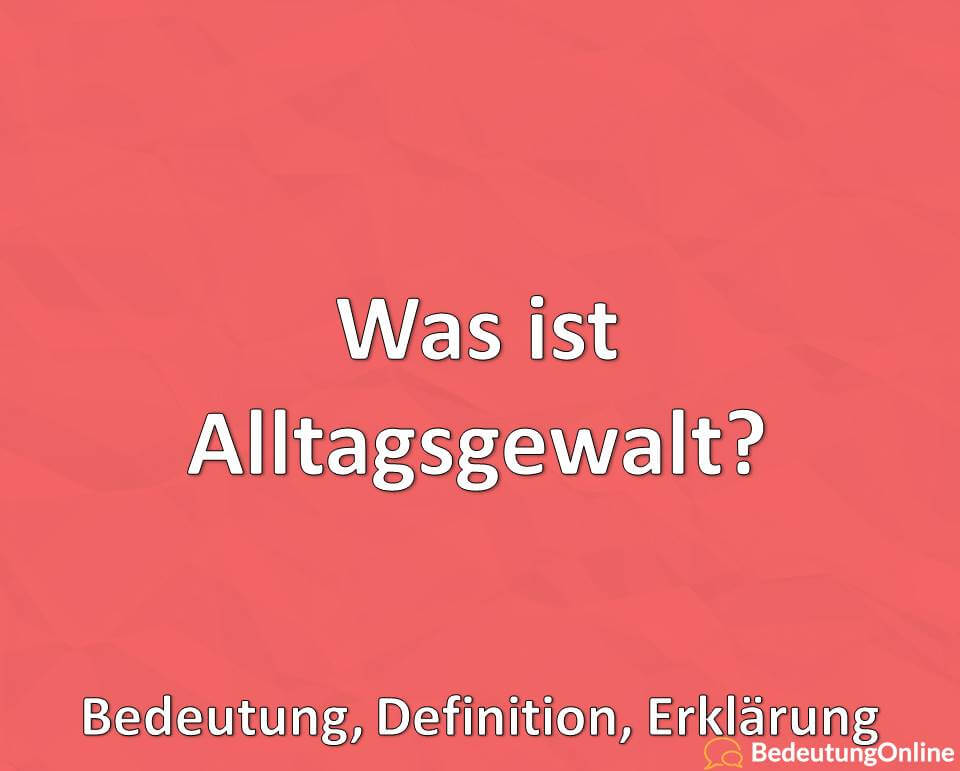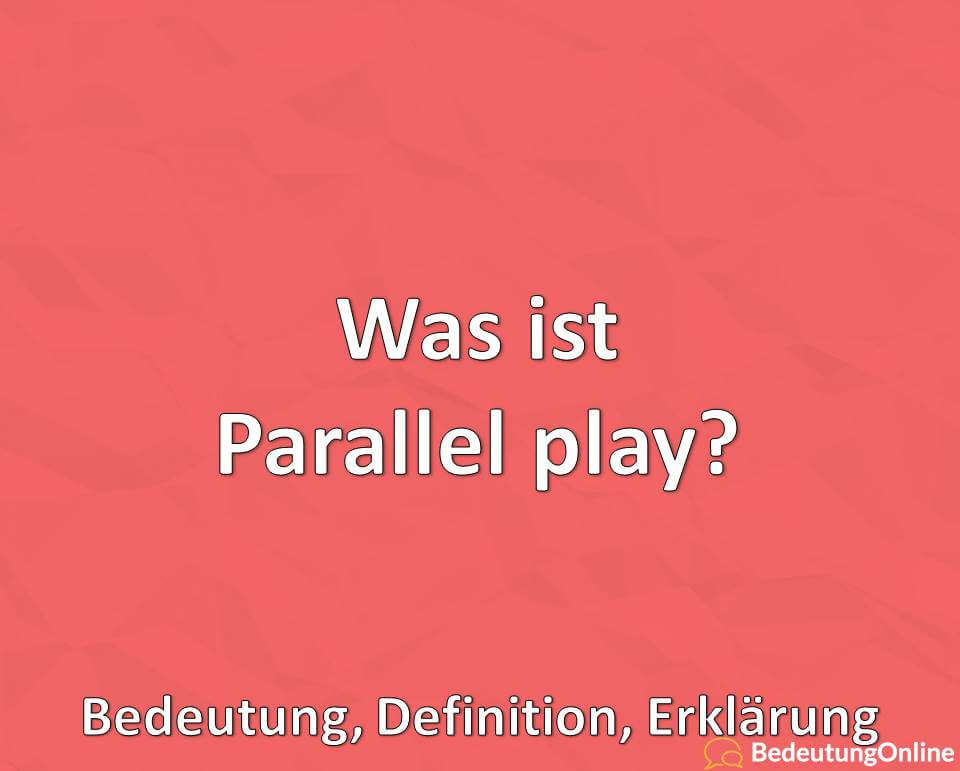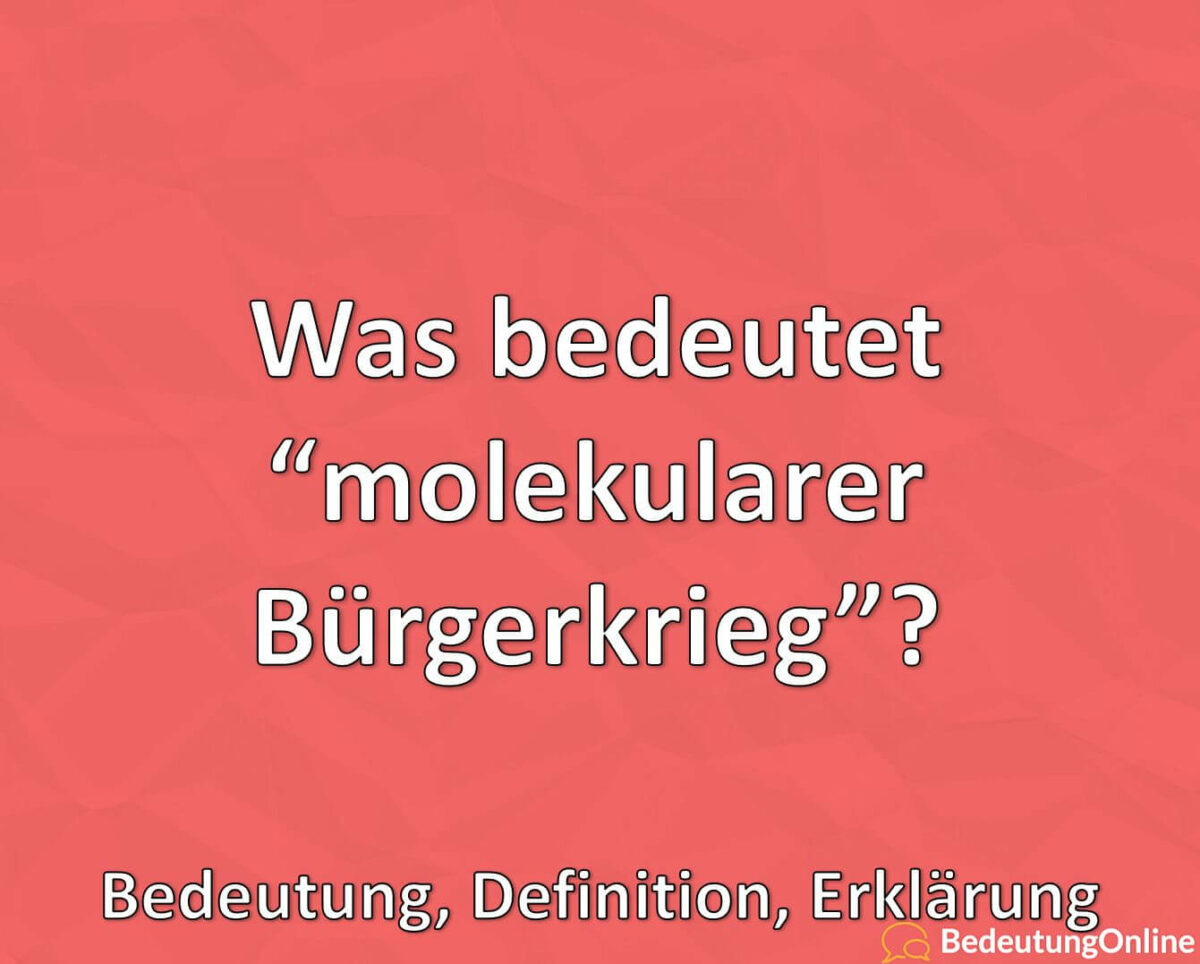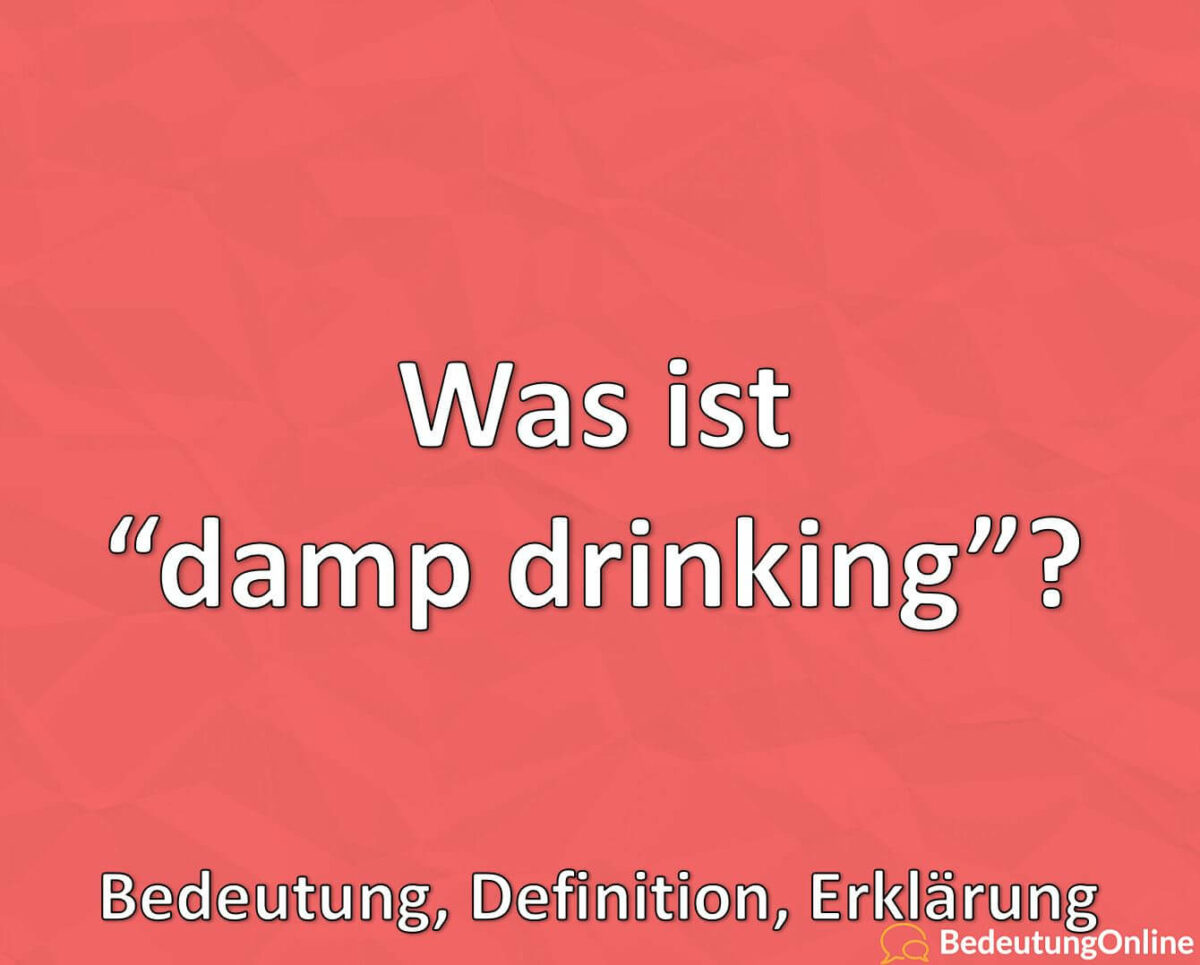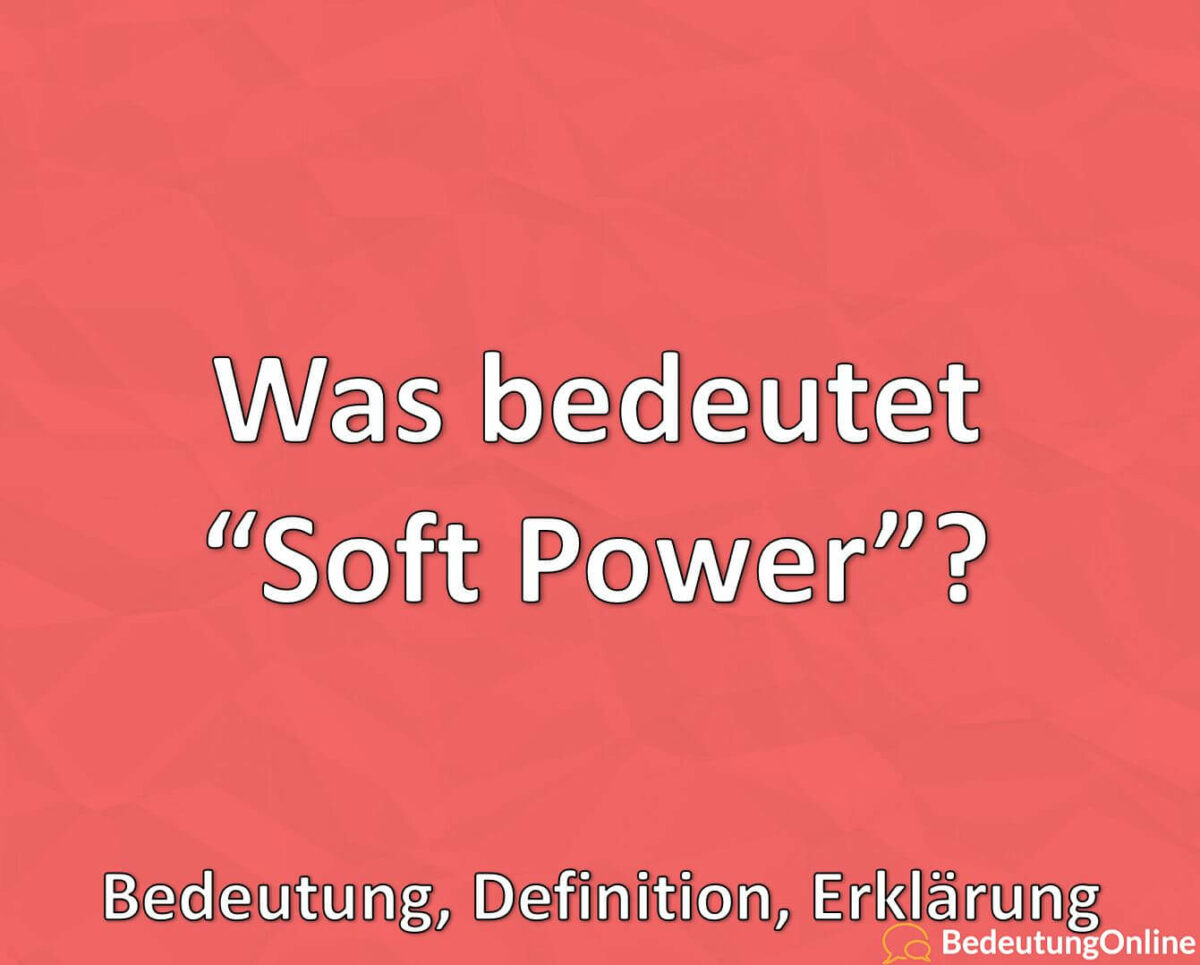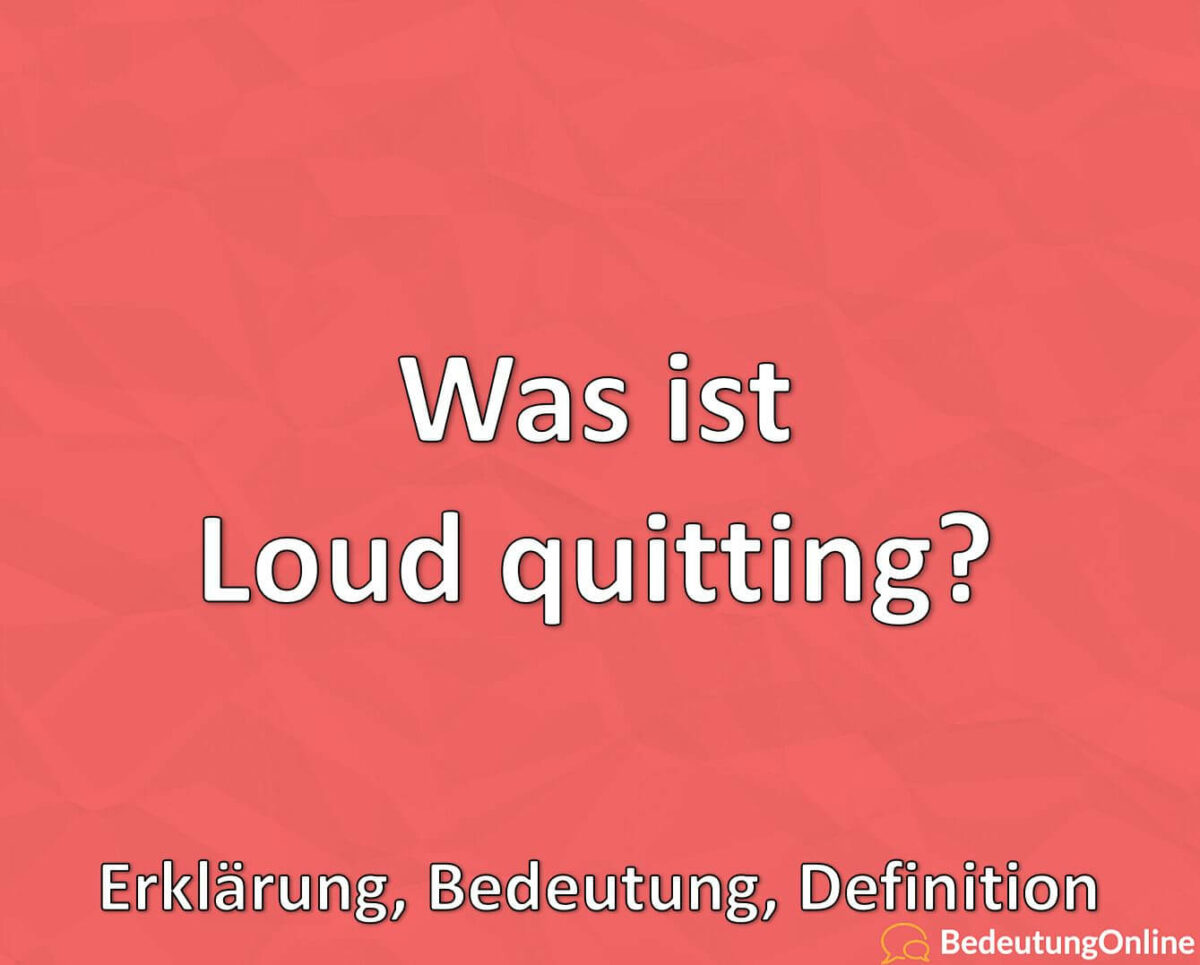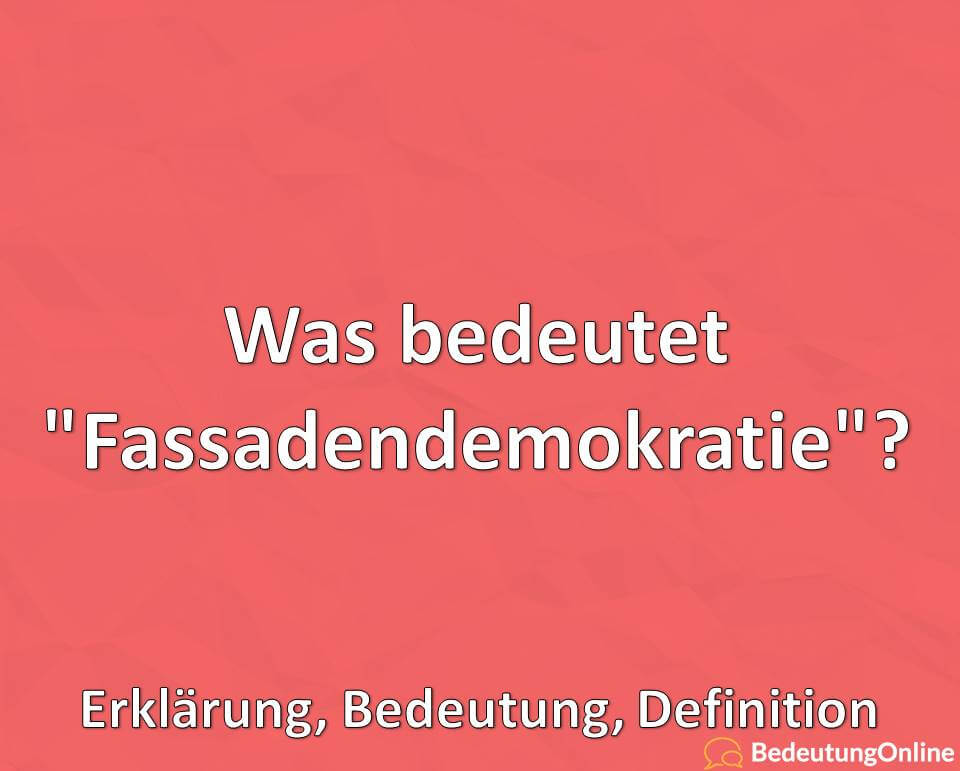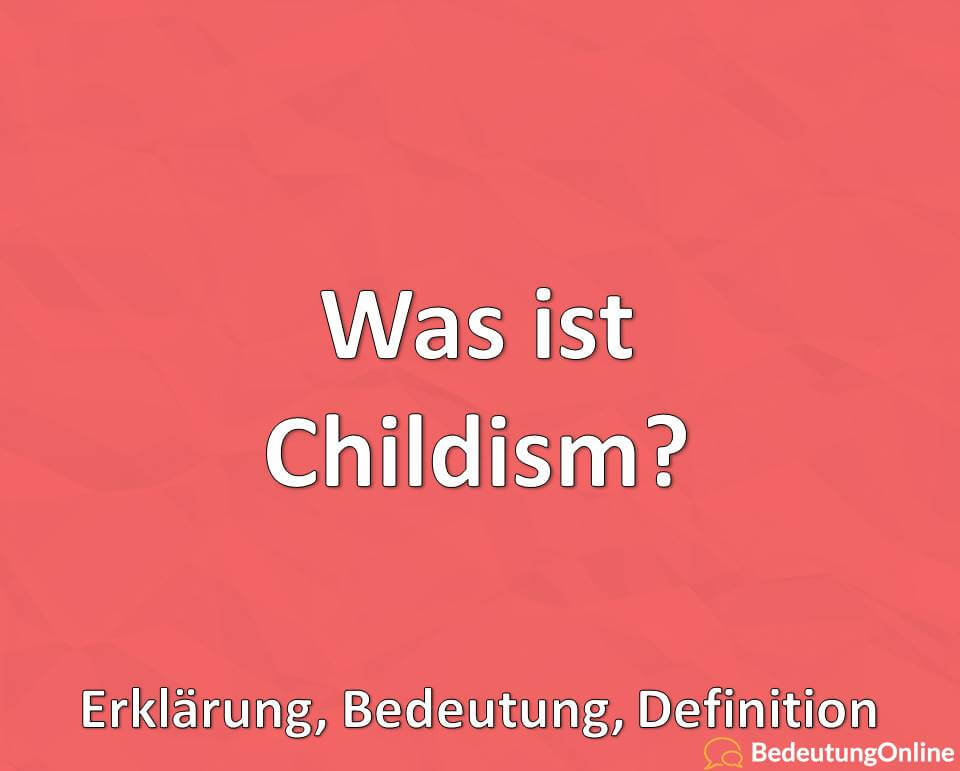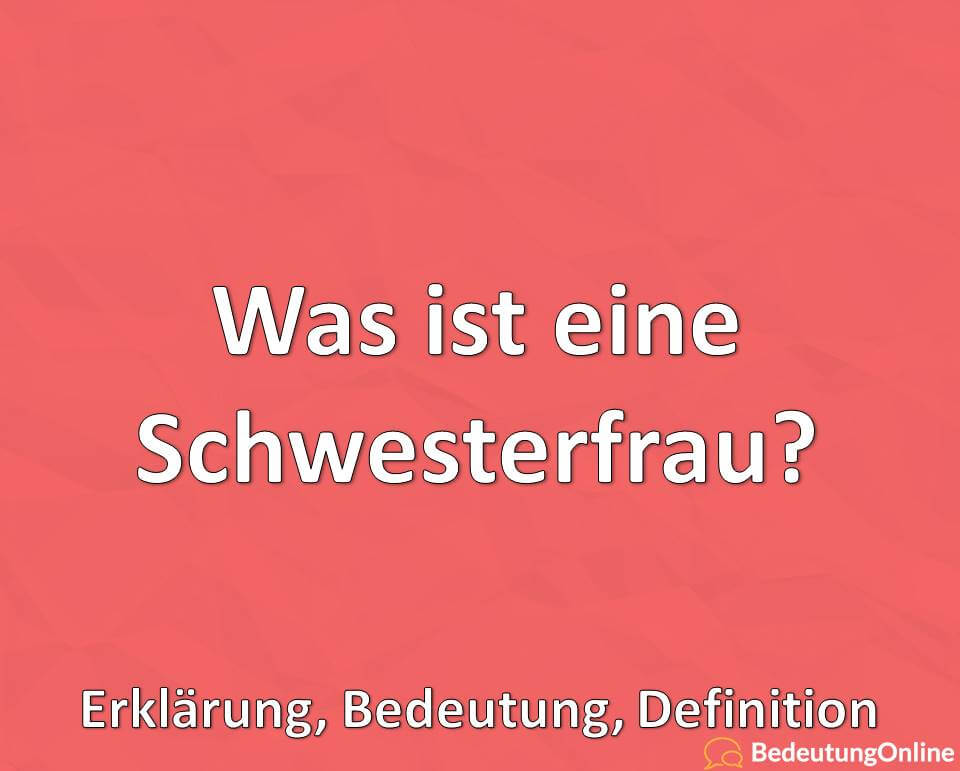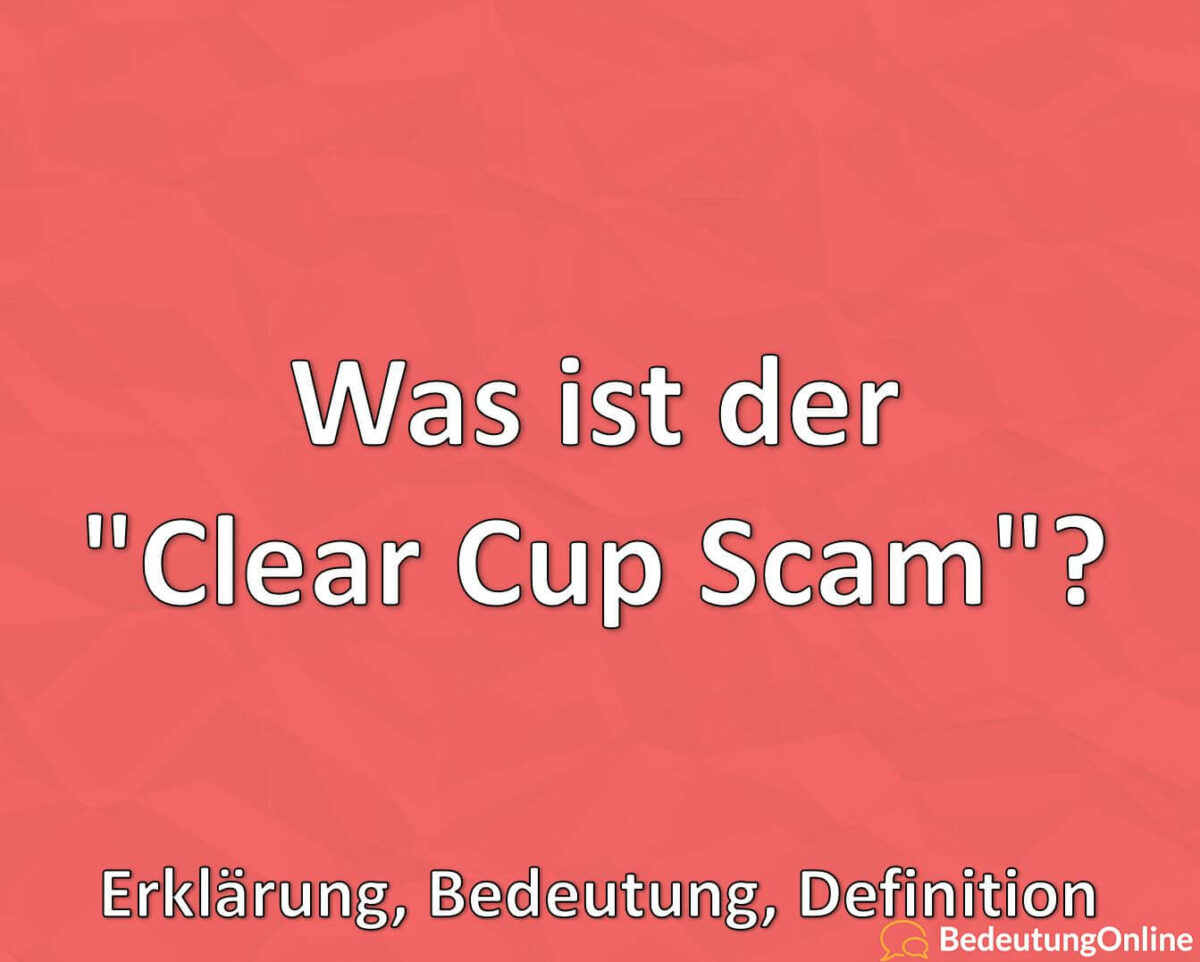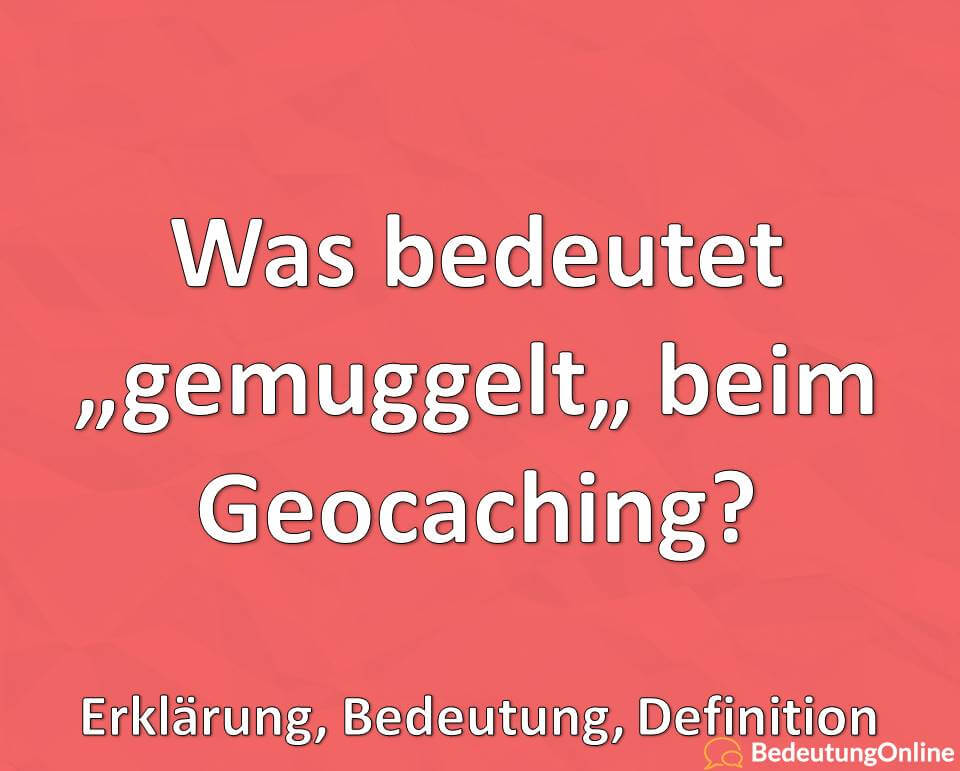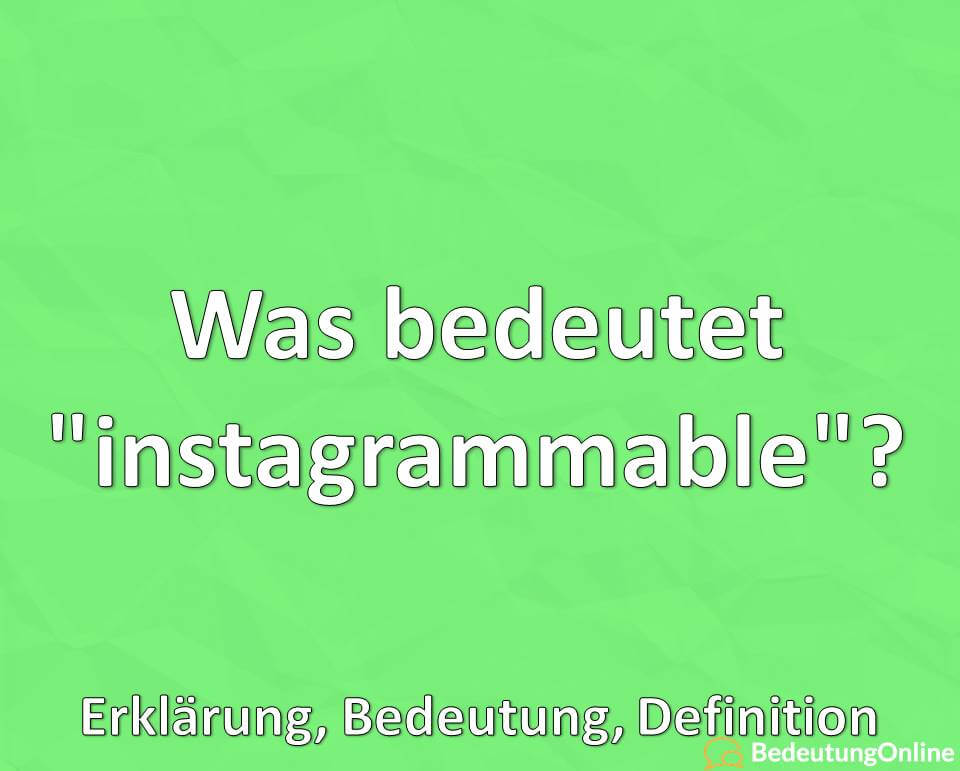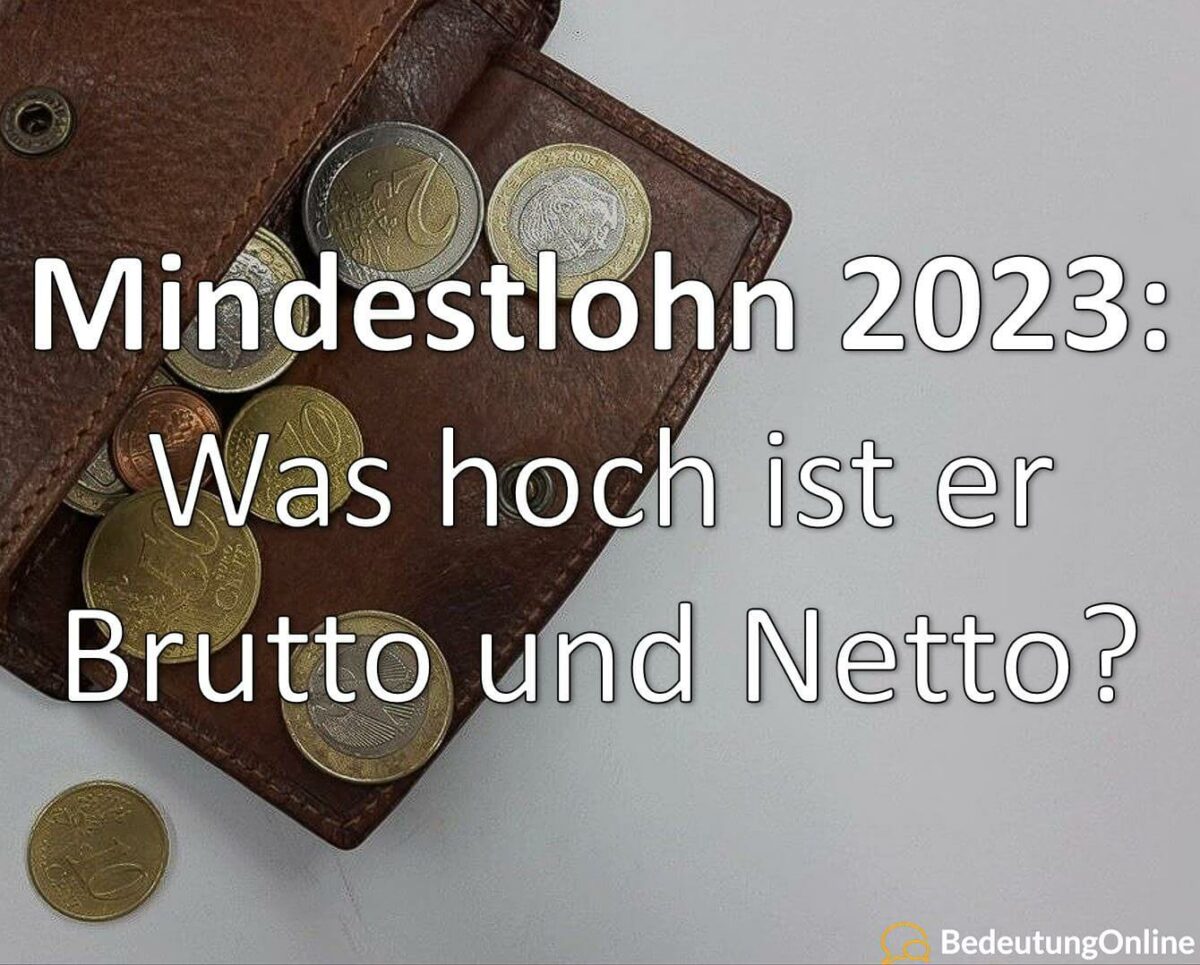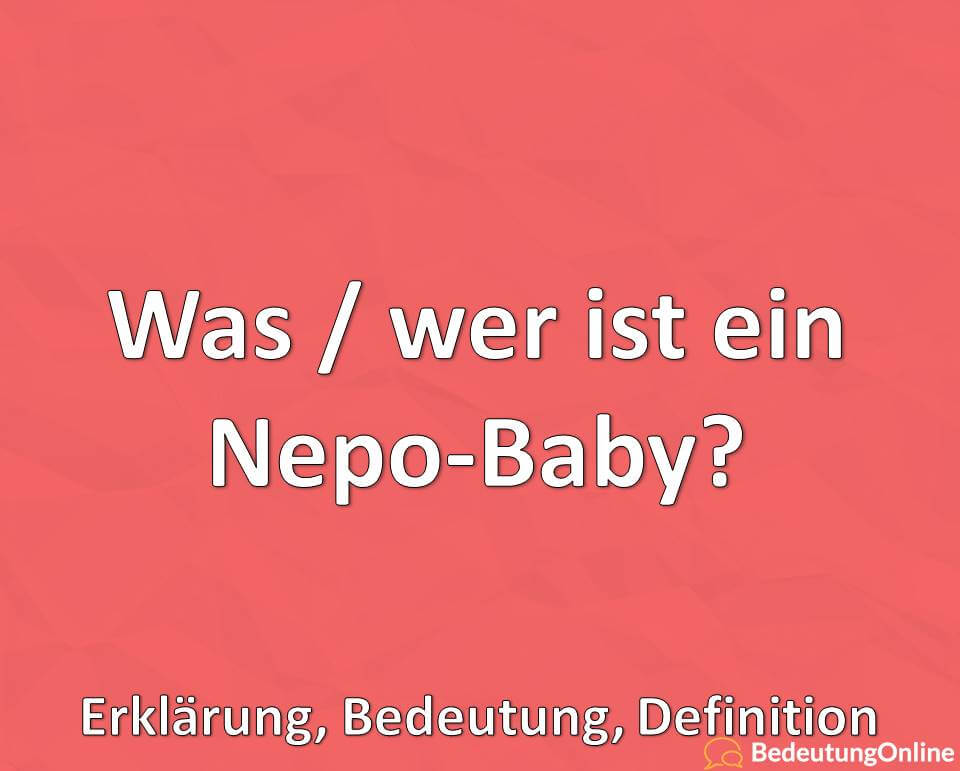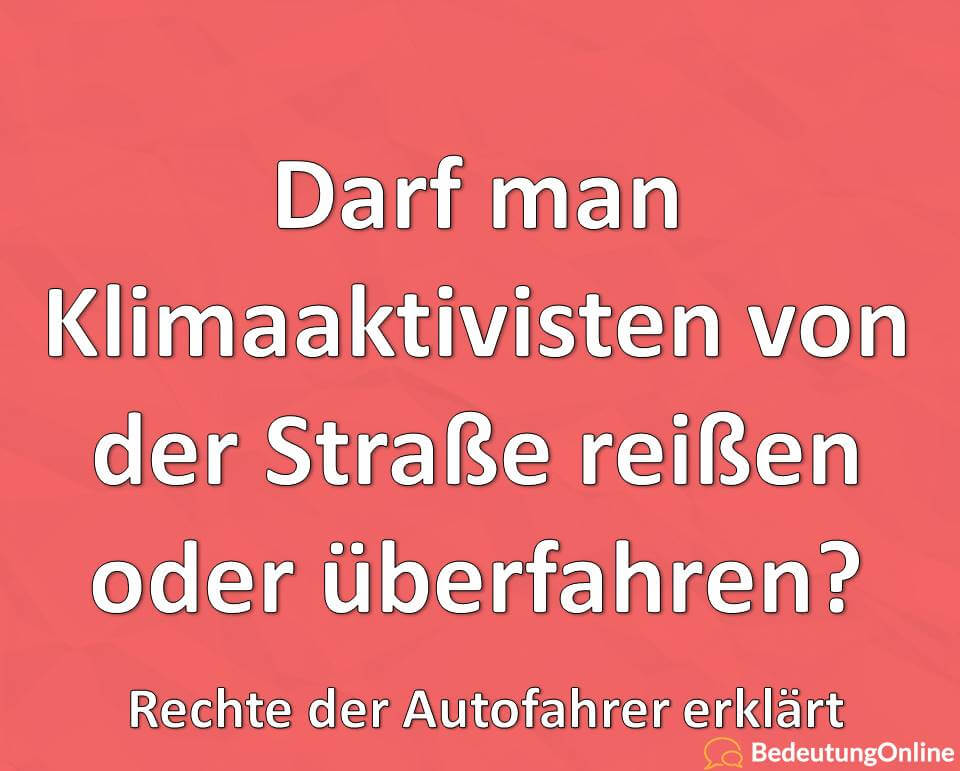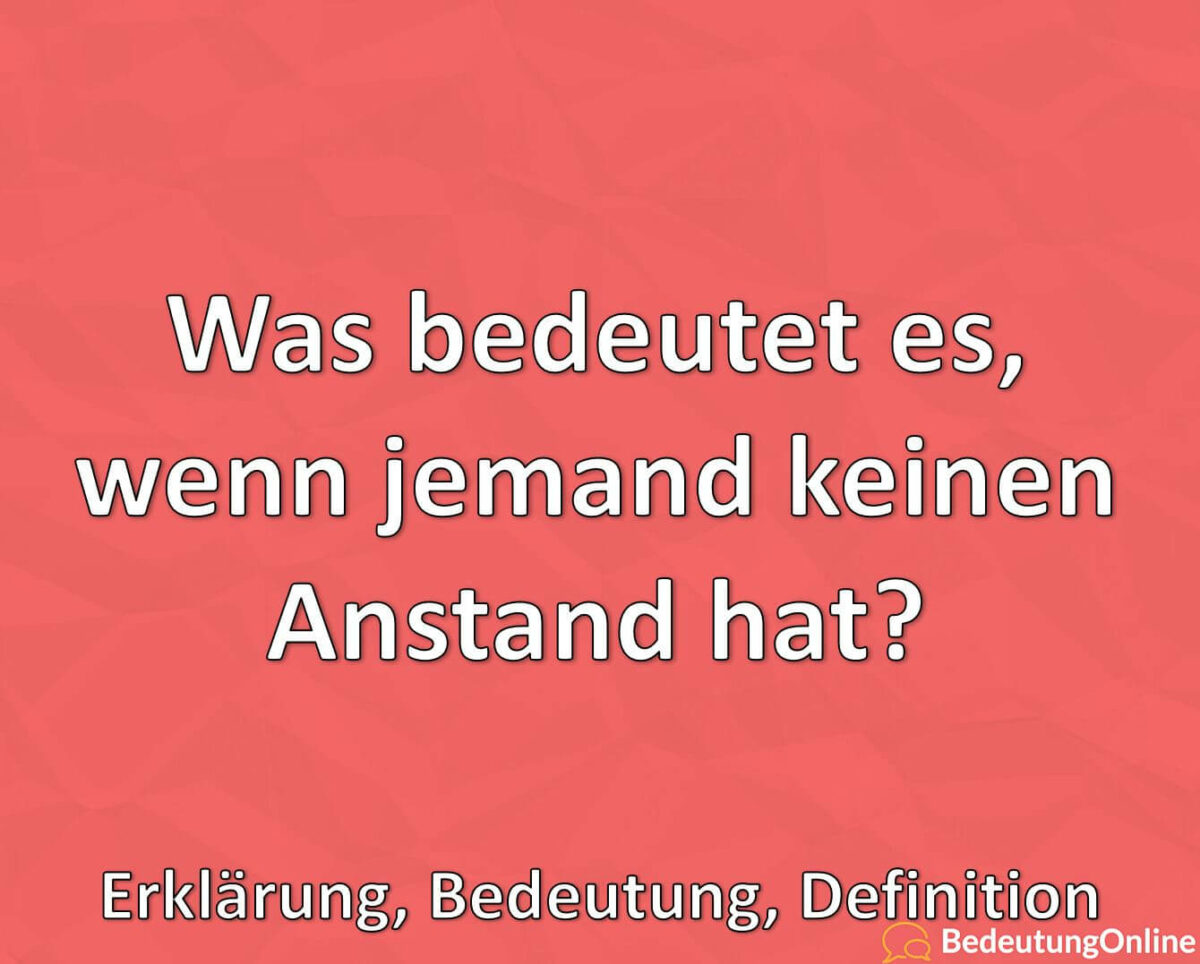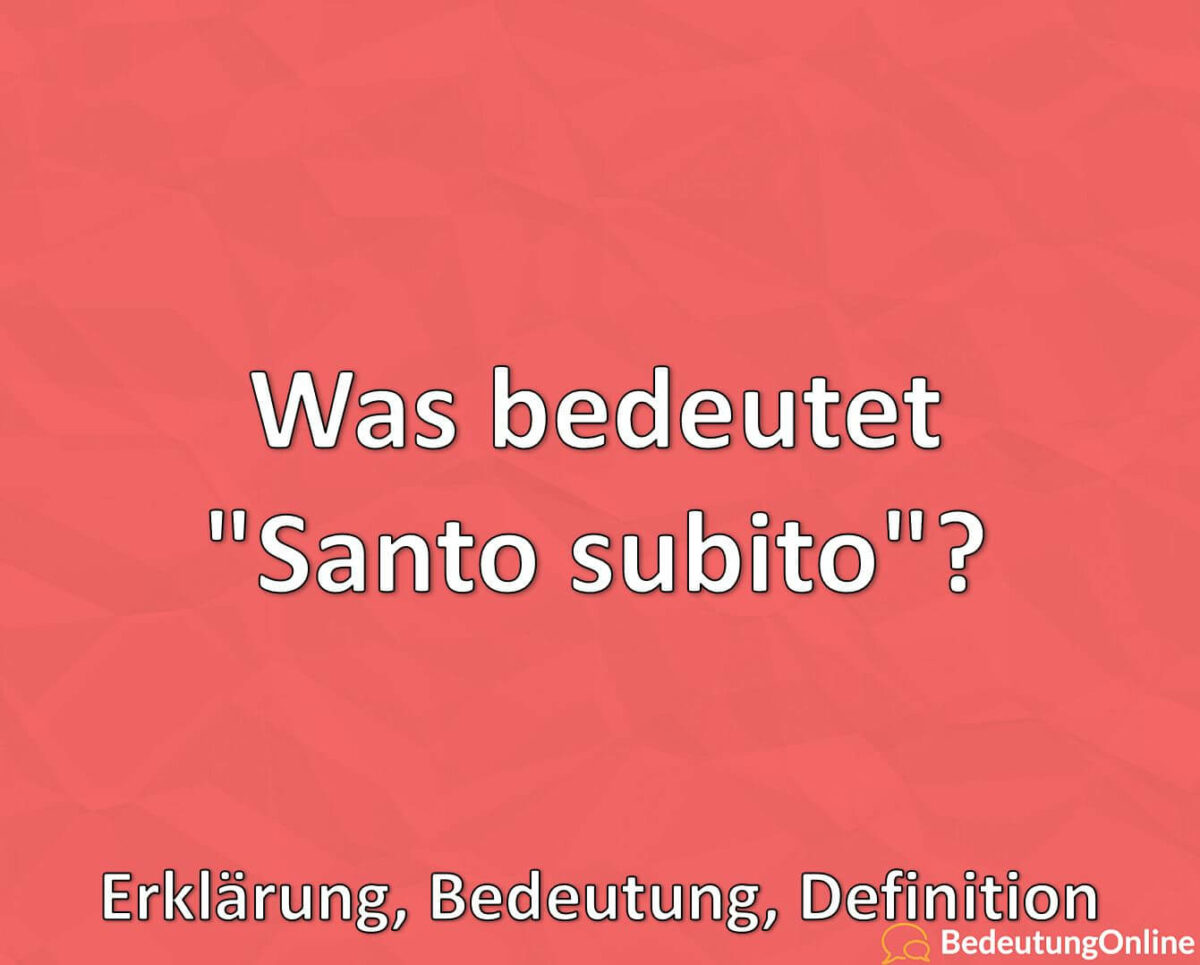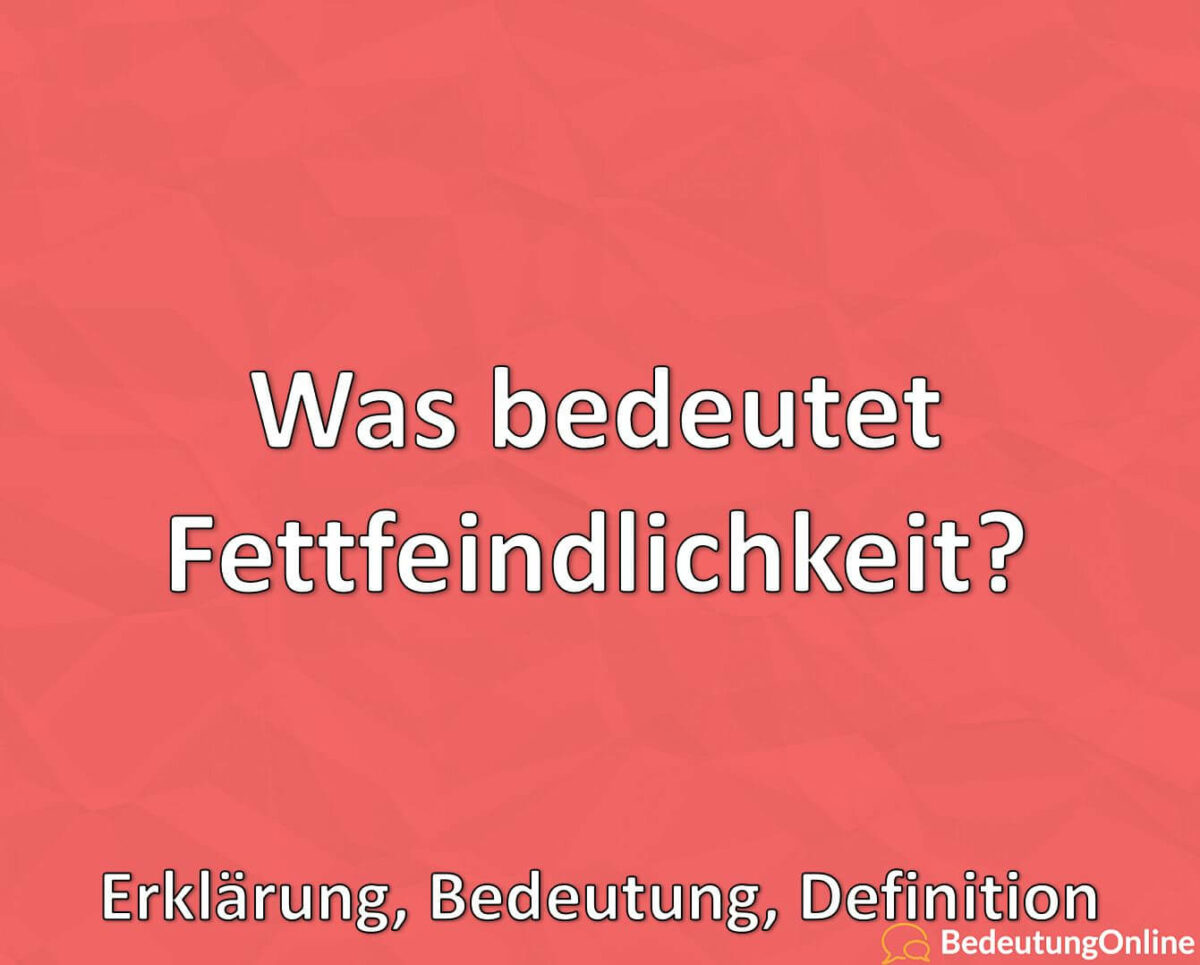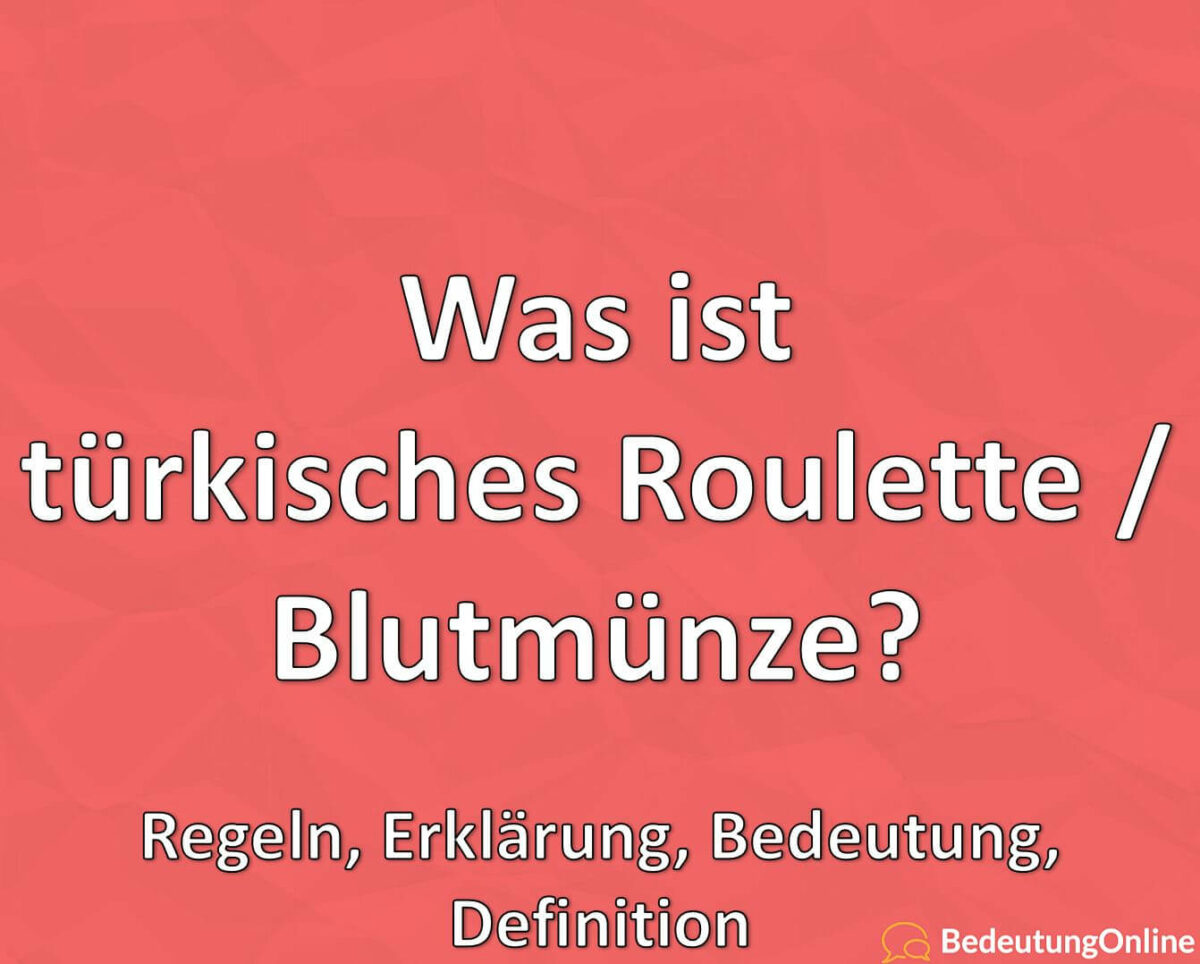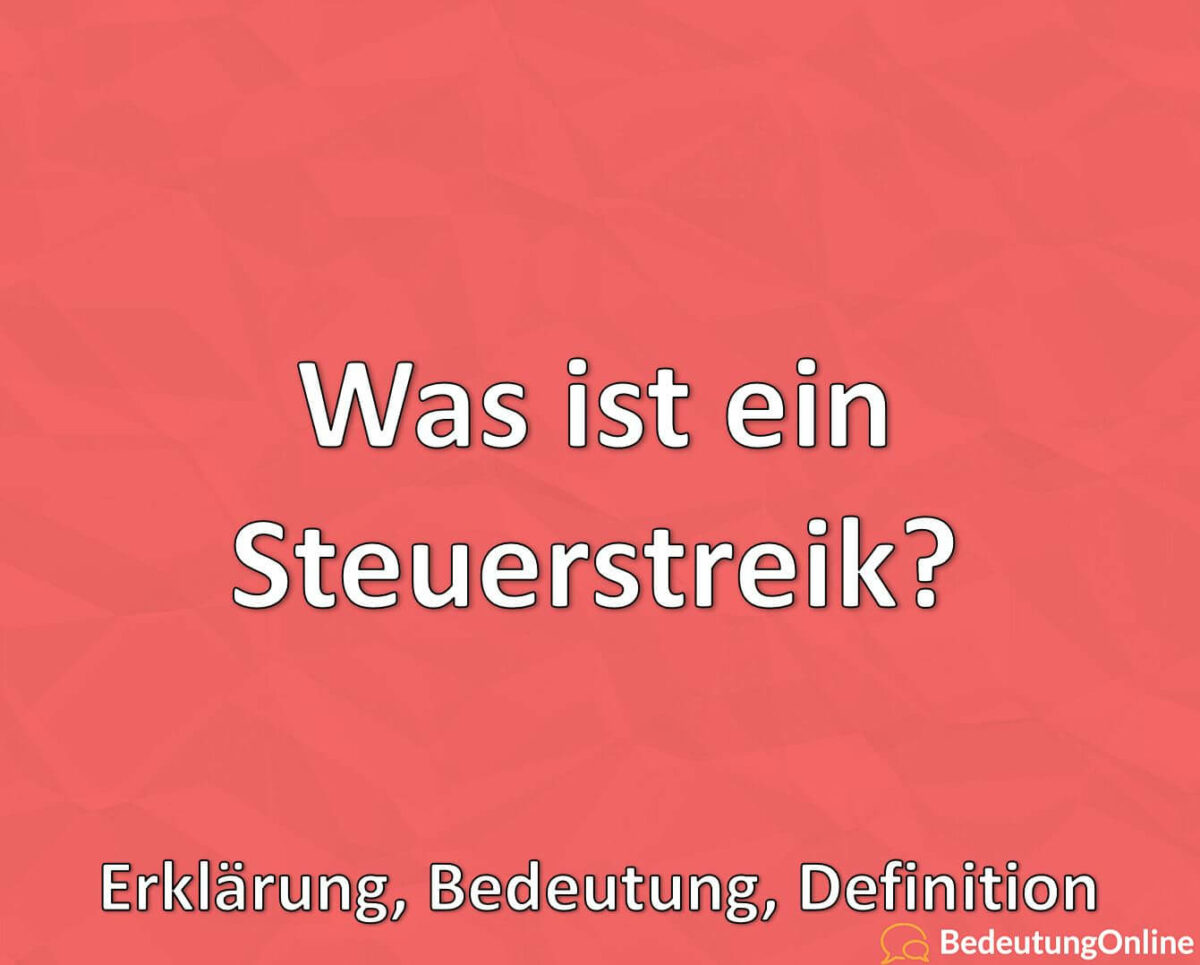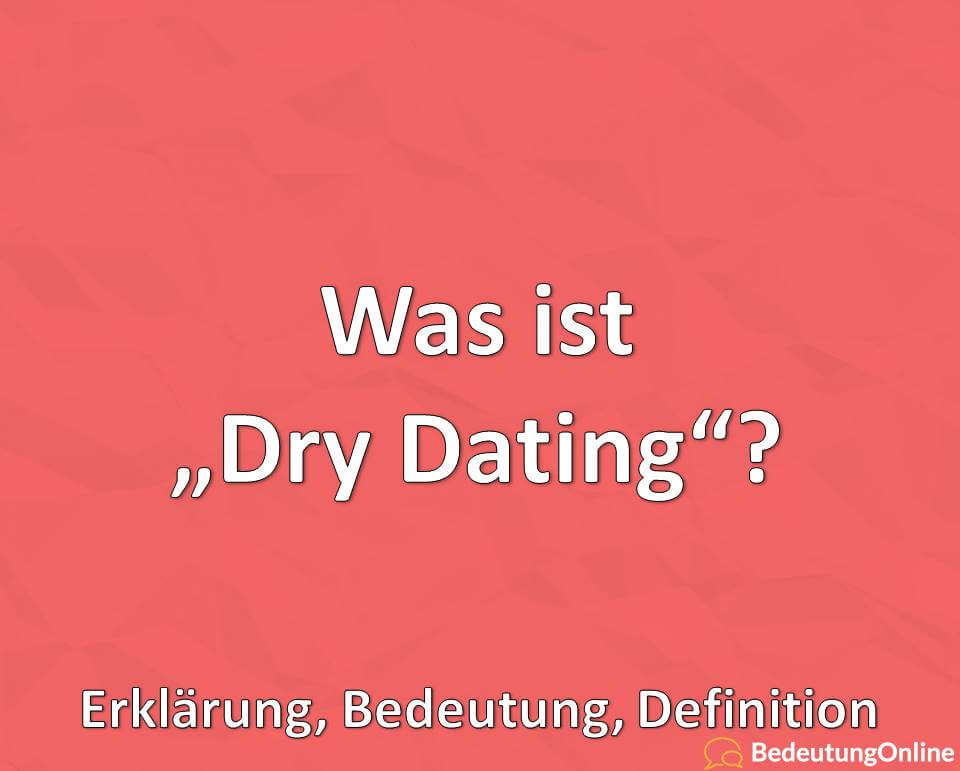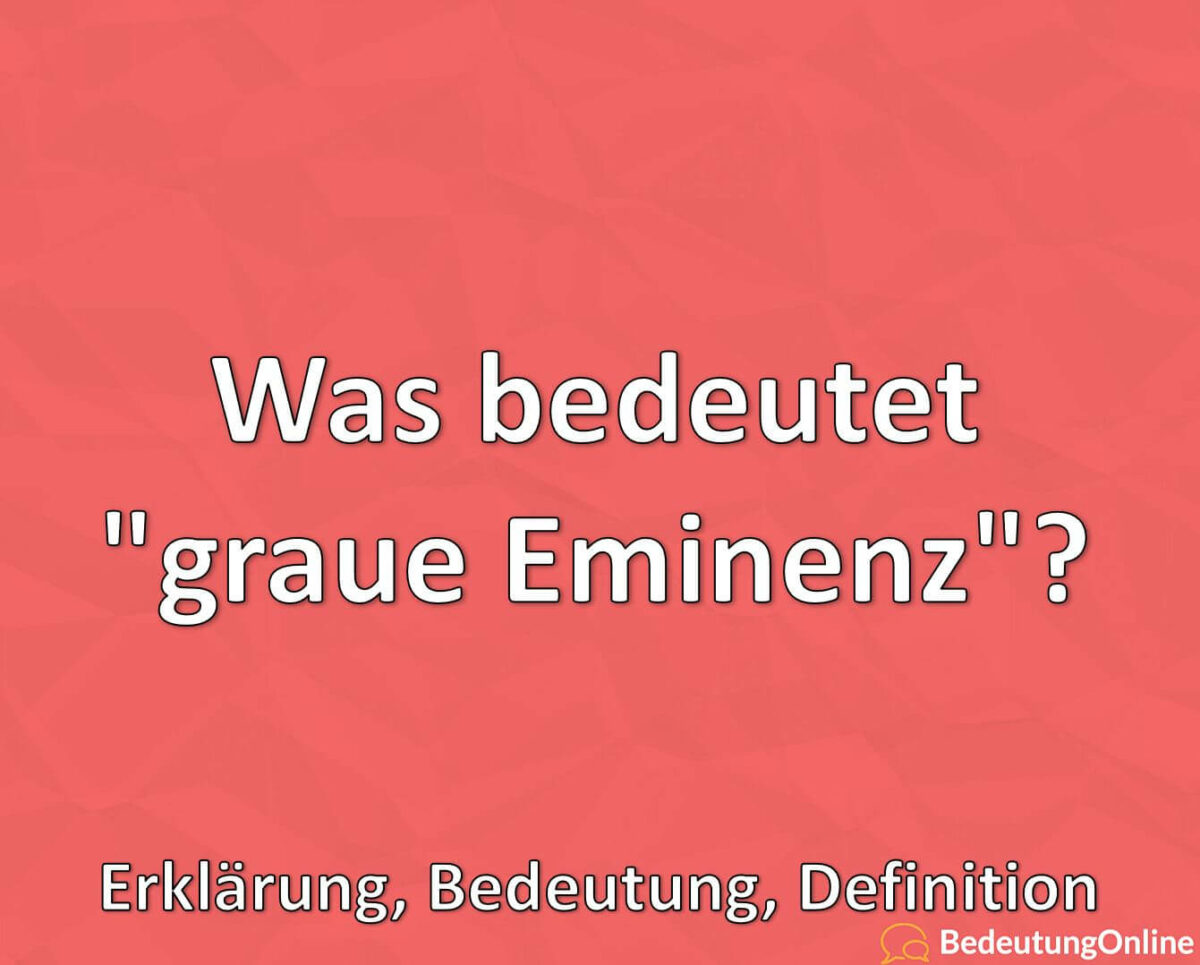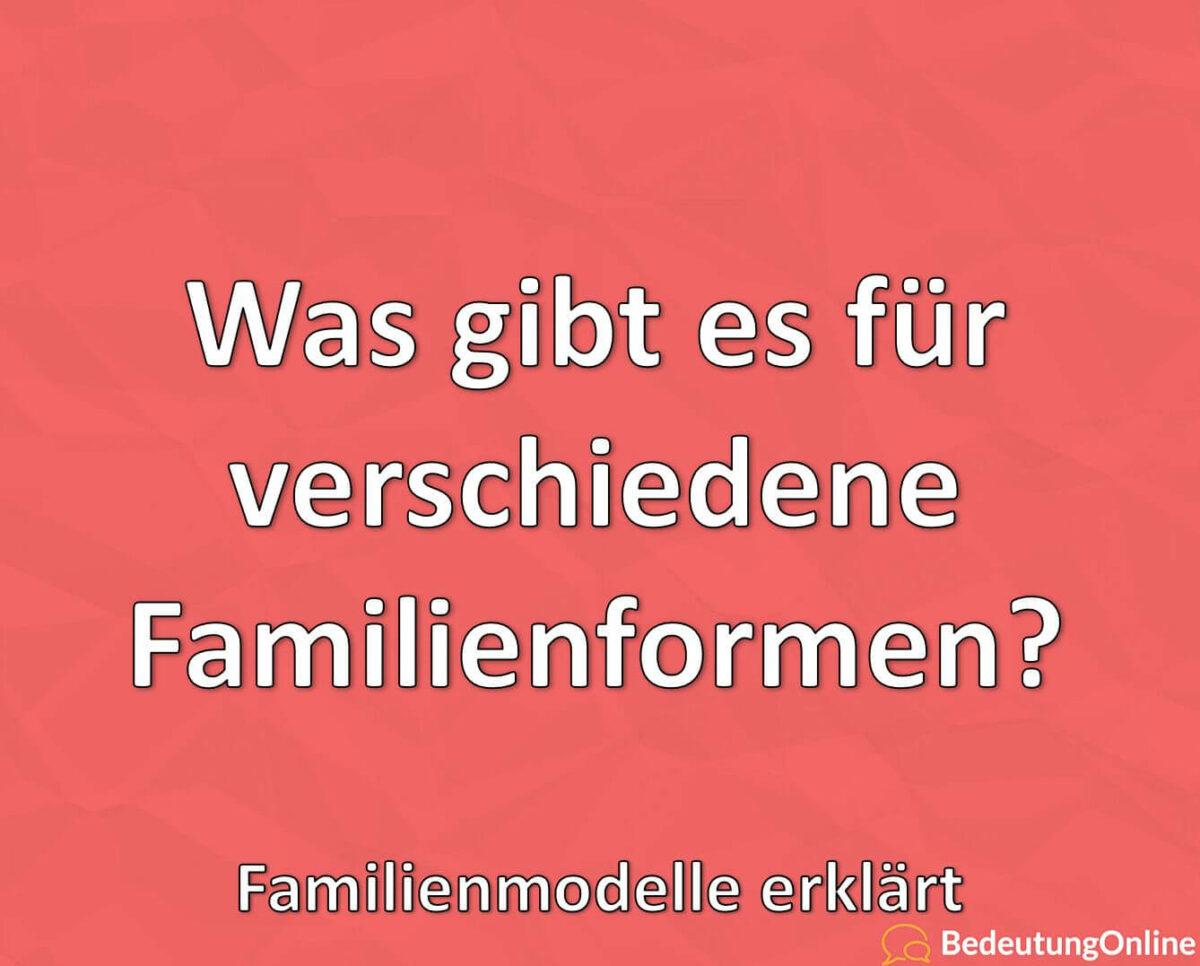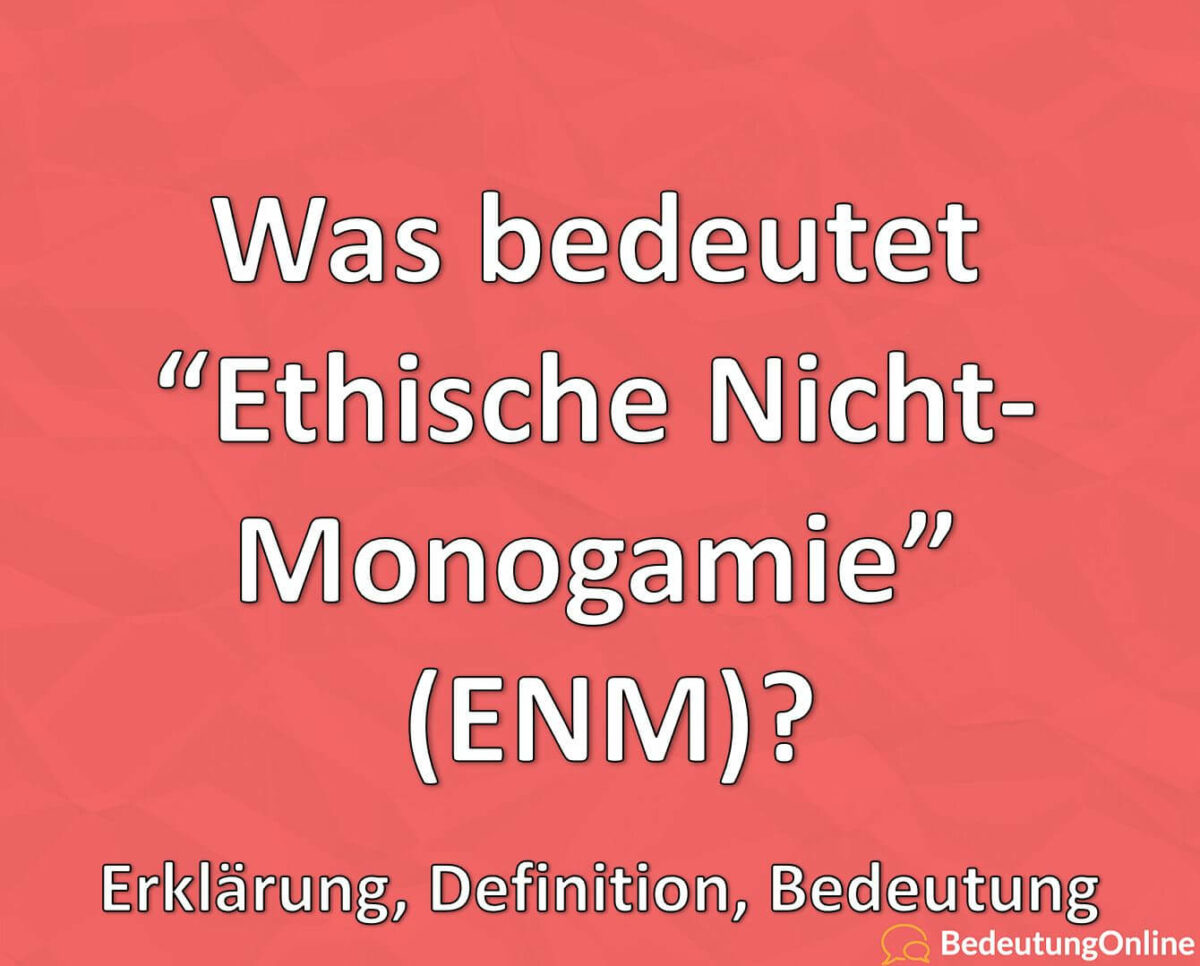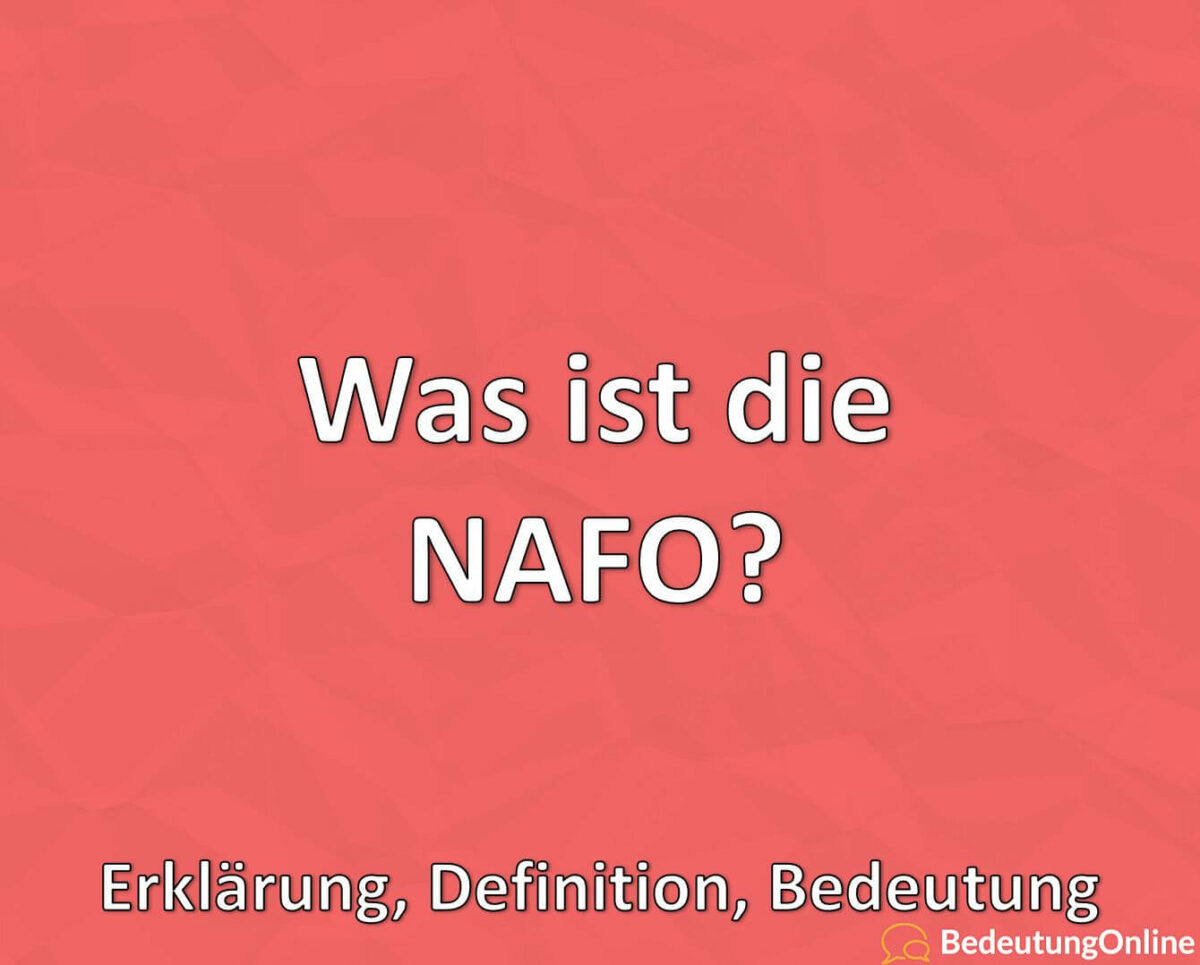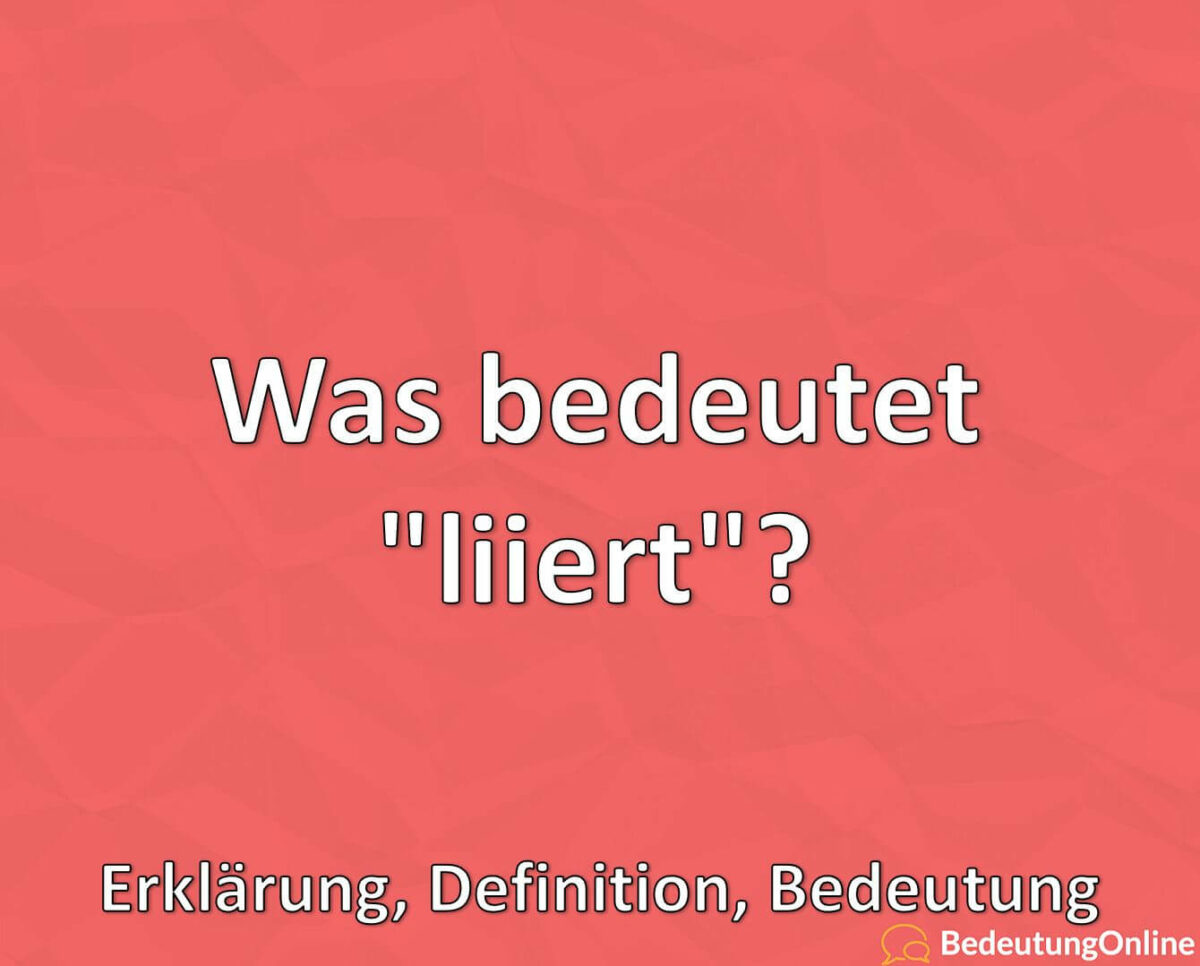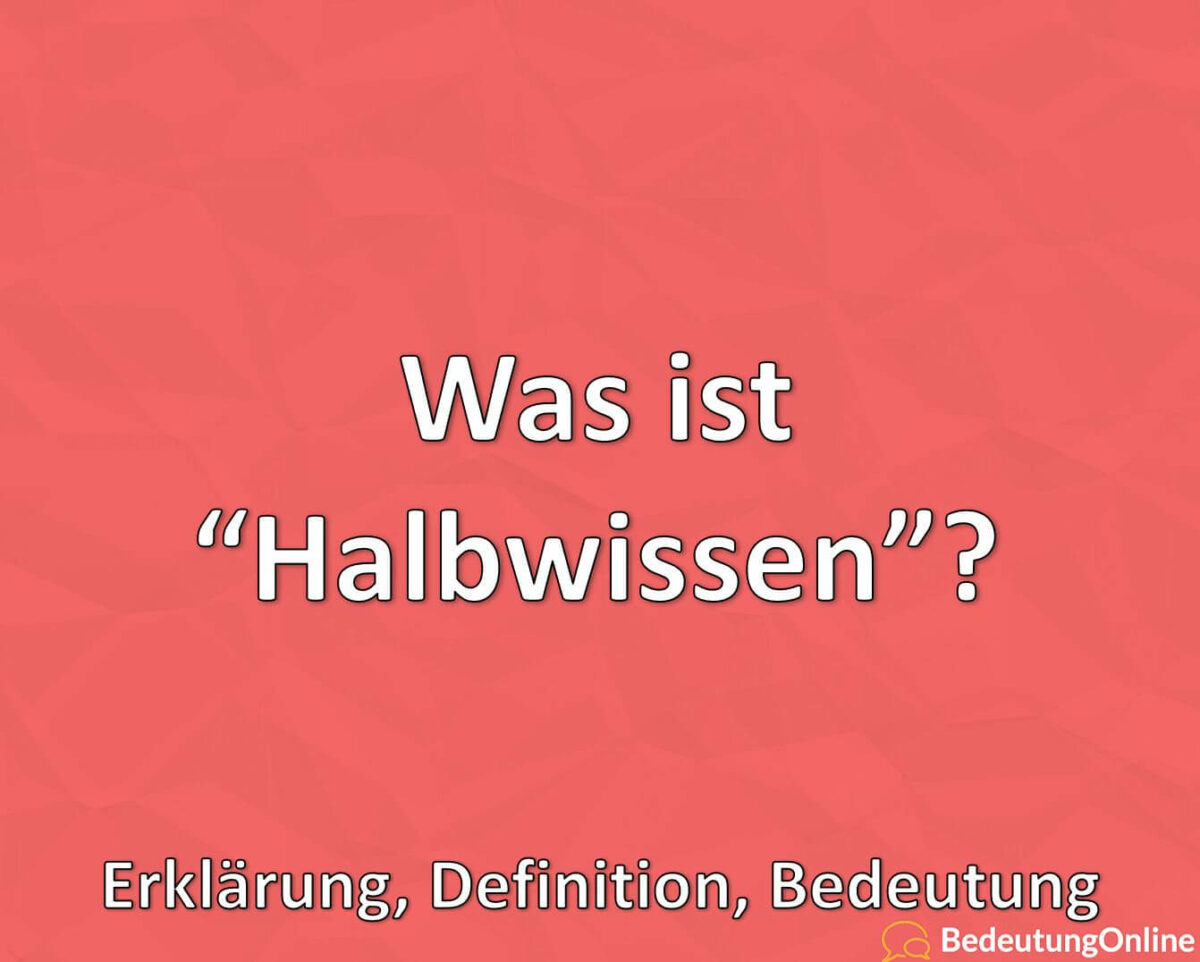Eine Detektei ist ein Büro, dessen Aufgabe darin besteht, anhand von Recherchen, Observationen und Befragungen nützliche Erkenntnisse über Ereignisse oder Zusammenhänge zusammenzutragen. Dabei kommt es darauf an, dass es sich um gerichtlich verwertbares Beweismaterial handelt. Für diese verantwortungsvollen Aufgaben beschäftigt eine Detektei qualifizierte Mitarbeiter*innen, die als Detektiv*innen (lateinisch: detegere „aufdecken, entdecken“) bezeichnet werden.
Definition – die Funktion einer Detektei
Wirtschafts- und Privatdetekteien werden im Auftrag ihrer Kund*innen aktiv. Die Beauftragung erfolgt im Zuge der Aufklärung bestimmter Vorfälle oder Delikte im beruflichen oder privaten Umfeld, die einer Ermittlung bedürfen. Meistens handelt es sich um Rechtsverstöße im arbeits-, zivil- oder strafrechtlichen Sinne. Des Weiteren kommen auch präventive Maßnahmen für eine Zusammenarbeit mit den professionellen Ermittlungsdienstleistern infrage.
Oft entscheiden sich Unternehmen bereits im Verdachtsfall, präventive Maßnahmen einzuleiten, um mögliche Verstöße gegen betriebliche Vereinbarungen festzustellen, aufzuklären oder diesen vorzubeugen. Auch Privatpersonen gehören zu den Klienten einer Detektei. Sie wenden sich an professionelle Detektivdienstleister in ihrer Umgebung, um festzustellen, ob sich eine Vermutung als gerechtfertigt herausstellt. Oft reicht ein Anfangsverdacht nicht aus, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. In diesem Fall können Privatermittler oder Wirtschaftsermittler einer Detektei mit professionellen Methoden zur Aufklärung eines Falles beitragen.
Im Rahmen einer Beweismittelbeschaffung werden Zusammenhänge ermittelt und Beweise gesichert, die dann an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Die Berichterstattung einer Wirtschafts- und Privatdetektei erfolgt objektiv, detailliert und gerichtsverwertbar. Meistens werden die während detektivischer Einsätze gesammelten Observationsberichte durch Bild- und Videomaterial gestützt.
Was macht eine Detektei?
Das Aufgabengebiet einer Detektei umfasst die Beschaffung von Informationen, Recherchearbeiten, Dokumentation von Beweismitteln sowie das Observieren von Personen. Ihren Kunden bietet eine Detektiv-Kanzlei zuvor ein unverbindliches Erstgespräch an. Während dieses Termins können Ermittlungsaufträge und die dafür benötigte Unterstützung durch die Detektei besprochen werden. Als Spezialisten in ihrem Bereich kennen sich Privat- und Wirtschaftsdetekteien mit den Rahmenbedingungen aus und wissen, wie sie ihre Aufgaben effizient und rechtssicher erledigen. Detekteien sind hauptsächlich damit beschäftigt, notwendige Informationen zu beschaffen. Das Aufgabenspektrum reicht von der Aufklärung wettbewerbsrechtlicher, wirtschaftlicher und betrieblicher Verstöße bis zu Ermittlungen unterschiedlichster wettbewerbsrechtlicher Verstöße. Außerdem unterstützt eine Detektei Opfer bei strafrechtlichen Tatbeständen.
Detekteien ermitteln beispielsweise bei Verdacht auf Anlage- oder Kapitalbetrug, bei vermuteter Konkurrenzspionage oder Mitarbeiterverstößen wie Arbeitszeitbetrug, vermeintlichen Krankschreibungen, Diebstählen am Arbeitsplatz, Computerkriminalität, Produktpiraterie und Patentverletzungen. Auf aktive Verbrecherjagd geht eine Detektei jedoch nur selten. Sie agiert vorzugsweise im Hintergrund, um Beweise zu sammeln und diese bei den Ermittlungsbehörden vorzulegen. Dazu wird gründlich recherchiert. Auch Zeugenbefragungen sind möglich. Personen zu observieren ist wesentlicher Bestandteil detektivischer Aufgaben. Verdächtige Personen werden unauffällig beobachtet. Die Tätigkeit einer Detektei umfasst auch Internetrecherchen, Telefonate und Schreibarbeiten. Alle im Rahmen dieser Aktivitäten zusammengetragenen Erkenntnisse werden anhand von Berichten dokumentiert. Damit schriftliche Ausführungen im Gericht als Beweismittel vorgelegt werden können, müssen diese rechtskonform sein.
Was darf eine Detektei und was nicht? Erklärung
Eine Detektei bietet umfangreiche Detektivdienstleistungen. Nach der Beauftragung durch ein Unternehmen oder eine private Person werden die Spezialisten aktiv. Der Dienstvertrag, der zwischen den beiden Parteien zustande kommt, muss dem deutschen BGB (Bundesgesetzbuch) entsprechen. Die vertragsgemäße Abwicklung des Kundenauftrags ist nicht an einen erfolgreichen Abschluss der Detektivarbeit gebunden. Eine Auftragserteilung stellt vielmehr eine Alternative sowie eine zusätzliche Maßnahme zur polizeilichen Überwachung dar. Der Unterschied zwischen Polizei und Detektei besteht darin, dass Privatermittler ihren Kunden verpflichtet agieren und zunächst Informationen einholen, um ihre Auftraggeber zu unterstützen. Eine Detektei befasst sich im Rahmen rechtlicher Grundlagen mit der Informationsbeschaffung und Ermittlungen. Das Ziel ist die Feststellung von Zusammenhängen und das Beibringen gerichtsfester Beweise, die einen Täter*in überführen.
Dabei ist jedoch nicht alles erlaubt. Nicht gestattet ist zum Beispiel das Verwanzen von Wohnungen, Autos und Arbeitsplätzen. Illegal ist zudem das geheime Abhören von Personen. Da diese Aktivitäten nicht dem geltenden Recht entsprechen, sind die daraus gewonnenen Beweise vor Gericht unverwertbar. Dies gilt auch für geheime Videoaufnahmen, sodass einer Detektei nur in Ausnahmefällen und bei konkretem Verdacht die Installierung einer Videokamera in Geschäftsräumen gestattet ist. Mit den in Fernsehen und in den Medien oft dargestellten Abenteuern hat der Alltag einer Detektei nichts zu tun. Die Arbeiten sind an strenge Richtlinien geknüpft. Es müssen rechtliche Vorgaben sowie Bestimmungen der deutschen Detektiv-Verbände eingehalten werden. Als Grundlagen im professionellen Einsatz gelten das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung und die Gewerbeordnung.
Aus welchen Gründen wird eine Detektei beauftragt?
Es gibt zahlreiche Gründe, die dazu führen, dass eine Detektei beauftragt wird. Mithilfe dieser Dienstleister können Mitarbeiter überwacht werden, wenn der Verdacht krimineller Aktivitäten besteht. Von privaten Personen werden Privatermittler beispielsweise zur Klärung partnerschaftlicher Probleme wie Fremdgehen in Anspruch genommen. Eifersucht ist ein häufiges Motiv, um sich an eine Detektei zu wenden. Zwar gibt es einige Unterschiede zwischen Eifersucht und Neid, jedoch können beide Empfindungen zum Auslöser unbedachter oder strafbarer Handlungen werden. Verdacht auf Heiratsschwindel, Mobbing, Nachbarschaftsstreitigkeiten sowie Sachbeschädigung und private Mediation sind die häufigsten Gründe privater Ermittlungen. Im Geschäftsbereich werden Detekteien oftmals zur Klärung bei Industriespionage, Spesenbetrug, Schwarzarbeit, Bewerber- und Mitarbeiterüberprüfung beauftragt.
Wie nennt man die Beschäftigten in einer Detektei?
In einer Detektei arbeiten Privatdetektive und Privatdetektivinnen. Obwohl das Berufsbild eines Privat- oder Wirtschaftsermittlers nicht gesetzlich geschützt ist, verfügen die meisten Mitarbeiter*innen über eine qualifizierte Ausbildung. Viele Privatdetektive können eine Berufserfahrung als Polizeibeamter oder Polizeibeamtin vorweisen. Dies ist jedoch nicht Bedingung für einen Einsatz als private Ermittler. Fest angestellte oder unabhängige Detektivinnen und Detektive müssen rund um die Uhr erreichbar und einsatzbereit sein. Tätigkeiten wie Beweise sammeln, observieren und Sachverhalte recherchieren finden auch an Wochenenden und Feiertagen statt. Von Angestellten einer Detektei wird daher größtmögliche Flexibilität erwartet. Einzige Ausnahme sind die im Einzelhandel arbeitenden Kaufhausdetektiv*innen, die im eigentlichen Sinne nicht als Detektive gelten.
Die Aufgabe von Kaufhausdetektiven besteht ausschließlich darin, das jeweilige Unternehmen vor Diebstählen zu schützen. Detektive müssen sich an ihrem Einsatzort auskennen und über wichtige Kontakte verfügen, um ihre Recherchen durchzuführen. Sie arbeiten allein oder gemeinsam mit Kolleg*innen in Einsatzgruppen. Die verantwortungsvolle Tätigkeit eines Privatermittlers erfordern eine Reihe fachlicher und persönlicher Kompetenzen. Neben einem lupenreinen Führungszeugnis werden Kenntnisse in Befragungstechniken, Ermittlungstechniken und Untersuchungsmethoden erwartet. Ein Privatdetektiv oder eine Detektivin kennen sich mit unterschiedlichen Spionagetechniken aus. Sie verfügen über eine logische und analytische Denkweise, Disziplin und eine schnelle Auffassungsgabe.