Der Begriff „white fragility“ – übersetzt „weiße Zerbrechlichkeit“ – soll nach der Aussage seiner (vermuteten) Erstanwenderin Robin DiAngelo den ambivalenten Umgang von Weißen mit ihrem eigenen mehr oder weniger latenten Rassismus kennzeichnen.
DiAngelo ist eine US-amerikanische weiße Soziologin, die als Dozentin der University of Washington Kurse zu Antirassismus gibt und zum Thema forscht. Ihre Kernthese lautet: Auch im Geiste liberale, politisch eher links stehende Weiße haben rassistische Denkmuster, auf die sie fragil reagieren, wenn man sie damit konfrontiert. Daher lehnen sie häufig pauschal eine Rassismusdiskussion ab. (Siehe auch: Was ist White Privilege?)
White Fragility: Ursachen für latenten weißen Rassismus
Viele Weiße reagieren auf Diskussionen zum Rassismus sehr abwehrend. Es geht ausdrücklich nicht um rechtsextreme bzw. per se rassistische Weiße, sondern um Menschen aus der politischen Mitte der Gesellschaft bis hin zum linken Lager. Laut DiAngelo liegt das daran, dass sich Weiße mit ihrem Weißsein eigentlich nicht befassen. Daher werden die Berichte von schwarzen Menschen (people of color, BiPoC) zu rassistischen Erfahrungen in Zweifel gezogen. Gerade in Staaten mit einer überwiegend weißen Bevölkerung wie Deutschland ist diese Verleugnung weit verbreitet. Dort fängt aber laut Robin DiAngelo die white fragility an. Sie äußert sich nur selten in offenem Rassismus, sondern meistens in Ungläubigkeit, wenn etwa ein Schwarzer berichtet, dass er das sichere Gefühl hatte, die Polizei habe ihn allein deshalb kontrolliert, weil er schwarz ist. Der tiefere Grund für die Ungläubigkeit scheint zu sein, dass Weiße in einer überwiegend weißen Gesellschaft diese Form von Diskriminierung noch nie erlebt haben. Sie werden gelegentlich wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität oder auch ihres Berufes diskriminiert, jedoch niemals allein wegen ihrer Hautfarbe. Daher können sie sich in so eine Erfahrung nicht einfühlen. Die Tatsache von Rassismus zu negieren und auf dessen Aufzeigen so dünnhäutig zu reagieren ist aber auch eine Form von Rassismus.
Die Folgen von white fragility
Weiße Zerbrechlichkeit führt dazu, die einschlägigen Erfahrungen von people of colour mit Rassismus so stark auszublenden, dass der rassistische Status quo erhalten bleibt. Die people of color reden mit ihren weißen Freunden alsbald nicht mehr über rassistische Alltagserfahrungen. Ein rassistischer Status quo ist dann gegeben, wenn people of color überall Rassismus erleben. Dieser kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft, was den Vorstellungen der meisten Weißen zuwiderläuft. Sie stellen sich Rassisten als böse Individuen vor, die absichtlich rassistische Ressentiments pflegen und im Alltag auch umsetzen, indem sie beispielsweise als Vermieter einen schwarzen Mieter ablehnen, als Verkäufer people of colour ungenügend bedienen oder als Fahrgast einer Straßenbahn gern einer älteren weißen, aber keiner älteren schwarzen Dame eine Sitzplatz anbieten. Doch solche offenkundigen Fälle von Rassismus sind eher selten, auch wenn sie schnell durch die Medien publiziert werden. Alltagsrassismus läuft subtiler ab. Jedermann möge sich fragen, inwieweit er sich mit people of colour anfreundet, wenn ihm diese Freundschaften denselben Mehrwert wie die Freundschaften mit Weißen bringen könnten. Die wenigsten Weißen gehen unvoreingenommen solche Freundschaften ein, für die es beispielsweise an Universitäten, aber auch in vielen Firmen und Nachbarschaften ausreichend viel Gelegenheit gibt. Dabei bezeichnen sie sich aber nicht als Rassisten. Doch werden sie auf diesen Umstand angesprochen, reagieren sie darauf mit white fragility. Da sie damit jede Diskussion abwürgen, zementieren sie den rassistischen Status quo.
White Fragility: Woher kommt weißer Rassismus?
Das weiße Überlegenheitsgefühl wurde in Jahrhunderten des Kolonialismus und der Sklaverei zementiert. Die seit Jahrhunderten gepflegten Vorurteile, Weiße seien per se besser als Schwarze, lassen sich aus den Köpfen nicht so leicht herausbekommen.
Es ist mit ihnen wie mit vielen anderen, darunter auch gegenläufigen Vorurteilen: Sie halten sich durch Bequemlichkeit, was man als internalisiert bezeichnet. Ein umgekehrtes Vorurteil lautet beispielsweise, Schwarze, vor allem Afrikaner, seien bessere Sportler oder Musiker als Weiße (aber keinesfalls bessere Mathematiker oder Literaten). All das ist erwiesenermaßen falsch. Vorurteile entstehen natürlich zweckgerichtet. Das Vorurteil, Weiße seinen besser als Schwarze, vor allem als Afrikaner, musste in Zeiten der Sklaverei gepflegt werden, weil sonst an sich anständige Menschen nicht noch im 19. Jahrhundert in den USA Sklaven gehalten hätten. Das musste irgendwie legitimiert werden. Wie das funktionierte, schildert sehr treffend Mark Twain in seinen Romanen „Tom Sawyer“ (1876) und „Huckleberry Finn“ (1884). Beide Romane entstanden nach der Abschaffung der Sklaverei (ab 1865), spielen aber in den Südstaaten etwa in den 1830er- bis 1840er-Jahren, als diese dort noch existierte.
Tom und Huck verhelfen im zweiten Roman dem entlaufenen Sklaven Jim zur Flucht, doch vor allem Huck, der eigentlich ein neben dem Gesetz stehender Landstreicherjunge ist, wird dabei zunächst von schrecklichen Gewissensbissen geplagt: Er kennt die Besitzerin des Sklaven, sie hatte ihm einst für eine Weile großzügiges Obdach gewährt. Nun glaubt er, diese Frau zu bestehlen, wenn er Jim bei der Flucht unterstützt. Mit diesem wiederum hat er sich stark angefreundet und dabei seine Probleme kennengelernt, nämlich die Versklavung der kompletten Familie. Am Ende entscheidet sich Huck gegen sein Gewissen und für Jim, hinterfragt aber nicht die Berechtigung von Sklaverei. Bezeichnenderweise fühlt er sich allerdings auch nicht besonders großzügig, womit Mark Twain auf eine besonders subtile Spielart des Rassismus verweist, die bis heute gerade bei Liberalen und Linken verbreitet ist: Sie glauben, wenn sie einem Schwarzen demonstrativ die Hand hinstrecken und ihn kommunikativ auf ihre Augenhöhe heben, würden sie sich antirassistisch gebärden. Natürlich ist das Unfug. Vielleicht ist ja der Schwarze viel klüger als sie selbst. Er benötigt keine Großzügigkeit dieser Sorte. Die weiße Person verfügt über keinerlei angeborene Vorzüge, so wenig wie ein Adliger darüber verfügt.
Robin DiAngelo zur internalisierten weißen Überlegenheit
DiAngelo verweist darauf, dass sich durchschnittliche Weiße beim Begriff der weißen Überlegenheit ein Mitglied des Ku-Klux-Klan (in den USA) oder einer rechtsextremen Gruppierung (in Europa) vorstellen. Jedoch versteht die moderne Soziologie unter internalisierter weißer Überlegenheit das Phänomen, dass überwiegend weiße Gesellschaften mehrheitlich das Signal aussenden, dass Weiße eine Norm, Schwarze / PoC die Abweichung davon repräsentieren. Genau das geschieht auch, wenn people of colour besonders bevorzugt behandelt werden. In diesem Fall ist der Rassismus latent zu spüren, er schmerzt, er schädigt allerdings nicht unmittelbar. Wenn allerdings Polizisten Racial Profiling betreiben, wirkt er extrem schädlich, ebenso wenn Schwarze schlechter eine Wohnung, einen besseren Job oder eine ausreichende Gesundheitsversorgung erhalten. Sollten Weiße aber ihre white fragility überwinden, könnten sie ihre schwarzen Mitbürgerinnen und Mitbürger endlich als das behandeln, was sie sind: vollkommen gleichberechtigte Mitmenschen.
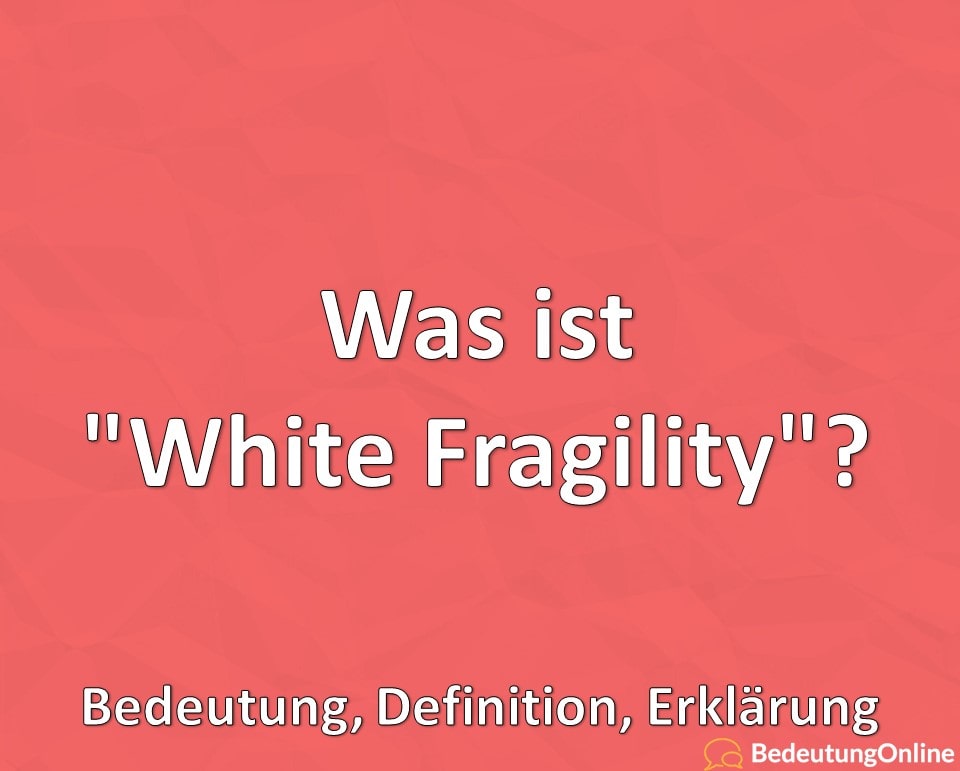
Ich würde den Begriff „Farbig“ nicht verwenden, weil dieser auch rassistisch ist. Daher PoC oder Schwarz.
Farbige/farbig ist ein kolonialistischer Begriff und negativ konnotiert. Eine Alternative ist die Selbstbezeichnung People of Color (PoC, Singular: Person of Color). Begriffe wie „Farbige“ oder „Dunkelhäutige“ lehnen viele People of Color ab. Die Initiative „der braune mob e. V.“ schreibt: „Es geht nicht um ‚biologische‘ Eigenschaften, sondern gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten.“ Um das deutlich zu machen, plädieren sie und andere dafür, die Zuschreibungen Schwarz und Weiß groß zu schreiben.*
Danke, habe ich überarbeitet!
VG
Pierre von BedeutungOnline.de