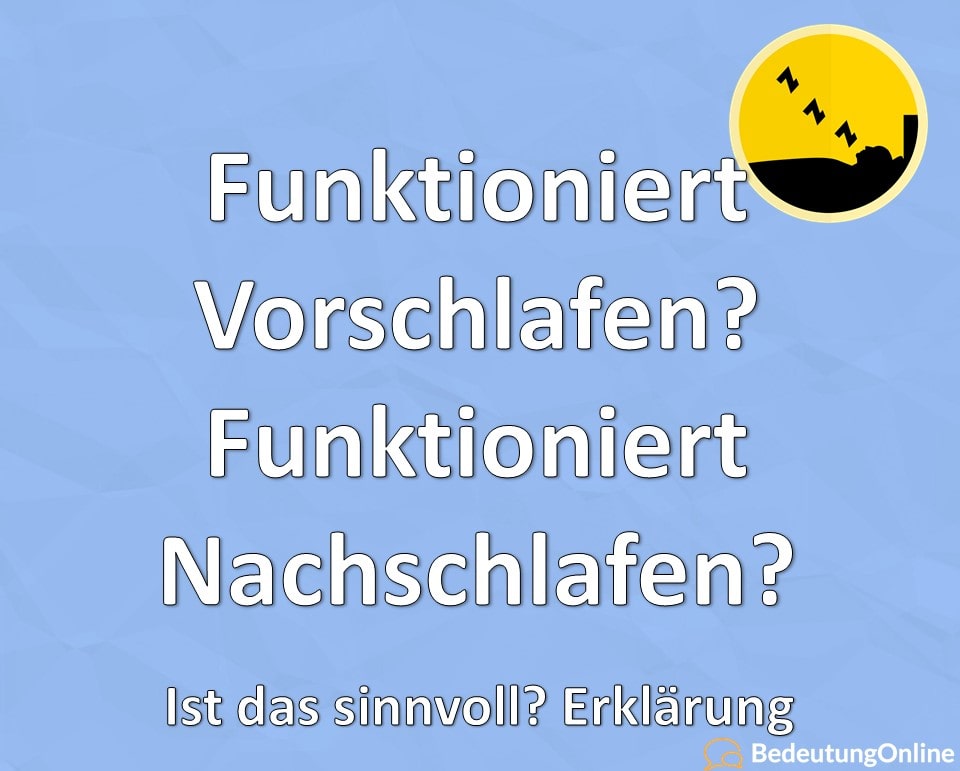„Nachschlafen“ soll nach einer schwedischen Studie ganz gut funktionieren, „vorschlafen“ eher nicht oder nur wenig. Das Stockholmer Karolinska-Institut hat hierzu eine Langzeitstudie unter 44.000 Schweden durchgeführt.
Die wichtigsten Ergebnisse zum Vorschlafen und Nachschlafen
Laut der schwedischen Studie ist es möglich, am Wochenende Schlafdefizite nachzuholen, ohne dass dabei gesundheitliche Schäden infolge von Schlafmangel auftreten. Ausreichendes Vorschlafen verneinen die schwedischen Wissenschaftler praktisch grundsätzlich. Es gibt aber auch andere Studienergebnisse zu diesem Thema (siehe weiter unten).
Schlafmangel und Nachschlafen
Dauerhafter Schlafmangel macht krank und verkürzt sogar signifikant die Lebenszeit. Doch es gibt viele Szenarien, in denen es uns an Schlaf mangelt – sei es wegen Überlastung, sei es wegen einer Fernreise mit dem Flugzeug. Wenn jemand im Alltag einfach nicht zum Schlafen kommt, kann er das laut der schwedischen Studie durchaus am Wochenende nachholen. Das Forscherteam unter der Leitung von Torbjörn Åkerstedt hatte die Studie im Jahr 1997 begonnen und die Lebenserwartung der Probanden ermittelt. Die Forschungsreihe lief bis zum Jahr 2010, ab 2011 wurden die Ergebnisse publiziert. Mit dieser umfangreichen Datensammlung ließ sich evaluieren, wie sich die Schlafgewohnheiten auf die Gesundheit und die Lebenszeit auswirken. Die Referenzzeit für eine normale Schlafdauer beträgt beim Erwachsenen sieben Stunden. Das gilt etwa bis zum 65. Lebensjahr, danach schlafen wir weniger. Die jüngeren Studienteilnehmer, die angegeben hatten, permanent kaum über fünf Stunden Schlaf hinauszukommen, verstarben im Durchschnitt etwas früher. Das betraf aber nicht die TeilnehmerInnen, die den fehlenden Schlaf am Wochenende nachgeholt hatten: Ihre Lebenserwartung verkürzte sich im statistischen Mittel nicht. Übrigens ist auch zu viel Schlaf (über neun Stunden täglich) offenbar ungesund. Dr. Ingo Fietze von der Berliner Charité, der das dortige Schlafzentrum leitet, vermutet die Untergrenze bei sechs, die Obergrenze bei neun Stunden. Alles darunter und darüber steigert die Risiken für Krebs und Diabetes. Außerdem leide sehr die Psyche, so der deutsche Wissenschaftler.
Weitere Studien zum Vorschlafen und Nachschlafen
Nachschlafen wird allgemein als funktionierend bezeichnet. Das bestätigt unter anderen der Chef der Münsteraner Uniklinik Peter Young, ein Experte für Schlafmedizin. Jedoch gebe es dabei Grenzen: Niemand könne wochentags extrem wenig und dann am Wochenende extrem viel schlafen. Beim Vorschlafen ergibt sich durch weitere Studien ein differenzierteres Bild. Diese führt zum Beispiel fortwährend die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und -medizin durch. So ist sich der DGSM-Vorsitzende Alfred Wiater sicher, dass sehr gut ausgeschlafene Menschen durchaus ein nachfolgendes Schlafdefizit (über sehr wenige Tage) recht gut kompensieren können. Das klappe nur nicht über längere Zeiträume. Jedoch sei grundsätzlich ein wenig Vorschlaf schon hilfreich, so Wiater.
Warum ist das Vorschlafen so schwierig?
Dr. Ingo Fietze von der Charité und der Münsteraner Experte Dr. Young merken hierzu einheitlich an, dass sich der Körper weigert, vorsätzlich zu viel zu schlafen. Wir liegen dann bestenfalls nur noch im Bett. Gesunde Menschen wachen automatisch nach ausreichendem Schlaf auf. Wann dieser stattfindet, ist übrigens egal, wenn nur die Schlafumgebung ruhig und dunkel genug ist. Dass wir uns vor Mitternacht den besten Schlaf holen, ist nach Erkenntnissen der deutschen Wissenschaftler ein Mythos. Wichtig sei allerdings, dass wir bis zur vierten Stunde am besten schlafen. In dieser Zeit sollten wir also nicht gestört werden.
Schlaf: Erkenntnisse aus dem Jetlag
Der Jetlag entsteht, wenn wir mit dem Flieger von Ost nach West oder umgekehrt unterwegs sind und dabei stark die Zeitzonen wechseln. Das bringt unsere innere Uhr durcheinander. Abgesehen davon, dass Jetlag als sehr unangenehm empfunden wird, bringt er uns auch einige wesentliche Erkenntnisse zum Vor- und Nachschlafen: Der Langstreckenflug nach Osten verursacht nämlich einen stärkeren Jetlag als die entgegensetzte Richtung. Wenn wir der Sonne entgegenfliegen, bedeutet das: Unser Körper wird auf einen früheren Tagesanfang verschoben. Das mögen wir gar nicht. Beim Flug nach Westen hingegen dehnt sich der Tag immer mehr in die Länge. Doch länger aufbleiben stört uns nicht so sehr. Wir holen das dann später mit etwas mehr Schlaf nach. Gegen den Flug nach Osten hätten wir vorschlafen müssen, doch das gelingt einfach nicht. Wir können aber im Flieger beim Ostflug ruhig schlafen. Beim Westflug hingegen sollten wir das unterlassen und lieber später nachschlafen. Damit kommen wir dem Jetlag am besten bei.