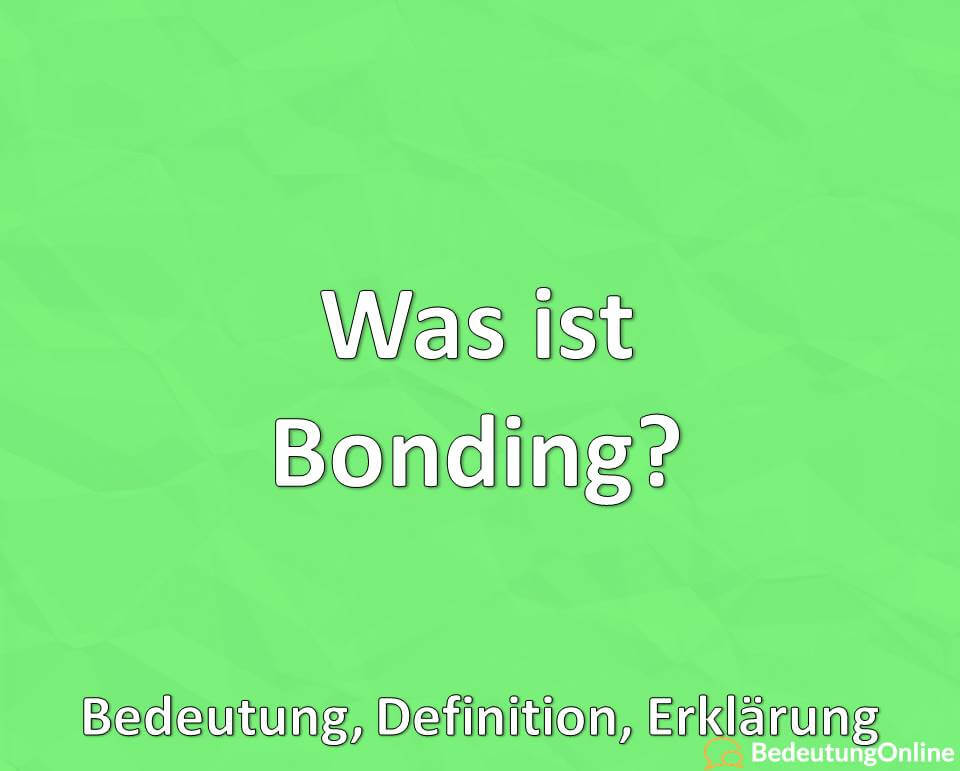Bei Bindungen aller Art zwischen Menschen sind immer tiefe Emotionen im Spiel. In diesem Beitrag wird ausführlich erklärt, was „Bonding“ ist.
Was ist Bonding? Bedeutung, Definition, Erklärung
Der englische Ausdruck Bonding bezeichnet generell Bindungen aller Art. In der Regel bezieht sich Bonding dabei jedoch auf eher enge, emotionale und zwischenmenschliche Bindungen zwischen zwei oder auch mehreren Individuen und deren Entstehung sowie Entwicklung. Zumeist findet Bonding in Familien, Freundes- und Bekanntenkreisen sowie in Gruppen wie Sport- und anderen Vereinen statt. Bonding beschreibt im weiteren Sinne auch den Prozess, wenn gleichgesinnte Menschen Zeit miteinander verbringen. Bonding bzw. Bindung ist stets eine gegen- bzw. wechselseitige und interaktive Handlung, die sich von einfacher Sympathie unterscheidet und die Pflege sozialer Bindungen beinhaltet. Mit Bonding/Bindung werden vor allem auch romantische oder platonische Beziehungen unter dem Vorzeichen von Liebe, Vertrauen und Zuneigung beschrieben. Hierbei kann es sich sowohl um Sexualpartner als auch Eltern und Kinder sowie andere Verwandte handeln. In der Soziologie steht männliche Bindung für den Aufbau von Beziehungen unter Männern durch gemeinsame Aktivitäten, wobei weibliche Bindung sich eher auf die Bildung enger persönlicher Beziehungen zwischen Frauen bezieht.
Bonding: Berühmte Philosophen und Dichter beschäftigten sich intensiv mit Bindungen
Der griechische Philosoph Platon vertrat im 4. Jahrhundert vor Christus die Ansicht, dass grundsätzlich Liebe die Basis jeglicher Bindungen in menschlichen Gesellschaften sei. Im Dialog „Symposion“ erklärt der Erzähler Eryximachus, dass Liebe einfache Anziehung zur menschlichen Schönheit übersteige und diese bei Tieren und Pflanzen sowie im gesamten Universum vorkomme. Die Liebe lenke alles, was im Götterreich als auch demjenigen der Menschen geschähe. Eryximachus begründet diese Sicht damit, dass gegensätzliche Elemente wie Nässe und Trockenheit durch richtige Liebe harmonisch miteinander verbunden sind, während jedoch grobe, impulsive und vulgäre Liebe Tod und Zerstörung verursache. Höhere Liebe steuere demzufolge Beziehungen zwischen Gegensätzen im Laufe des Daseins und erzeuge Harmonie, impulsive und niedere Liebe hingegen schaffe Disharmonie. Platon schlussfolgert daraus, dass auf das Gute und die Gerechtigkeit gerichtete Liebe für Glückseligkeit, enge Bande innerhalb der menschlichen Gesellschaft und Eintracht der Menschen mit Göttern sorge. Mitte des 17. Jahrhunderts verurteilte der niederländische Philosoph Spinoza Impulsivität in Bindungen und pries Mäßigung sowie Kontrolle von Gefühlen als beste Basis für gute menschliche Bindungen. Johann Wolfgang von Goethe wiederum verglich 1809 in seiner berühmten Novelle „Wahlverwandtschaften“ gute und starke Eheverbindungen mit reaktiven chemischen Prozessen.
Im Tierreich gelten hinsichtlich von Bindungen andere Regeln als beim Menschen
Bindung wird in der Literatur vor allem unter dem thematischen Schwerpunkt Paarbindung behandelt. Der Begriff Paarbindung wurde 1940 erstmals in Bezug auf monogam oder relativ monogam lebende Vogelpaare erwähnt. Monogamie als langfristige Bindung oder Paarung über den kurzen Akt der Kopulation hinaus ist mit etwa 90 Prozent bei Vogelarten recht häufig anzutreffen, bei Säugetieren jedoch mit lediglich drei Prozent relativ selten. Monogamie als Paarbindung ist im Vergleich zur deutlich häufigeren Polygynie bei den meisten Primatenarten ähnlich gering, wobei Primaten jedoch oftmals lang anhaltende und stabile soziale Beziehungen in deren jeweiligen Gruppen und damit auch enge Bindung pflegen. Inwiefern Monogamie beim Menschen natürlich sei, bleibt in der Forschung umstritten, kontinuierliche monogame oder polygame Beziehungen werden aber so gut wie immer von affektiven bzw. emotionalen Bindungen begleitet. Paarbindung kann einer 1979 von der US-amerikanischen Psychologin Dorothy Tennov (1928-2007) aufgestellten Theorie zufolge auch stark von sog. „Liminalität“ (Schwellenzustand) geprägt sein, welche sich am besten mit dynamischen, veränderlichen und „gemischten Gefühlen“ beschreiben lässt. Demzufolge sind Bindungen und Beziehungen gleich welcher Art und Intensität stets permanentem Wandel unterworfen, was der Realität ziemlich nahekommen dürfte.
Bonding: Die tiefe Bindung der Mutter zum Kind gilt als das stärkste Band unter Menschen
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Wissenschaft darüber hinaus der Untersuchung von elterlicher Bindung. 1958 publizierte der britische Entwicklungspsychologe, Kinderarzt sowie Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) einen in der damaligen Fachwelt viel beachteten, aber auch kontrovers diskutierten Aufsatz zur Natur der kindlichen Bindung an die Mutter. Diesem ersten Vorläufer der „Bindungstheorie“ zufolge beruht affektive oder emotionale Bindung auf dem universellen Bedürfnis des Menschen, sich zu binden, die Nähe anderer Personen zu suchen und durch deren Anwesenheit Sicherheit zu fühlen. Die Bindungstheorie wurde größtenteils durch Experimente mit Tieren sowie Beobachtungen von Kindern ohne Betreuungserfahrung durch Erwachsene entwickelt. Bowlby konstatierte seinerzeit, dass Babys von Geburt an das Bedürfnis nach engen emotionalen Bindungen haben, da die damit verbundene Fürsorge ihre Überlebenschancen deutlich erhöht. Von allen menschlichen Bindungen gilt die Mutter-Kind-Beziehung bzw. mütterliche Bindung als eine der stärksten. Diese entwickelt sich bereits während der Schwangerschaft, nach der Geburt sorgt die Produktion von Oxytocin („Kuschelhormon“) für parasympathische Aktivität, Reduzierung von Angst, Bindungsförderung und Fürsorgeverhalten.
Erwachsene und Kinder müssen nicht verwandt sein, um sich sehr eng zu binden
In den 1930er-Jahren wurde das Stillen des Säuglings an der Brust der Mutter noch als unabdingbar für eine frühe mütterliche Bindung erachtet. Seither haben jedoch zahlreiche seriöse Studien gezeigt, dass sich auch Mütter, die „nur“ mit der Flasche stillen, ebenso angemessen um ihre Säuglinge kümmern (können). Verschiedene Fütterungsmethoden scheinen somit nicht allzu viel Einfluss auf die Güte der Mutter-Baby-Beziehung zu haben. Erfolgreiche gegenseitige Mutter-Baby-Bindungen sind also auch ohne frühes Stillen an der Brust möglich. Auch die zu dieser Zeit noch weitverbreiteten Annahme, dass Kinder, die erst spät in die Obhut von Adoptiveltern kommen, Schaden nehmen könnten, weil die Phase der gegenseitigen Bindungsentwicklung im Säuglingsalter abgelaufen ist, gilt heute als wissenschaftlich widerlegt. Vielmehr muss das sog. Eltern-Säugling-System neuesten Erkenntnissen zufolge nicht zwangsläufig auf biologischer Verwandtschaft beruhen. Es scheint sich eher um angeborene Verhaltensmuster sämtlicher menschlicher Säuglinge und den hierzu adäquaten und gewachsenen Reaktionen aller menschlicher Erwachsenen auf diese zu handeln, die Bindungen dieser Art fördern. Somit können auch Erwachsene die Elternrolle für Kinder übernehmen, ohne deren tatsächlichen Eltern zu sein.
Väter haben zu ihren Kindern häufig andere, aber nicht wenige intensive Bindungen
Von der mütterlichen Bindung an das Kind, die sich auch über längere Zeiträume meist durch Stabilität auszeichnet, wird hingegen die diesbezüglich vergleichsweise fragile und stärker schwankende väterliche Bindung unterschieden. In der Tat wachsen heutzutage zahlreiche Kinder ohne Väter auf und kennen keinerlei väterliche Bindung. Im Allgemeinen erlangt väterliche Bindung auch erst später im Leben von Kindern Bedeutung, vor allem nachdem sich die Sprache des Kindes bereits entwickelt hat. Väter haben vermutlich mehr Einfluss auf Spiel- als auf Fürsorgeinteraktionen. Bindungen zwischen Vätern und Kindern entwickeln sich auch später eher um finanzielle sowie politische Themen, während sich Bindungen zwischen Müttern und Kindern rund um ethische und/oder religiöse Themen drehen. Interessanterweise scheint der Anteil des Hormons Progesteron als wichtigster Vertreter aus der Gruppe der Sexualhormone im Blut der Mutter nicht nur die Intensität der mütterlichen Bindung während der Schwangerschaft, sondern auch das Verhalten von Vätern gegenüber Kindern maßgeblich zu beeinflussen.
Bindungen zwischen Menschen und Tieren existieren, werden aber oft sehr verklärt
Gänzlich anderer Natur als die vielfältigen Bindungen zwischen Menschen sind diejenigen zwischen Mensch und Tier, deren Erforschung im Rahmen der zu dieser Zeit einsetzenden „Aufklärung“ bereits im späten 18. Jahrhundert begann. Hierbei wird im Allgemeinen eine Unterscheidung zwischen Haus- oder Nutz- und Wildtieren unternommen. Schon in den 1870er-Jahren gab es etwa in Paris die ersten therapeutischen Ansätze zur Behandlung psychisch Kranker, bei denen regelmäßiges Reiten auf Pferden die motorische Kontrolle verbesserte sowie neurologische Störungen und schwere Depressionen anhaltend und effektiv minderte. Ungefähr zur selben Zeit wurden in den Vereinigten Staaten viele Kinder und speziell Jungen aus der Mittelschicht mit Begleittieren sozialisiert. Absicht und Ziel war hierbei, die angeblich angeborene Neigung zur Gewalttätigkeit bei Jungen durch positive Effekte der Tierhaltung zu mildern, zu dämpfen oder gar ganz auszuschalten. Noch bis in die 1990er-Jahre galt die Fürsorge und Verantwortung von Jungen für Haustiere als eine der wenigen erfolgreichen pädagogischen Methoden, Aggression bei männlichen Kindern dauerhaft vorzubeugen. Ein bekanntes historisches Beispiel für eine enge „Mensch-Tier-Bindung“, die als Begriff aber erst in den 1980er-Jahren in der Terminologie der Forschung auftauchte, sind diesbezügliche Berichte vieler Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, die ihre große Zuneigung zu den an der Front eingesetzten Pferden betonten.
Bonding: Viele Mechanismen von Bindungen lassen sich biologisch und chemisch erklären
Trotz der zahlreichen Unterschiede zwischen menschlichen und tierischen Bindungen bzw. dem Unvermögen von Menschen, tierisches Bindungsverhalten vollständig zu verstehen, gibt es doch auch einige Gemeinsamkeiten hormoneller Natur. Bei Menschen wie vielen Tierarten scheinen die beiden Hormone Oxytocin und Vasopressin den Bindungsprozess sowie soziales und reproduktives Verhalten günstig zu beeinflussen. Auch Paarbindung, positive soziale Interaktion sowie mütterliches Verhalten und Vertrauen werden durch höhere Konzentrationen dieser Hormone gestärkt, soziale Isolation führt dahingegen zu Stress und Freisetzung von Cortisol. In den „Belohnungszentren“ des limbischen Systems kann der Neurotransmitter Dopamin auch mit Oxytocin interagieren und auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit einer Bindung weiter erhöhen. Einige Bedeutung bei der Bildung und Entwicklung von Bindungen wird auch dem Peptidhormon Prolaktin beigemessen, welches vorrangig im Hypophysenvorderlappen produziert wird und positiv auf Bindungen zwischen Müttern und Säuglingen sowie romantische Bindungen wirkt. Prolaktin steigert Wohlbefinden und verändert das neuroendokrine System, um somit enge Beziehungen zu ermöglichen und individuelle Gesundheit zu erhalten. Der Anstieg des Prolaktinspiegels in sozialen Stresssituationen soll Menschen auch vor potenziell gefährlichen und riskanten Überreaktionen bewahren.