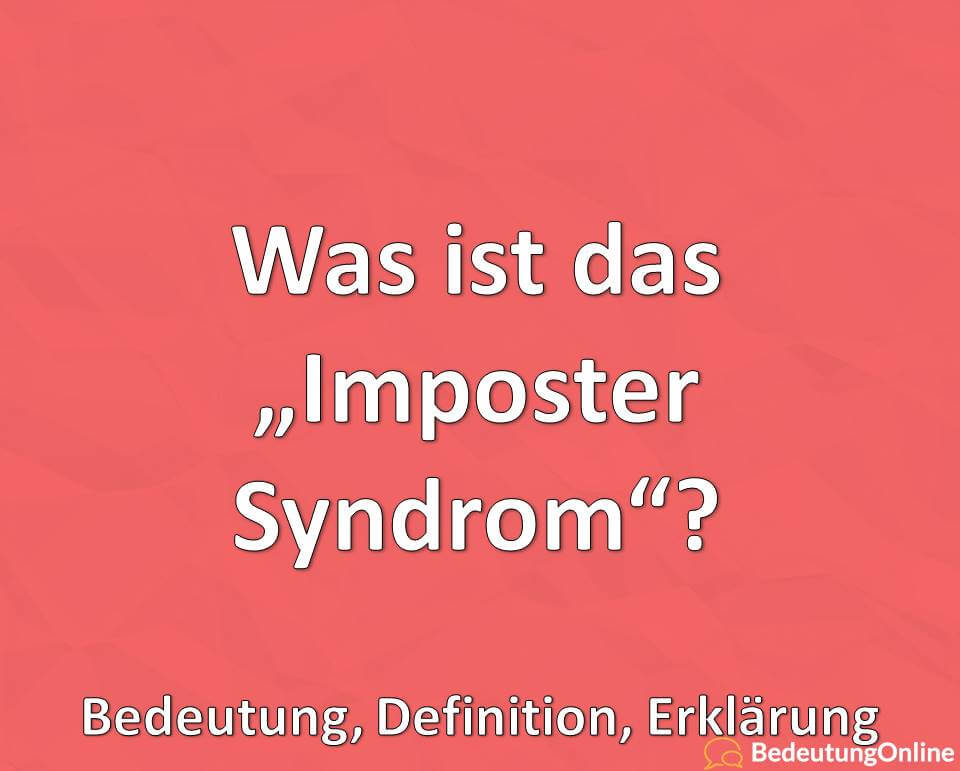Das Impostor-Syndrom ist eine extreme Variante des Selbstzweifels. Es wird als „Hochstapler-Syndrom“ übersetzt, das englische Wort impostor heißt Hochstapler. Jedoch ist diese Bezeichnung auf den ersten Blick irreführend, denn die Betroffenen sind keine Hochstapler, sondern halten sich nur dafür, was also das Gegenteil eines Hochstaplers wäre. Sie zweifeln an sich und glauben, dass sie sich zu positiv darstellen bzw. zu positiv wahrgenommen werden. In milderer Form könnte man das als Tiefstapeln oder Understatement bezeichnen, aber das Impostor-Syndrom gilt unter Therapeuten als ernsthafte Störung, wenn auch nicht als klassifizierte Erkrankung.
Was sind Hochstapler / Imposter? Bedeutung, Definition, Erklärung, Psychologie
Klassische Hochstapler sind Blender, die wesentlich mehr vorgeben zu sein, als sie wirklich sind. Das kann zum handfesten Betrug führen: Sie können als vermeintliche Geschäftsleute oder gar Ärzte auftreten und sich damit Zuwendungen, Kredite, Posten und Ansehen erschleichen. In kleinerer Form präsentieren sie sich in der Arbeitswelt als vermeintliche Experten, doch hinter ihrem großspurigen Auftreten steckt nichts oder nur sehr wenig.
Was geschieht beim Impostor-Syndrom?
Menschen mit dem Impostor-Syndrom verhalten sich gegenteilig zu Hochstaplern: Sie treten geradezu überbescheiden auf, obwohl sie sehr viel können. Diese Bescheidenheit ist kein aufgesetztes Understatement: Sie glauben wirklich, nicht allzu viel wert zu sein. In psychologischer Hinsicht ist dies ein Manko bei der Fremd-Selbst- und Selbst-Selbst-Betrachtung. Diese sind Bausteine unseres Selbstkonzepts:
- Fremd-Selbst-Betrachtung: Was denken andere über mich?
- Selbst-Selbst-Betrachtung: Was denke ich über mich?
- Selbst-Fremd-Betrachtung: Was denke ich über mein Verhältnis zu anderen?
Das jemand am Impostor-Syndrom ernsthaft leidet, ist daran festzustellen, dass diese Person trotz ihrer objektiv als überragend einzustufenden Leistungen und ernsthaft ausgesprochenem Lob von Vorgesetzten, Kollegen und Freunden nicht an die eigenen Fähigkeiten glaubt. Die Folgen sind kurios: Die Betroffenen strengen sich fürchterlich an, um ausreichende Leistungen zu bringen, können aber in entscheidenden Momenten vor lauter Selbstzweifeln versagen. Vorgesetzte müssen dies erkennen und eine/n Mitarbeiter*in mit Impostor-Syndrom eher in die zweite Reihe stellen. Die Person kann vieles vorbereiten, aber abschließende Arbeitsschritte (Vertragsabschluss, endgültige Implementierung einer Software etc.) sollte jemand anderes übernehmen. Der Mensch mit dem Impostor-Syndrom wird dies sogar sehr gern akzeptieren und für diese Entscheidung dankbar sein.
Was geht im Menschen mit Impostor-Syndrom vor?
Dieser Mensch glaubt nicht nur, dass er wenig kann und wert ist, sondern fürchtet sich auch sehr davor, dass jemand sein vermeintliches Hochstapeln aufdecken könnte. Kollegen nehmen das Verhalten der/des Betroffenen über lange Zeit lediglich als Bescheidenheit wahr, die ja immer angenehm wirkt.
Auffällig werden die Betroffenen erst, wenn sie bestreiten, einen Anteil an einem wirklichen, messbaren Erfolg zu haben. Sie behaupten allen Ernstes, dieser sei durch Fremdeinwirkungen oder durch einen glücklichen Zufall zustande gekommen. An dieser Stelle würde ein Therapeut, wenn er denn aufgesucht würde, feststellen, dass die betreffende Person ihr Wirken und ihre Erfolge nicht internalisieren (verinnerlichen) kann. Es fehlt ihr tatsächlich die Kausalkette zwischen eigenem Handeln und erfolgreichem Ergebnis. Dieses Manko besteht trotz offensichtlicher Beweise dafür, dass sie am Erfolg beteiligt war. Bestenfalls schieben die Betroffenen den Erfolg auf den sogenannten Matthäus-Effekt, der darauf basieren soll, dass jemand nur deshalb für erfolgreich gehalten wird, weil er früher schon einmal erfolgreich war.
Was ist der Matthäus-Effekt? Bedeutung, Definition, Erklärung
Der Matthäus-Effekt ist eine soziologische These, die durchaus begründbar ist und sich auch im Volksmund manifestiert: „Wer schon hat, dem wird gegeben“. Die Bezeichnung als „Matthäus-Effekt“ gaben die Soziologen diesem Phänomen, weil im Matthäusevangelium das Gleichnis zu finden ist: „Denn wer hat, dem wird noch mehr gegeben, sodass er Fülle habe …“ (Matthäus 25,29 LUT). In der Tat ist in soziologischen Konstellationen (unter anderem in der Politik) zu beobachten, dass manche Protagonisten manchmal „einen Lauf“ haben und ihnen ein Erfolg nach dem anderen zufliegt. Das ist auf dem eher verschwommenen Feld der Politik auch nicht allzu schwer, weil es hier um Image, Wahrnehmung und Kommunikation geht.
Wenn aber in der Wirtschaft oder auch einer Behörde, einer Einrichtung etc. handfeste Ergebnisse zu bringen sind, lässt sich ein Resultat nicht mit früheren Erfolgen erklären, wie es Menschen mit Impostor-Syndrom gern versuchen, denn es musste ein messbares Ergebnis her. Die Software musste funktionieren. Der Vertrag musste abgeschlossen werden. Die Kollegin mit dem Impostor-Syndrom hat das geleistet. Sie vermag nur selbst nicht daran zu glauben.
Woher kommt der Begriff „Impostor-Syndrom“? Ursprung, Geschichte
Als „impostor phenomenon“ bezeichneten erstmals 1978 die Forscherinnen Suzanne A. Imes und Pauline R. Clance das Verhalten sehr erfolgreicher Frauen, die daran glaubten, dass sie eigentlich nicht sehr intelligent seien. Ihre innere, feste Überzeugung war trotz nachgewiesener Leistungen, dass andere sie überschätzen würden. Die Imes und Clance nahmen damals an, dass es sich um ein unveränderliches Persönlichkeitsmerkmal bzw. um eine manifestierte psychische Störung handele. Zu jenem Zeitpunkt diagnostizierte man schon pathologische Hochstapelei als ernsthafte psychische Störung (ähnlich wie Kleptomanie). Von beiden starren Betrachtungsweisen ist man in den 2000er-Jahren wieder abgerückt, was im Falle der Hochstapelei auch für die Justiz bedeutsam ist: Es geht nämlich darum, inwieweit der Betrug eines Hochstapler justiziabel ist.
Wenn Gutachter zum Ergebnis kommen, dass ein Hochstapler durchaus weiß, was er tut, und sich auch frei dafür oder dagegen entscheiden kann, dann ist es nur logisch, dass man das gegenteilige Impostor-Syndrom ebenfalls als initiiert und stimuliert betrachtet. Dazu tendiert die Forschung der 2020er-Jahre. Die Betroffenen reagieren auf bestimmte Ereignisse und Stimuli. Sie schützen sich vor einer vermeintlichen Überbewertung ihrer Leistungen, weil sie glauben, dem daraus resultierenden Erwartungsdruck nicht gewachsen zu sein, was möglicherweise schon früher einmal geschehen ist. Diese Sicht könnten sie auch wieder ablegen. Wenn dies so wäre, dann wäre das Impostor-Syndrom zwar eine psychische Schieflage (mit entsprechenden Konsequenzen für das Verhalten), aber keine psychische Krankheit. Es gibt hierfür auch in der Tat keine ICD-10-Nummer.
Wie häufig ist das Impostor-Syndrom anzutreffen?
Seit den Forschungen von Imes und Clance hat man in Studien die Verbreitung des Impostor-Syndroms untersucht. Hier einige Ergebnisse seit den 1980er-Jahren:
- Frühe Studien kamen zu dem Ergebnis, dass sich rund 40 % aller erfolgreichen Menschen als Hochstapler einstufen.
- Spätere Studien kamen sogar auf einen Wert von 70 %. Dieser Wert wurde inzwischen relativiert. Vermutlich sind die ganz zu Anfang identifizierten 40 % realistischer.
- Nach dem Ausgangspunkt von Imes und Clance ging man zunächst davon aus, dass fast nur erfolgreiche Frauen betroffen sind. Später stellte man fest, dass sich Frauen und Männer etwa gleich häufig für Hochstapler halten.
- Jüngere Studien in den USA deckten auf, dass ethnologische und kulturelle Hintergründe eine Rolle spielen. So sind in den Staaten Afroamerikaner besonders betroffen.
- Auch unter Universitätsabsolventen ist das Impostor-Syndrom relativ häufig anzutreffen.
Mögliche Ursachen
Eine jüngere These vermutet den Stress in Leistungssituationen als Hauptursache. Dieser führt dazu, dass die Betroffenen an den eigenen Erfolg nicht glauben können und ihn externen Ursachen zuschreiben, während sie für den eigenen Misserfolg interne Ursachen (ihre mangelnden Fähigkeiten) verantwortlich machen. Empirisch ließ sich belegen, dass dieses Erklärungsmuster niemals auf soziale Situationen (Partnerschaft, Familie, Freundeskreis) und stets auf Leistungssituationen angewendet wird. Das stützt die These der mangelnden Stressbewältigung. Das Syndrom existiert offenkundig eigenständig (wie eine Sucht), was schon die Psychologin Clance vermutet hatte.
Lässt sich das Impostor-Syndrom therapieren?
Ja, das ist möglich, wobei zu beachten ist, dass es nicht als Krankheit anerkannt ist und daher die Kassen keine Kosten für eine Psychotherapie übernehmen (weder gesetzliche noch private). Ein möglicher Ansatz ist die kognitive Verhaltenstherapie. Hierbei betrachten der/die Therapeut*in und die betroffene Person gemeinsam den gedanklichen Prozess, durch den der eigene Beitrag zum Erfolg nicht anerkannt werden kann. Dabei lassen sich Paradigmen aufdecken, so etwa die Annahme, dass nur ein einziger eigener Fehler vollkommen an den eigenen Fähigkeiten zweifeln lässt. Dieses Paradigma können Betroffene überwinden.
Im Normalfall wissen wir alle, dass wir gelegentlich Fehler machen und diese meistens auch korrigieren können. Auch eine Schreibtherapie kann helfen: Mit dieser organisiert die betreffende Person ihre Gedanken. Sie listet Erfolge und Misserfolge auf. Zu beidem stellt sie Kausalketten her. Das führt zu einer realistischeren Bewertung von Erfolgen und Fehlschlägen. Die Texte sollten aufbewahrt werden, um sie in späteren zweifelhaften Situationen heranzuziehen. Tiefenpsychologisch lässt sich aufdecken, ob die betroffene Person in ihrer Kindheit hinsichtlich ihrer Leistungen oft (auch subtil) gedemütigt wurde. Es gibt beispielsweise Eltern, die noch so gute Leistungen ihrer Kinder niemals anerkennen (meistens aus Nachlässigkeit) oder gar dem Kind ständig seine Unzulänglichkeit vorhalten.
Wo ist das Imposter-Syndrom anzutreffen bzw. problematisch?
Da es sich auf Leistungen bezieht, ist es vorrangig bis ausschließlich im Berufsalltag anzutreffen und dort auch problematisch. So kostet es die Betroffenen, aber auch ihre Vorgesetzten unglaublich viel Kraft. Die Kollegen, die nicht entscheiden müssen, ob die/der Betroffene eine bestimmte Aufgabe übernehmen muss, sind hingegen praktisch nicht involviert. Sie nehmen höchstens eine überstarke Bescheidenheit wahr. Die Vorgesetzten müssen aber abwägen, ob eine Kollegin oder ein Kollege mit Impostor-Syndrom an entscheidenden Schaltstellen agieren sollte, weil dieses Syndrom tatsächlich zum Versagen im entscheidenden Moment führen kann. Hilfreich ist es, wenn Vorgesetzte das Syndrom kennen. Betroffene sollten sich ebenfalls informieren und sich selbst analysieren. Es gibt neben den geschilderten negativen Gedanken auch handfeste körperliche Symptome durch den Dauerstress:
- Schlafstörungen
- Kopf- und Bauchschmerzen
- Bluthochdruck
- Schweißausbrüche nicht nur vor, sondern auch nach einer schwierigen Aufgabe
Betroffene und ihr berufliches Umfeld können sich mit dem Zustand arrangieren oder versuchen, ihn therapeutisch zu überwinden.