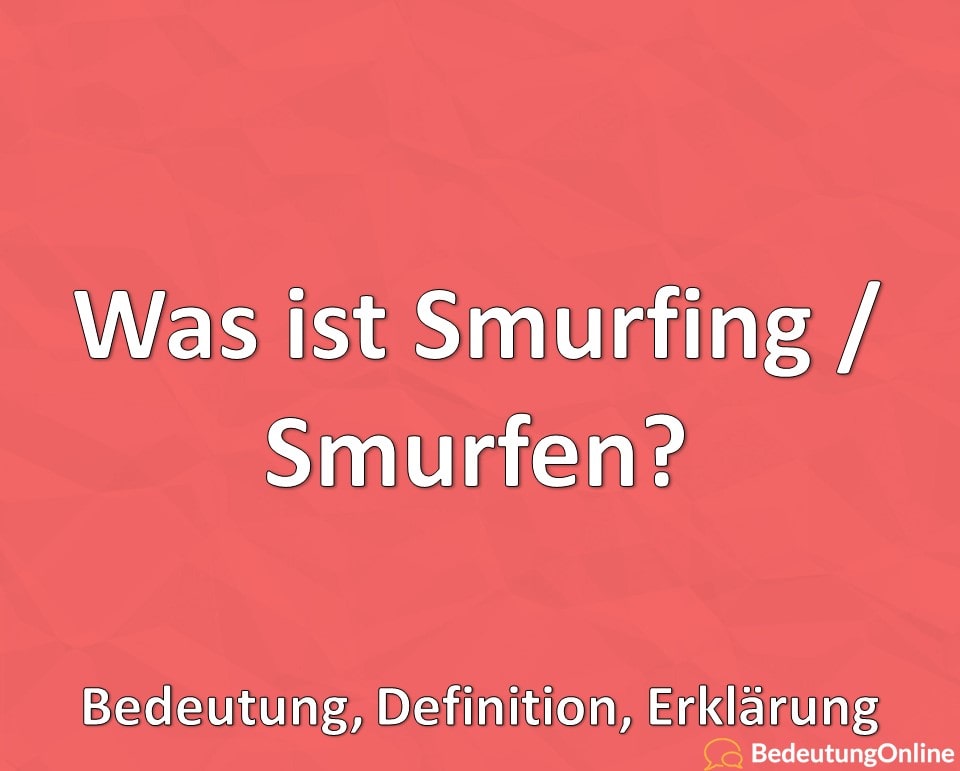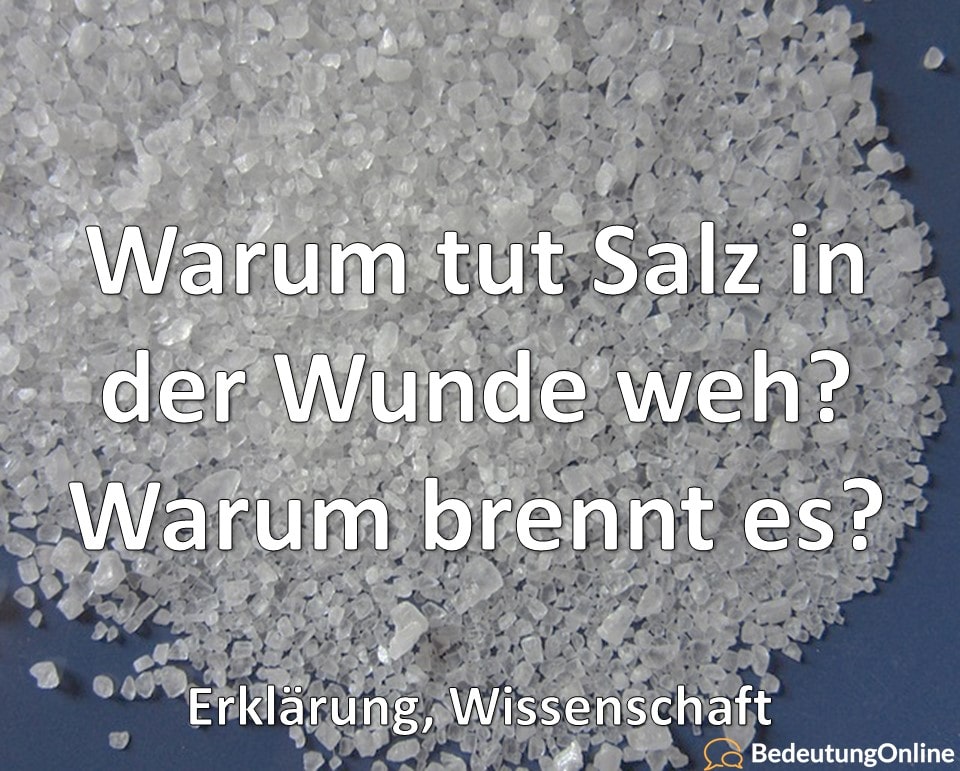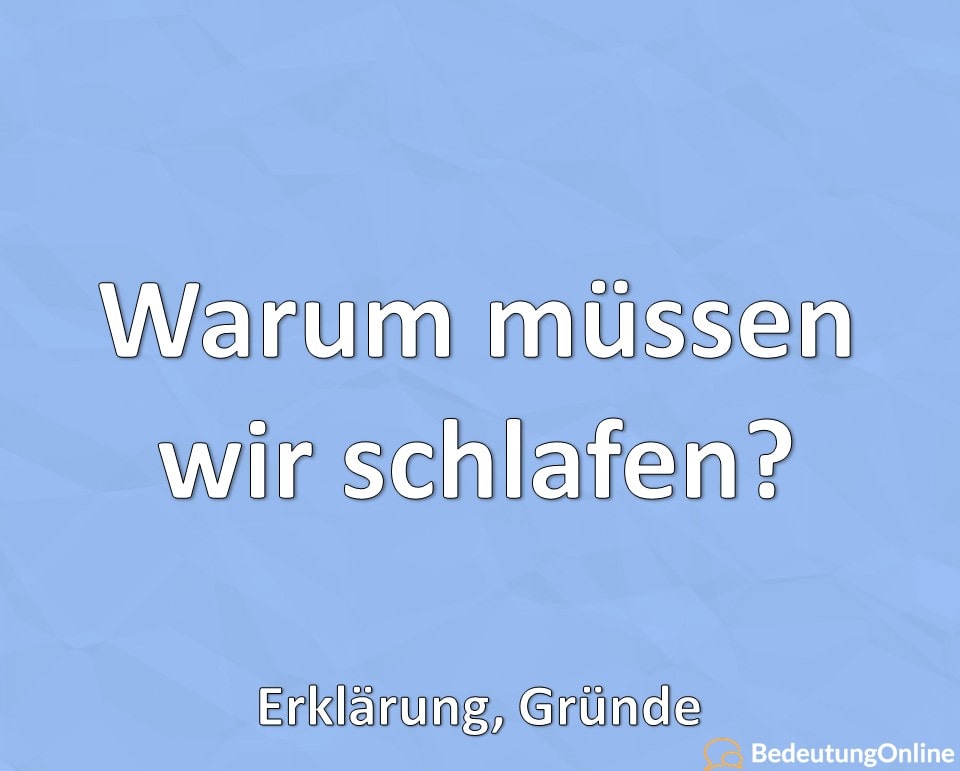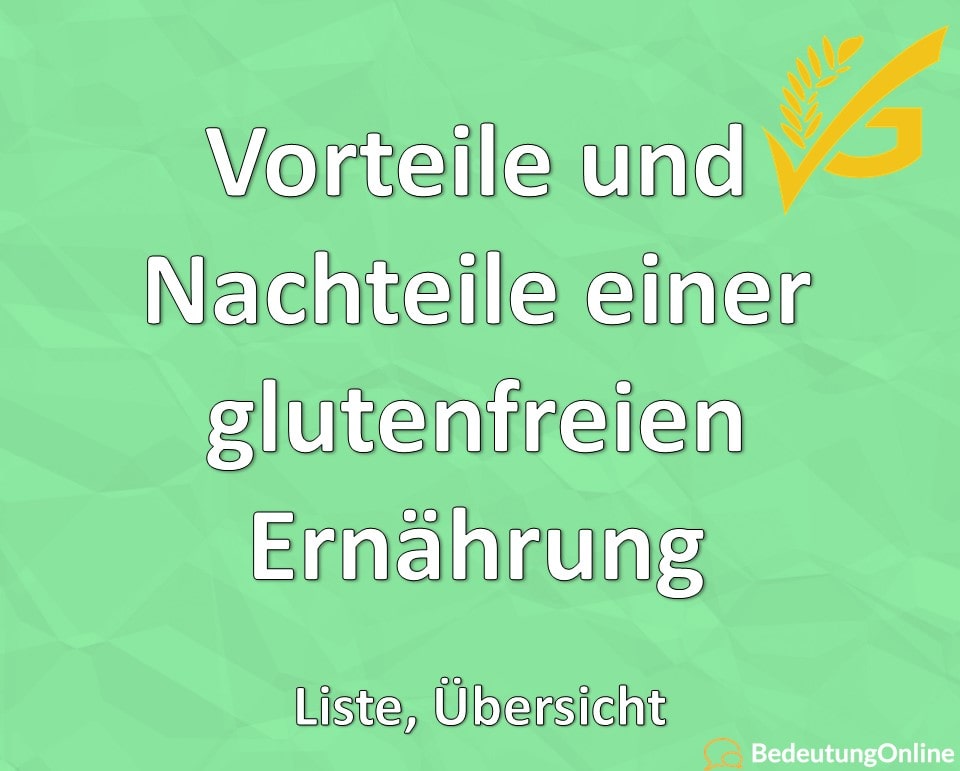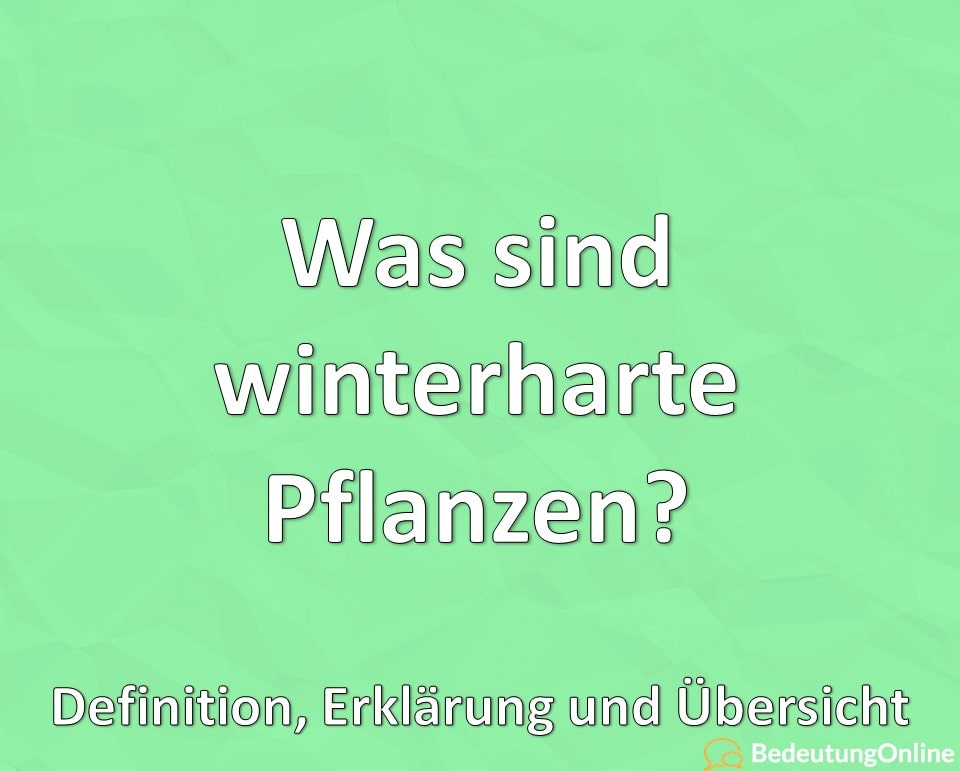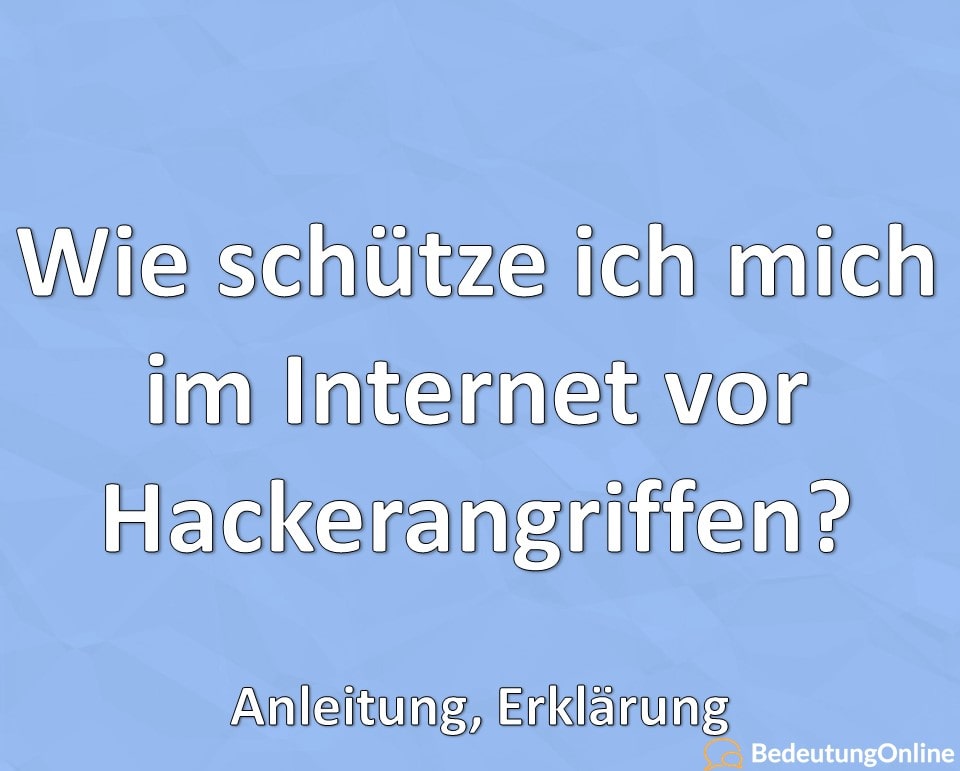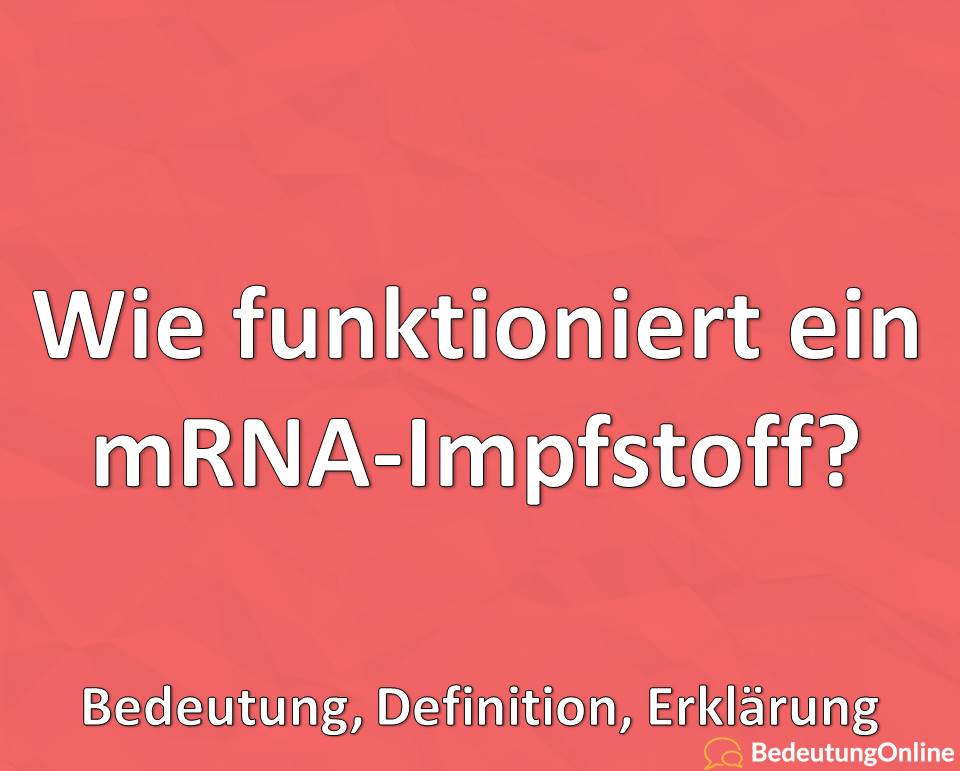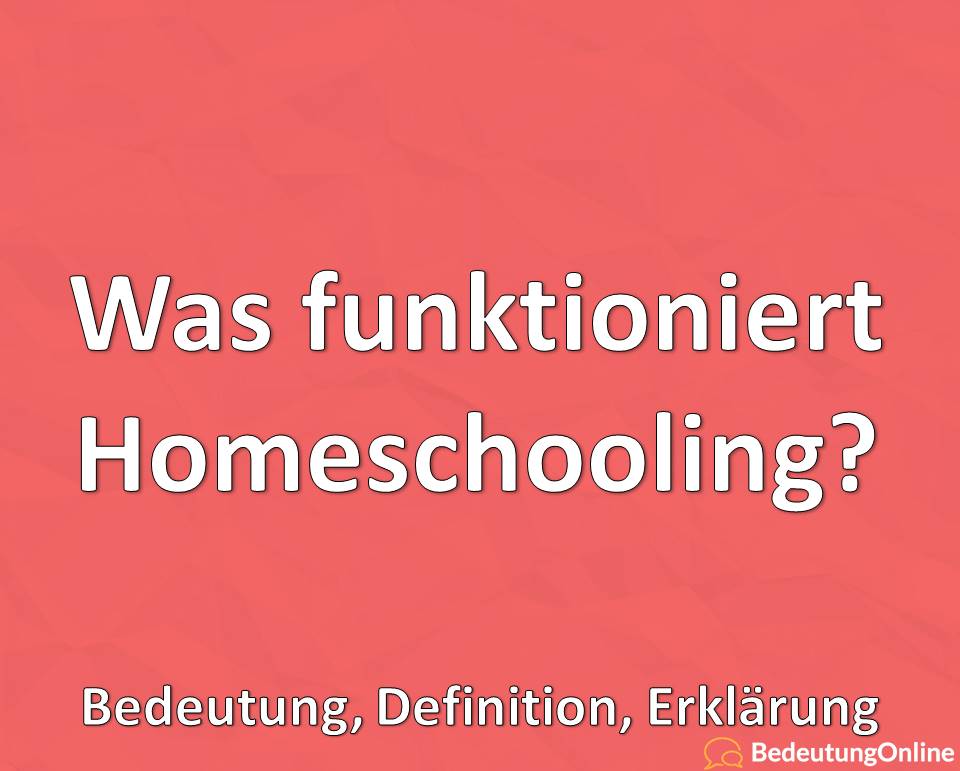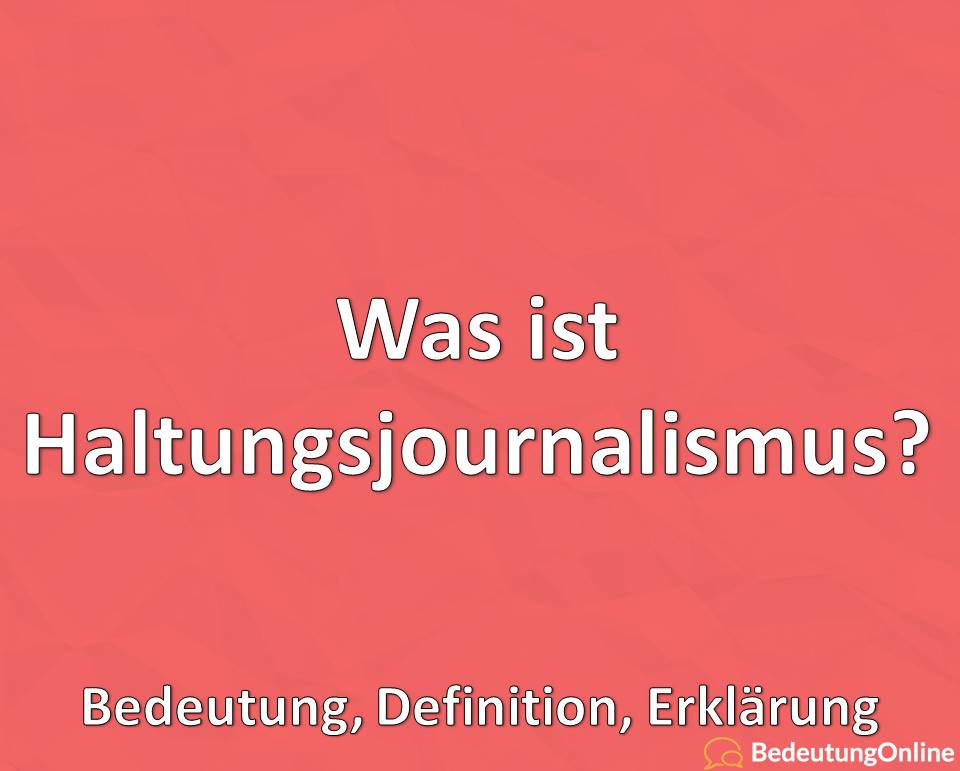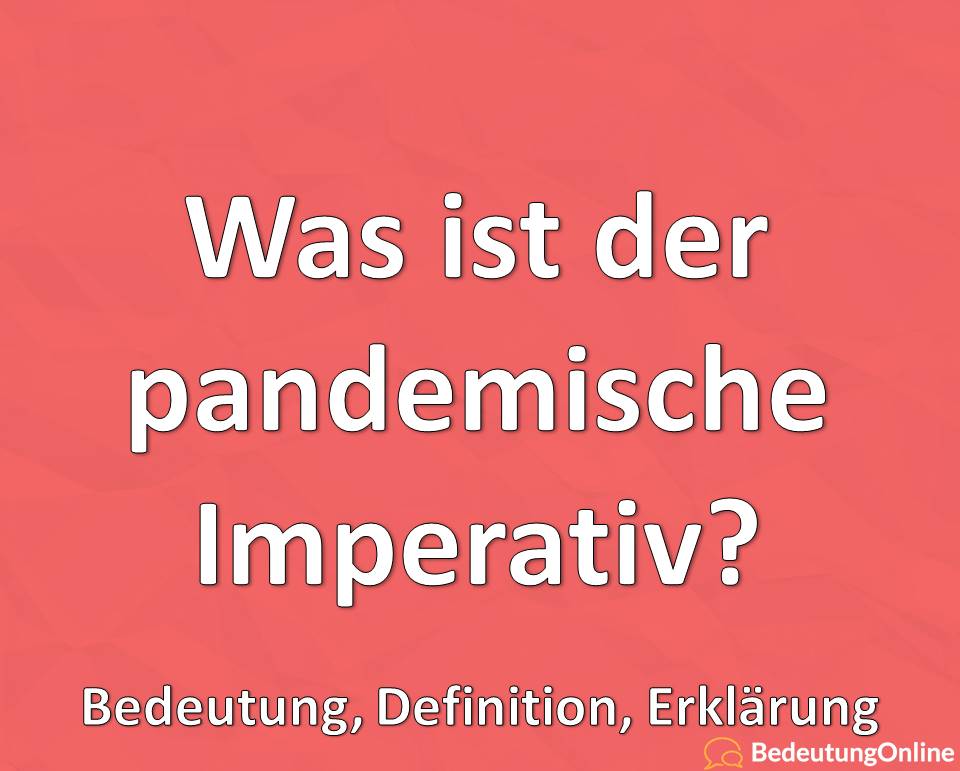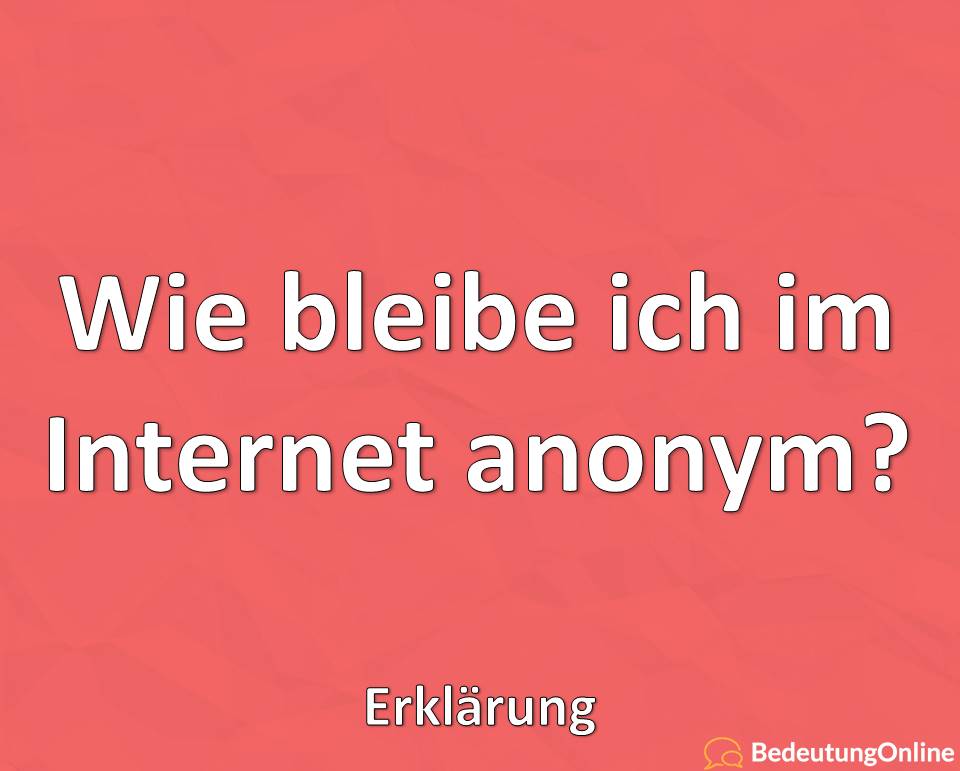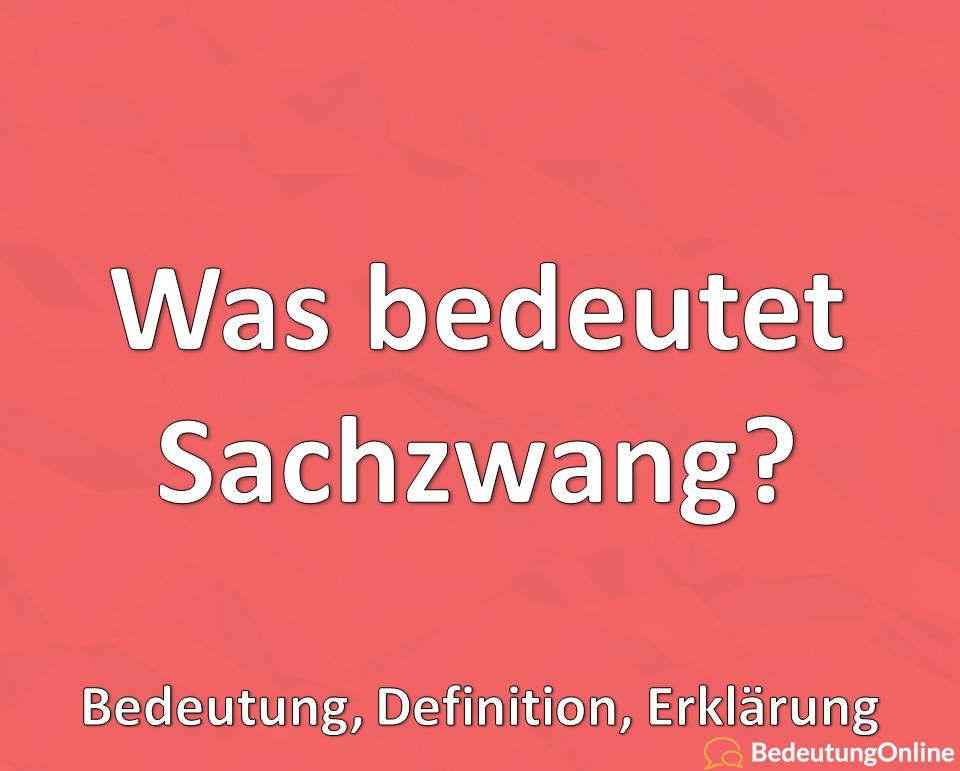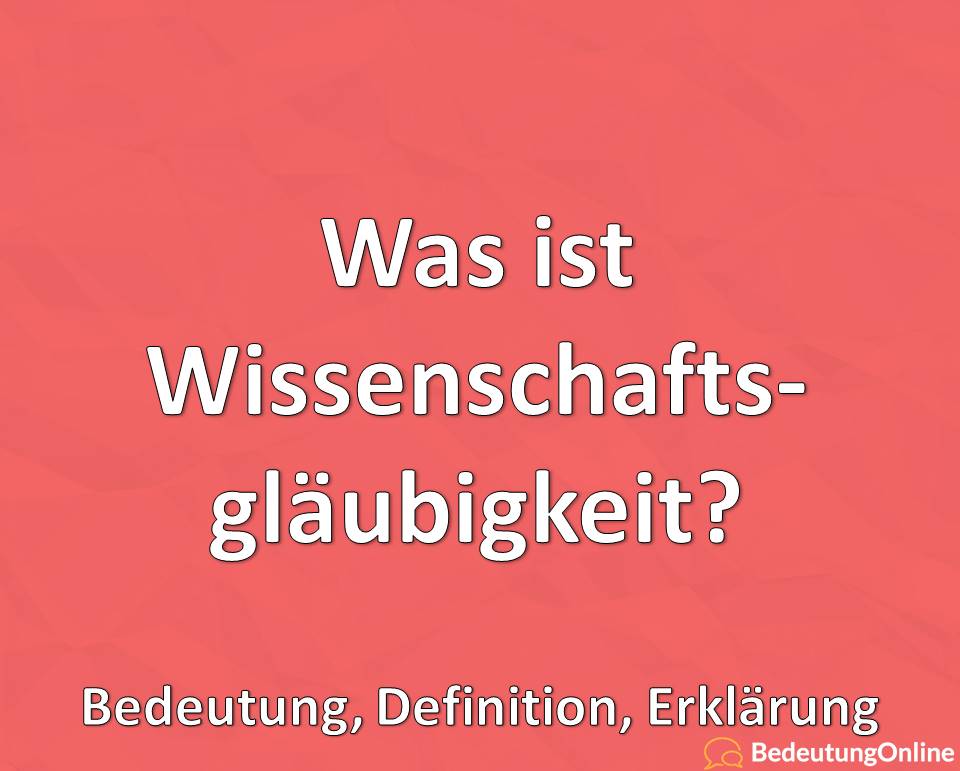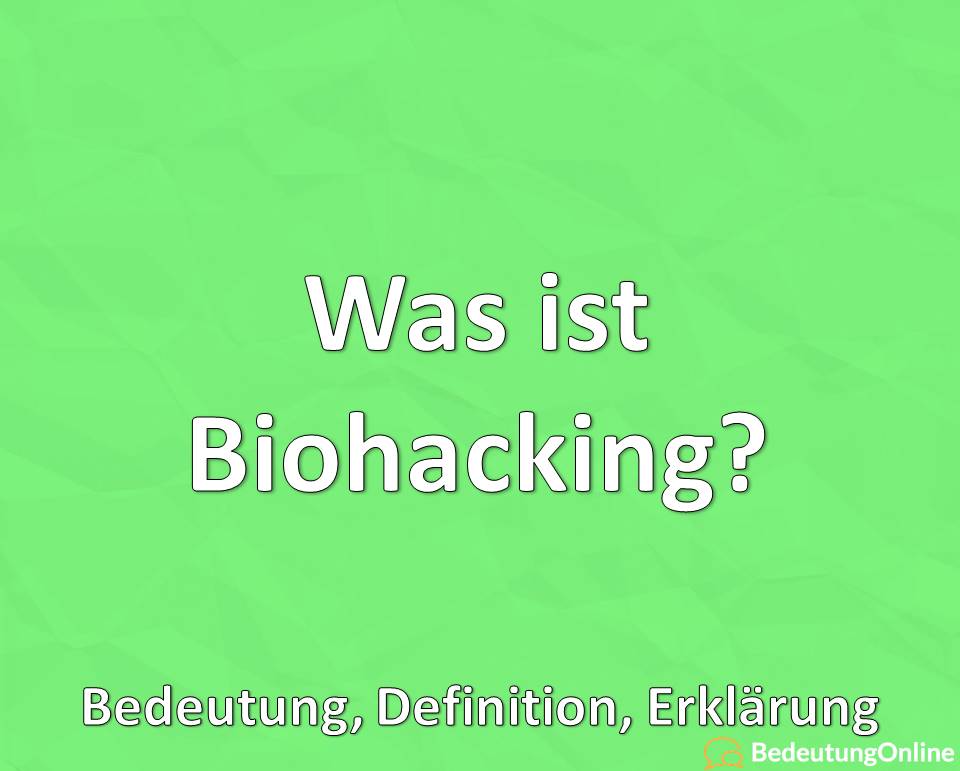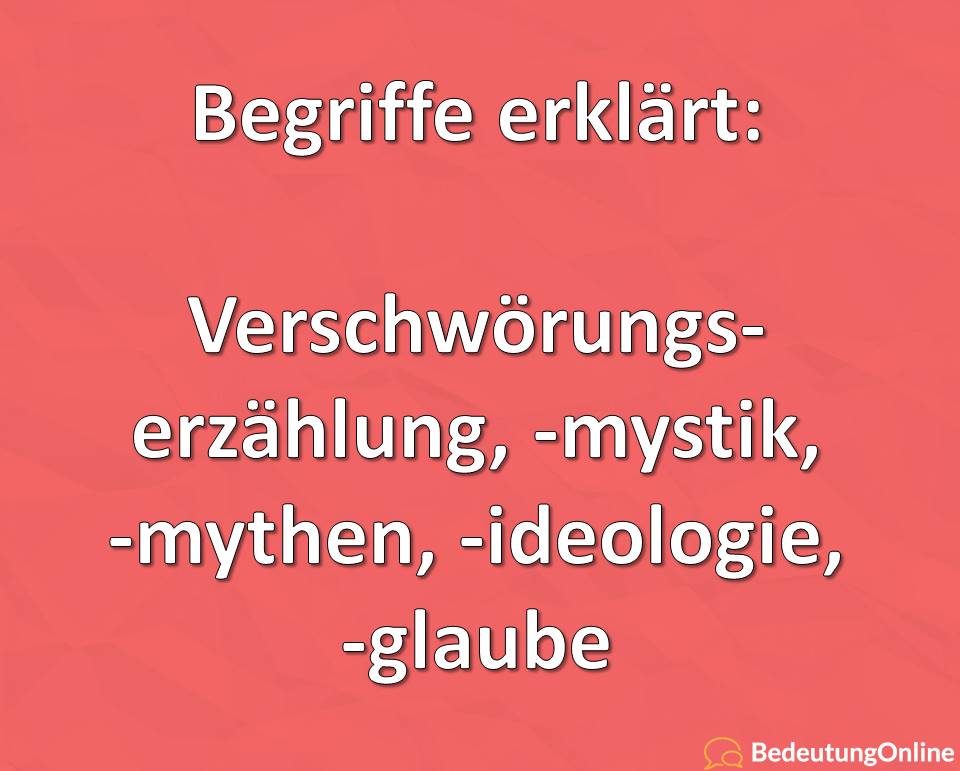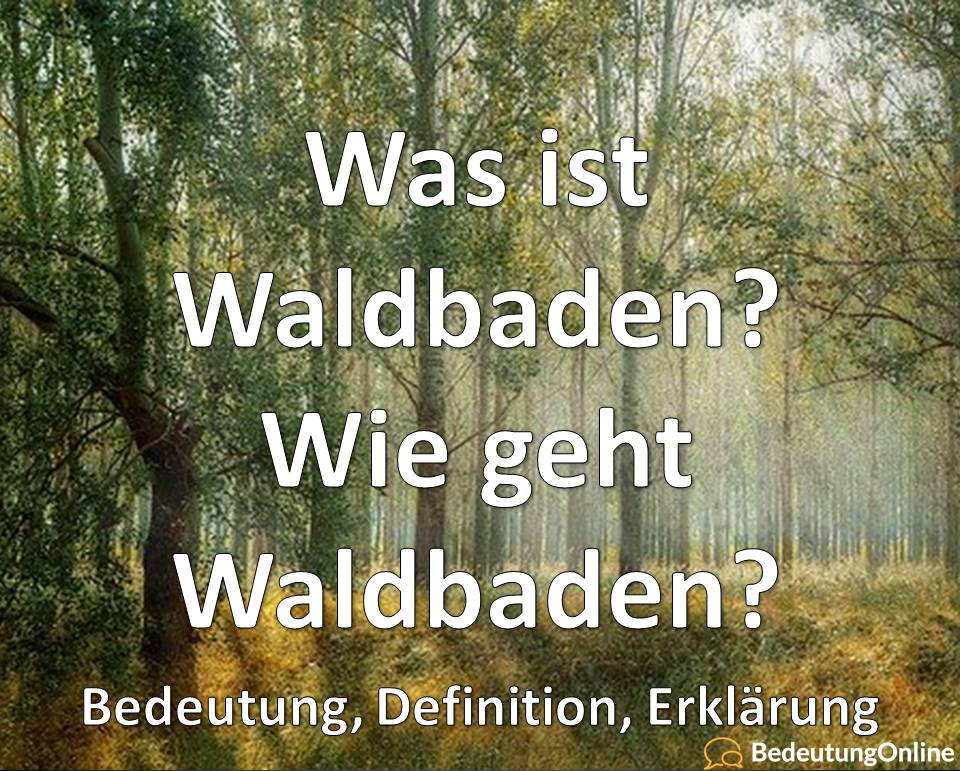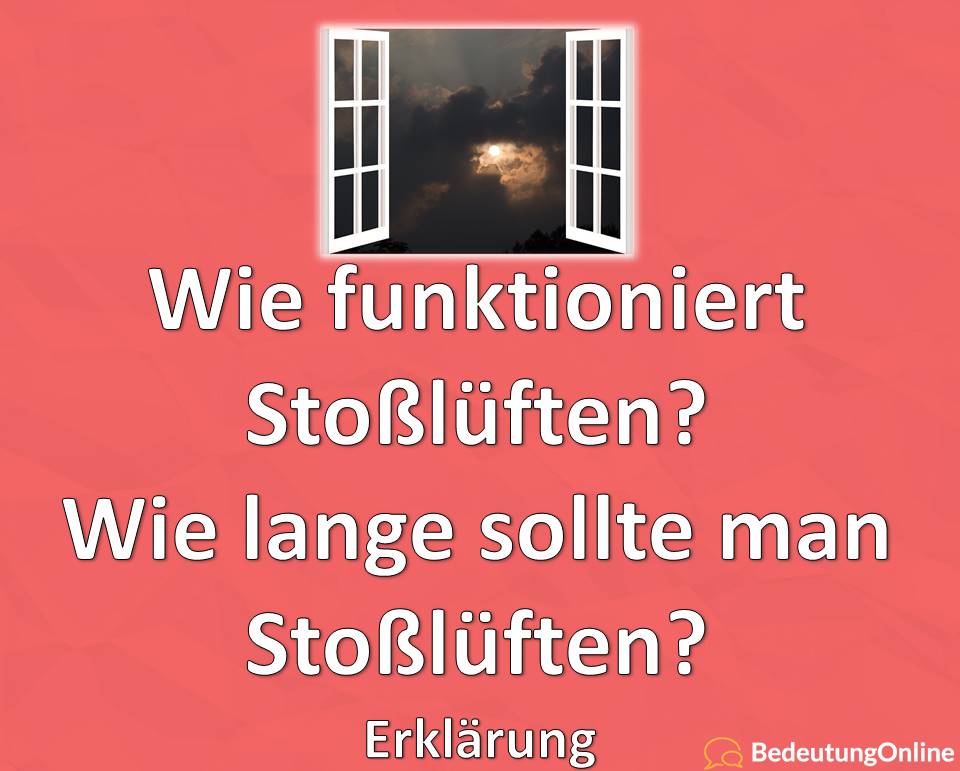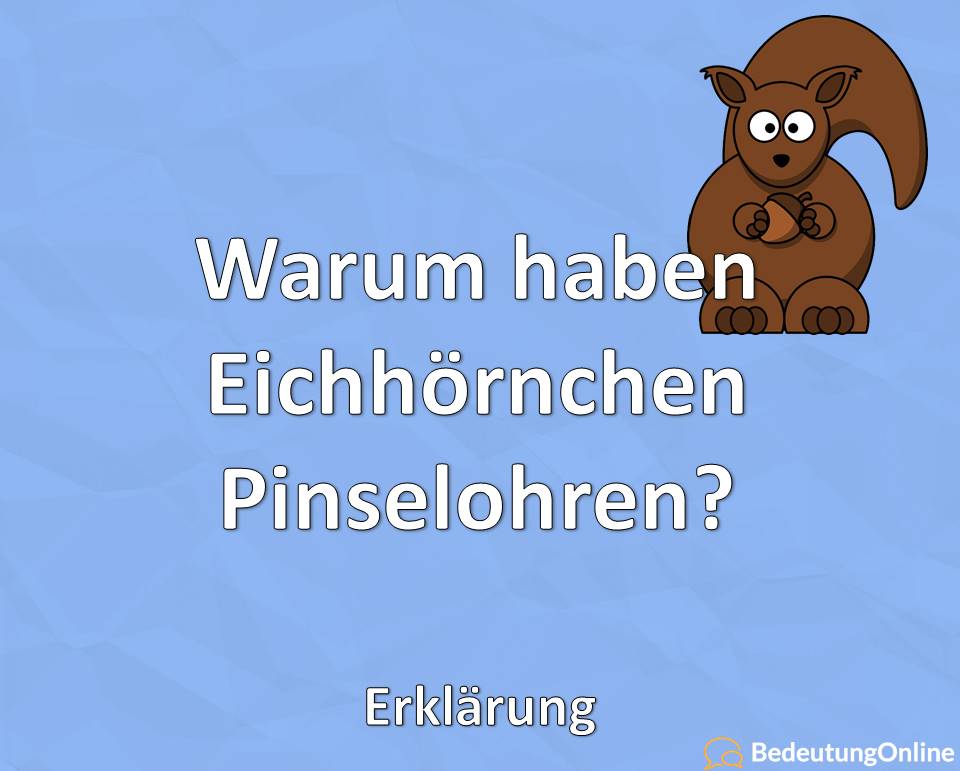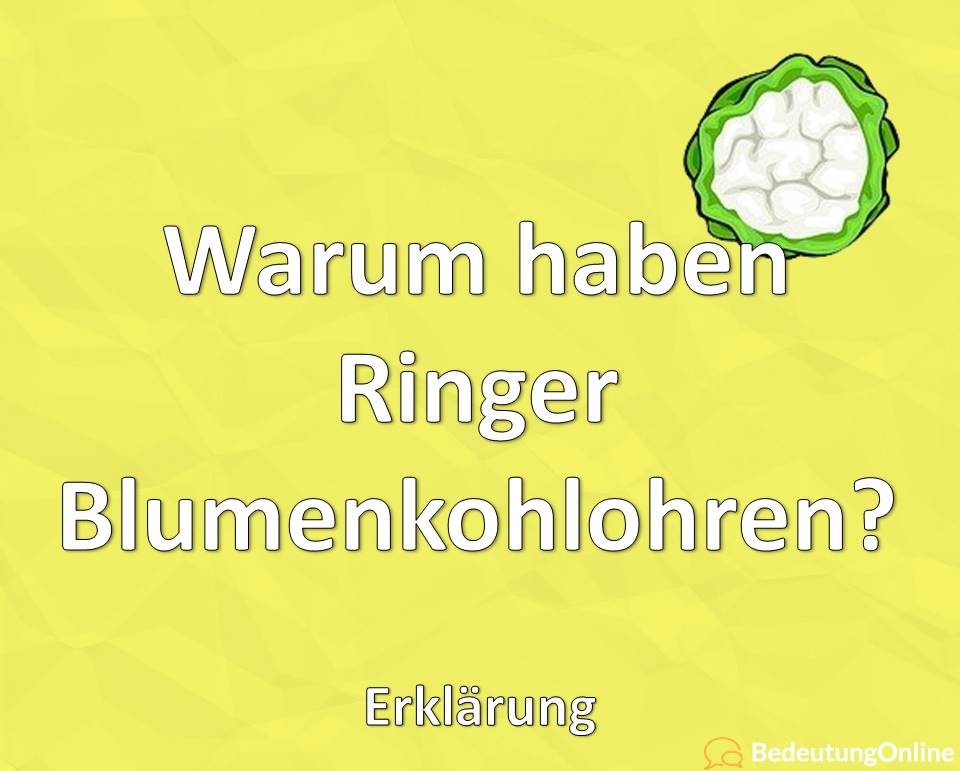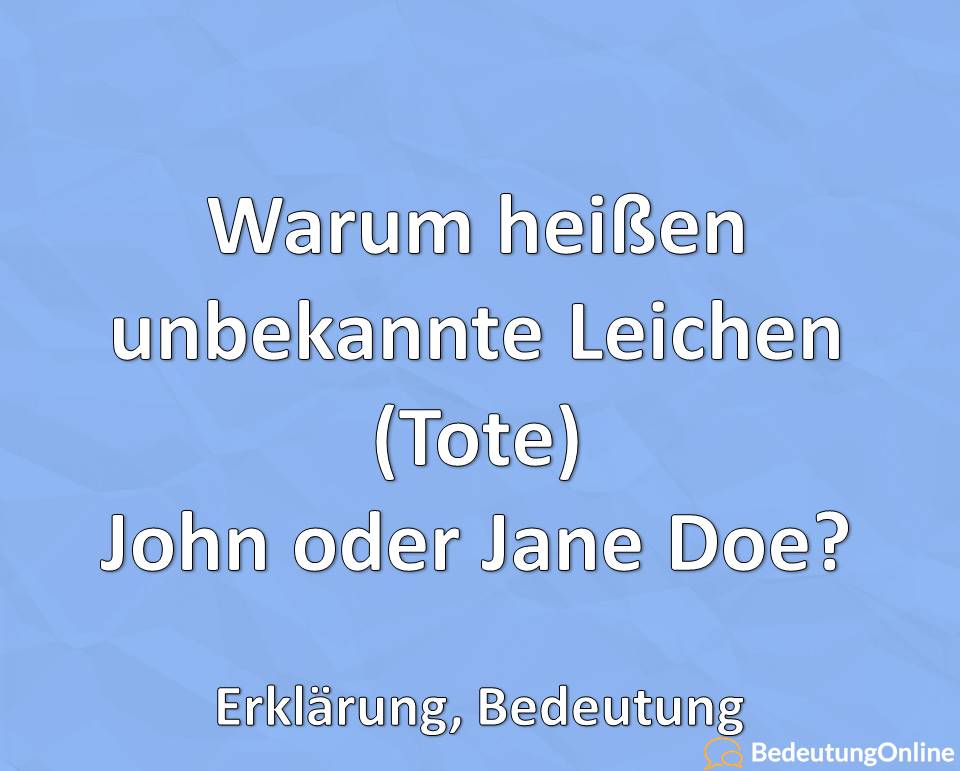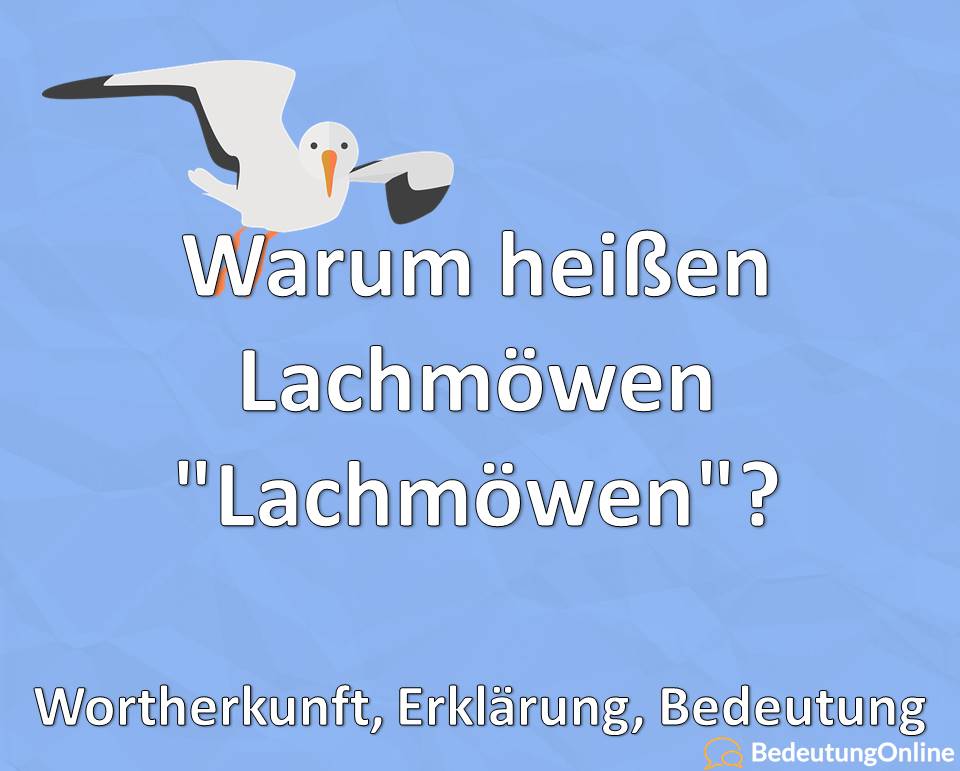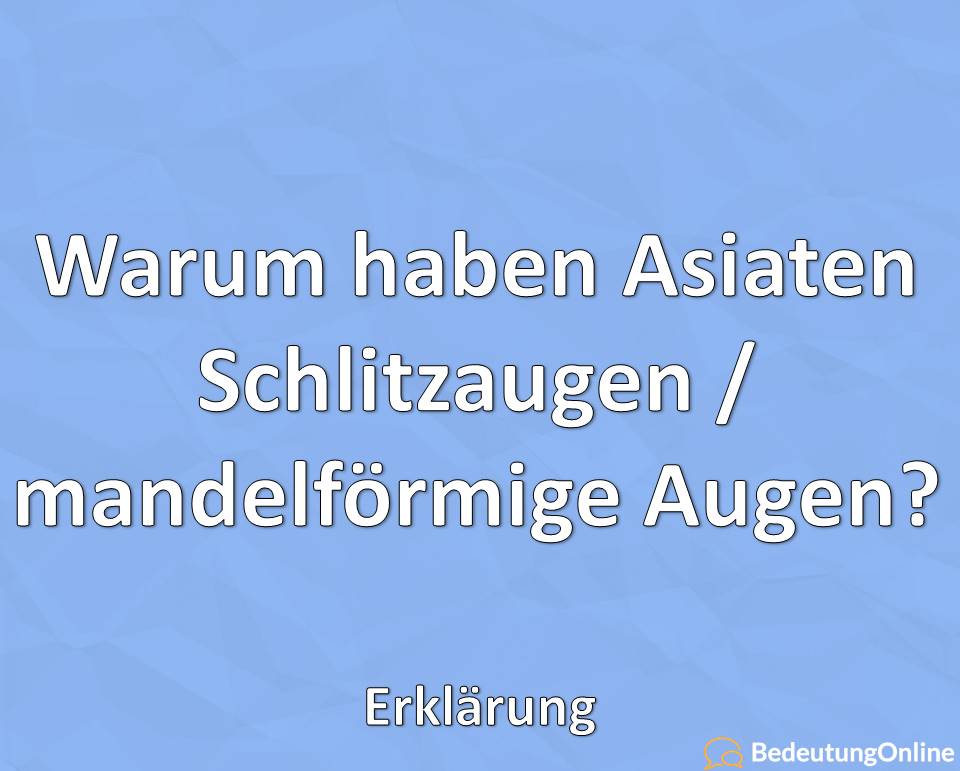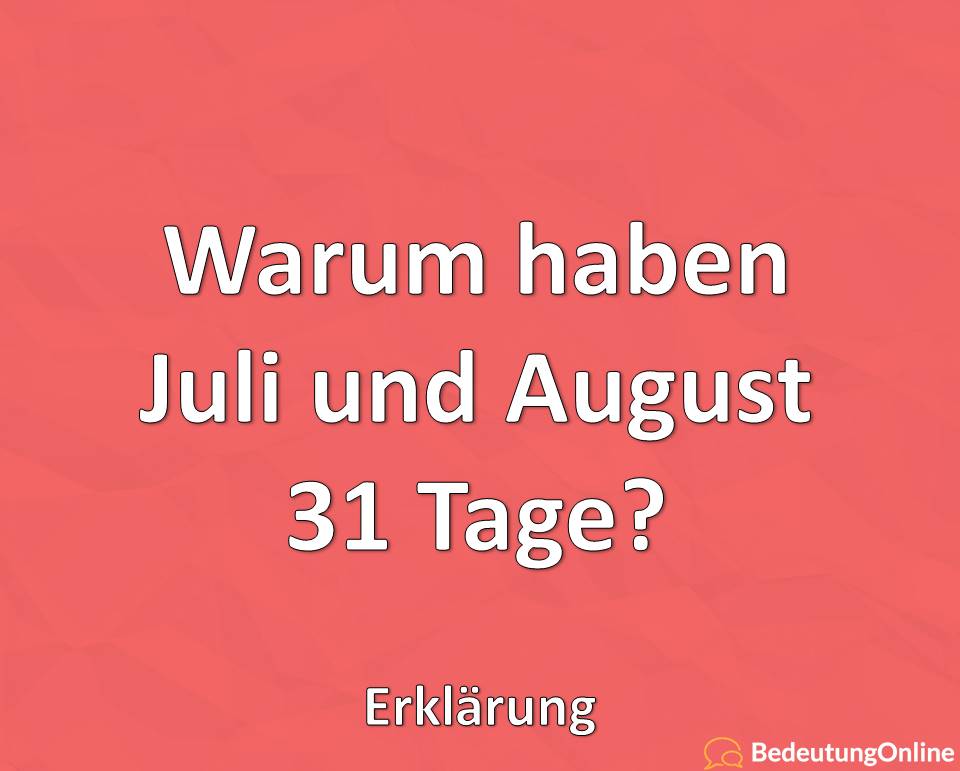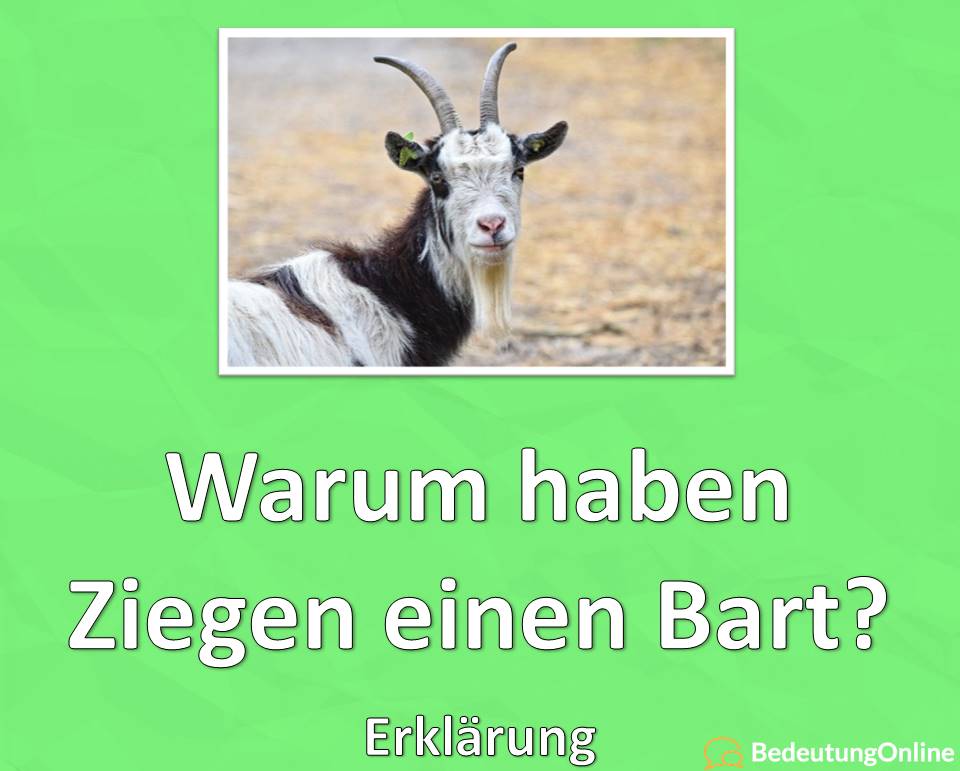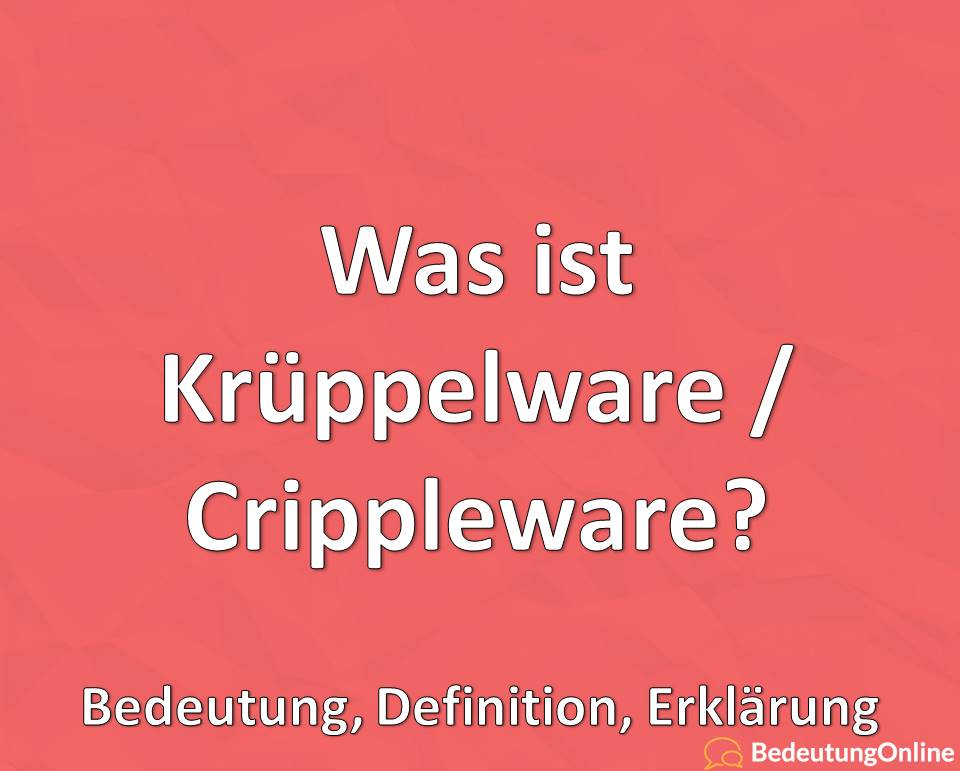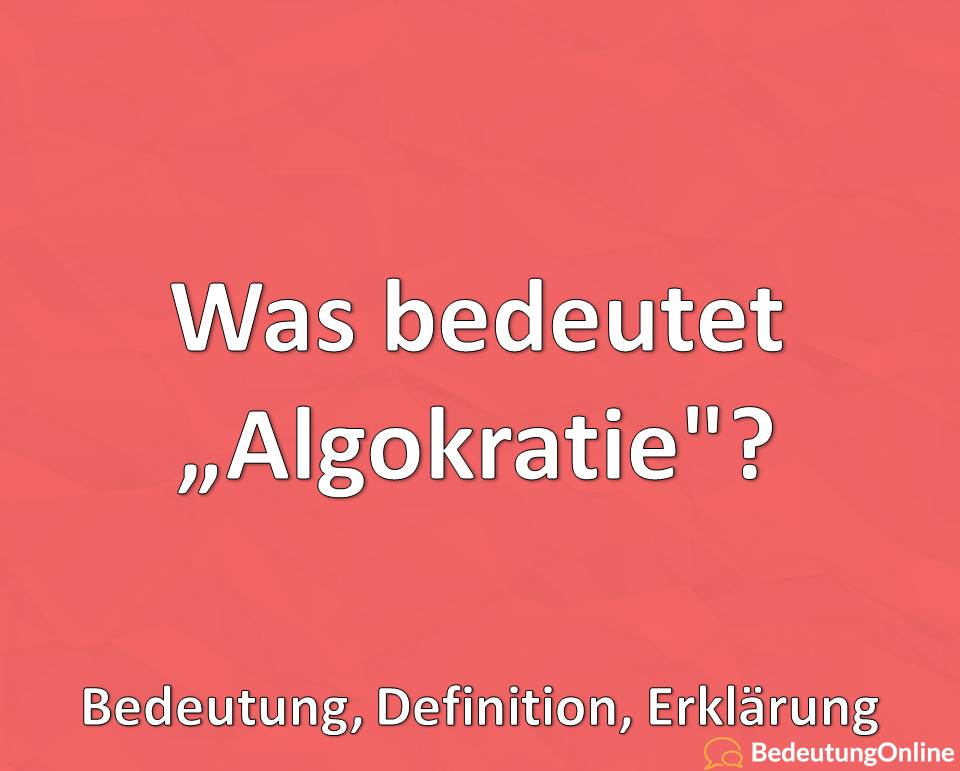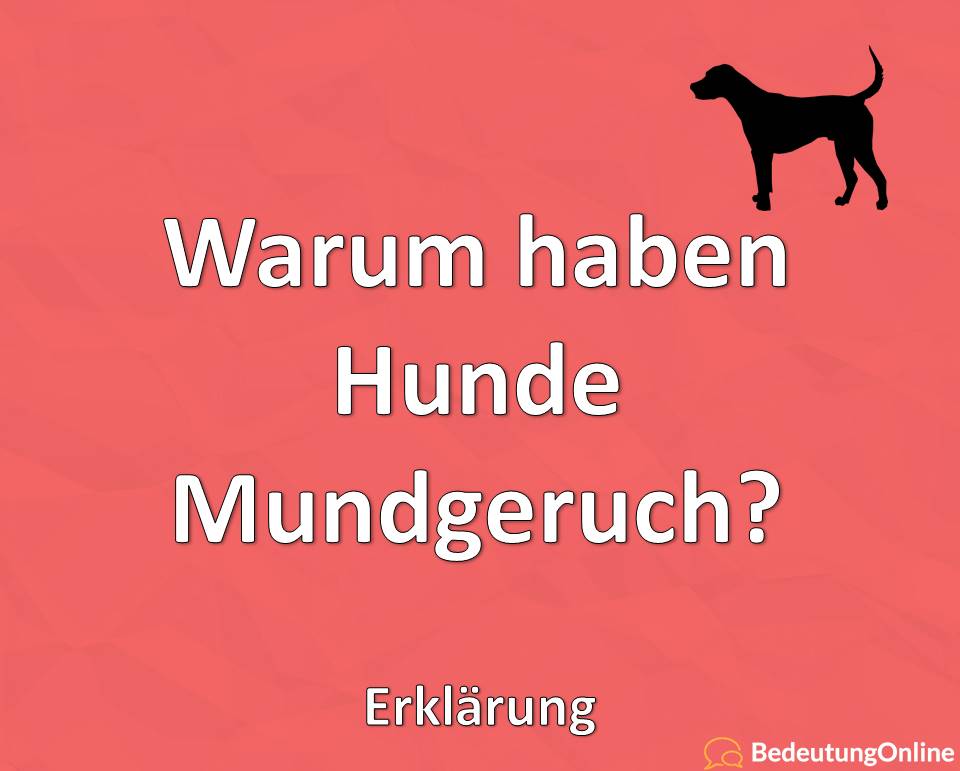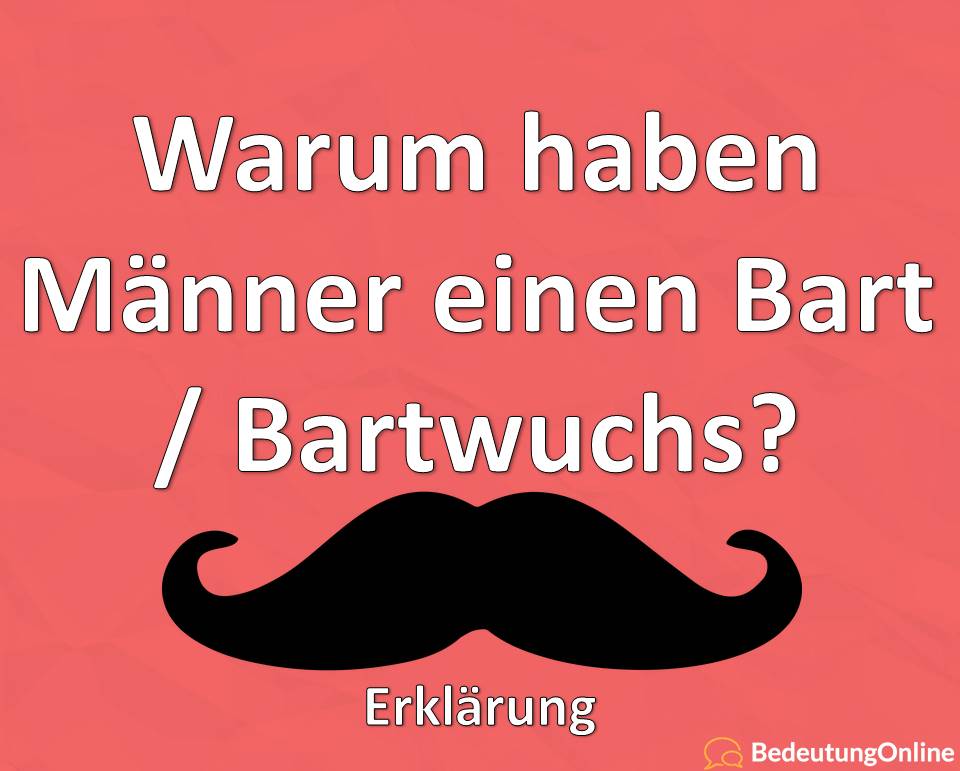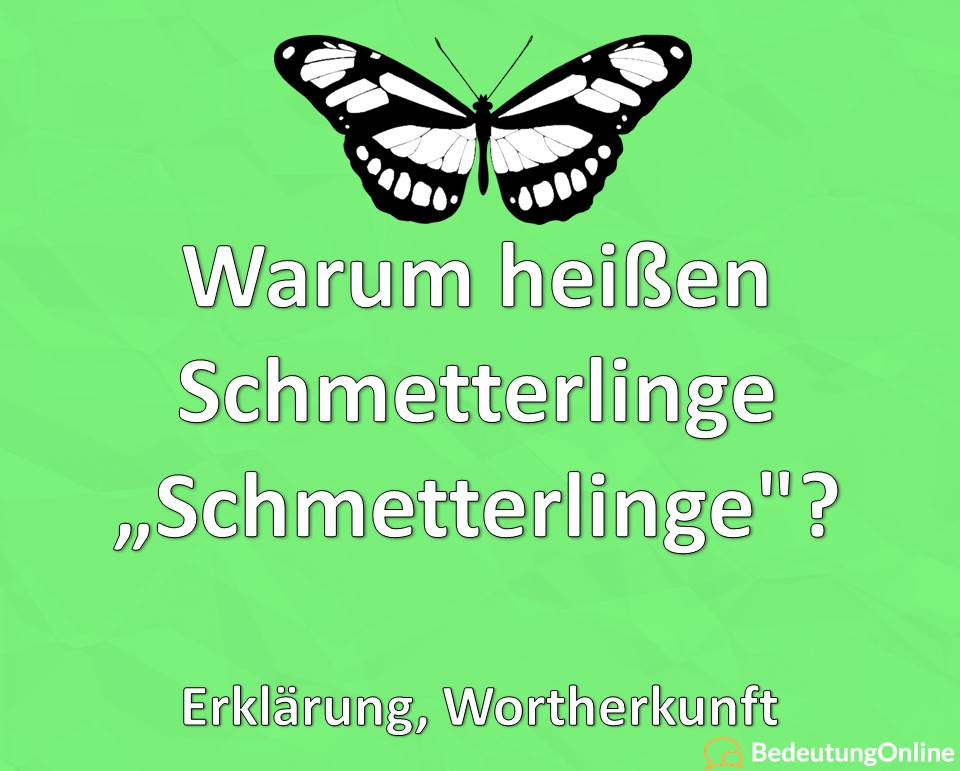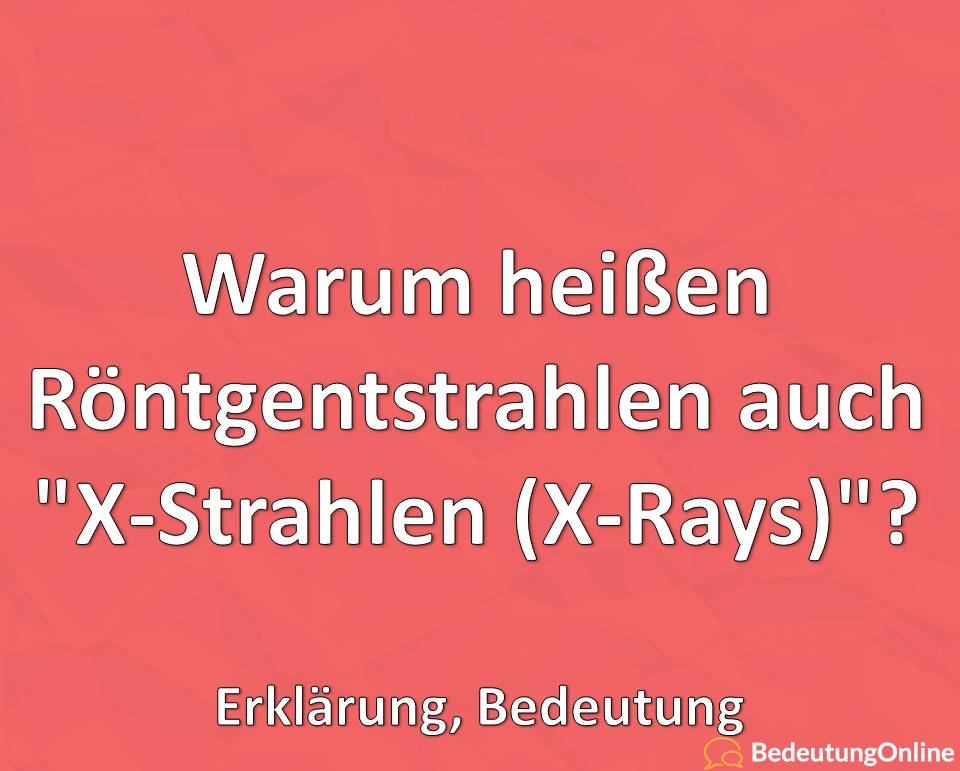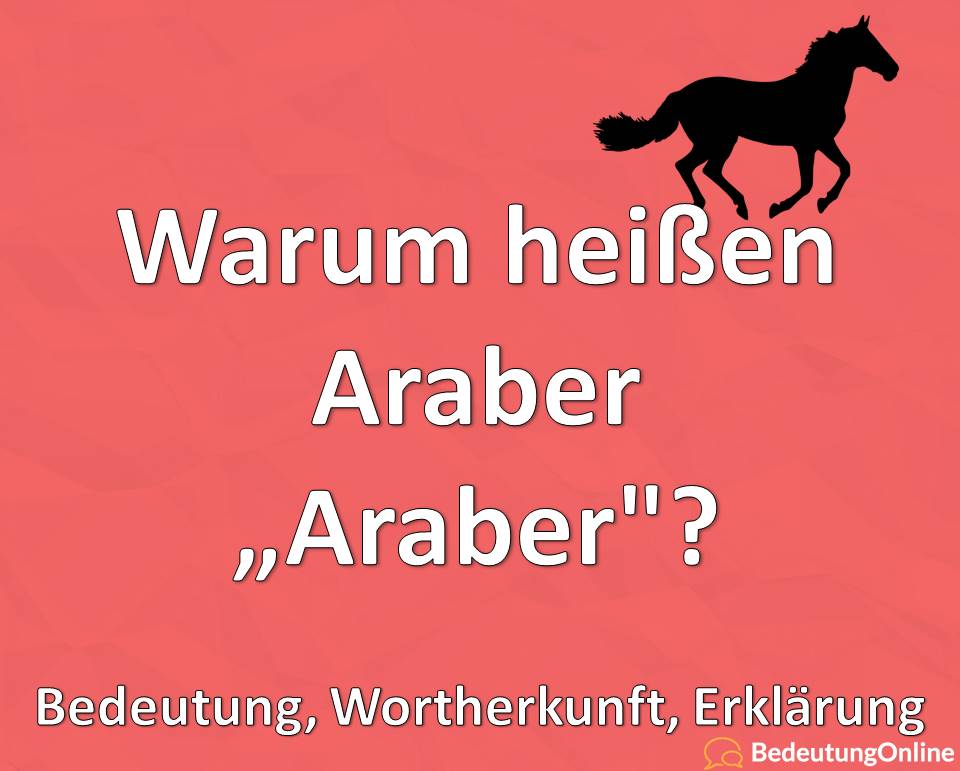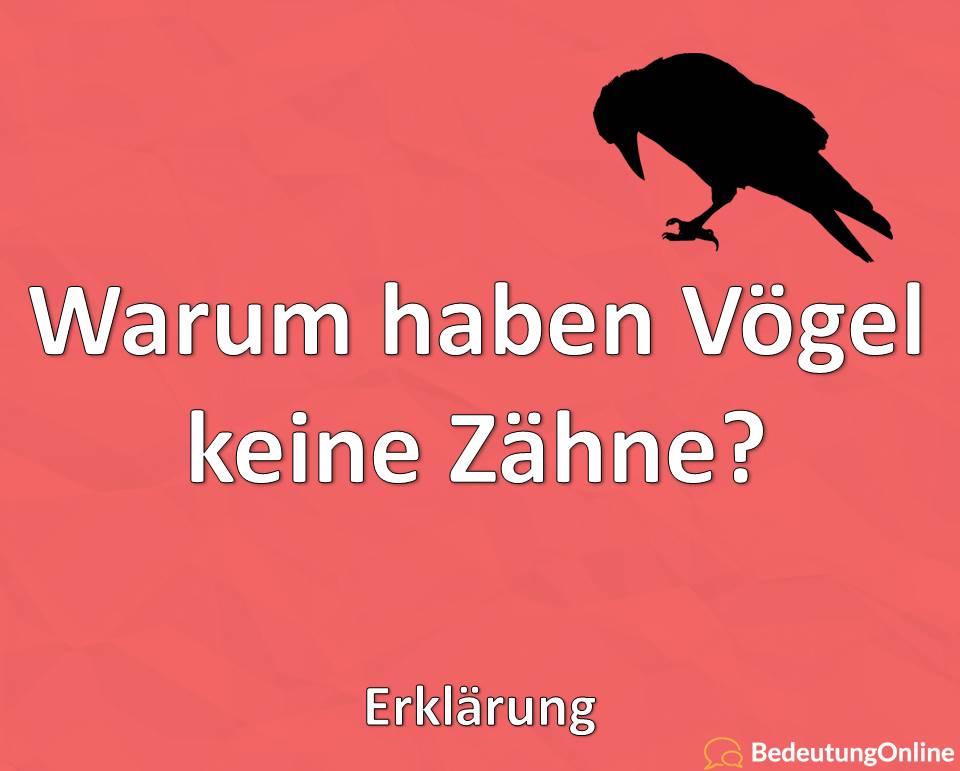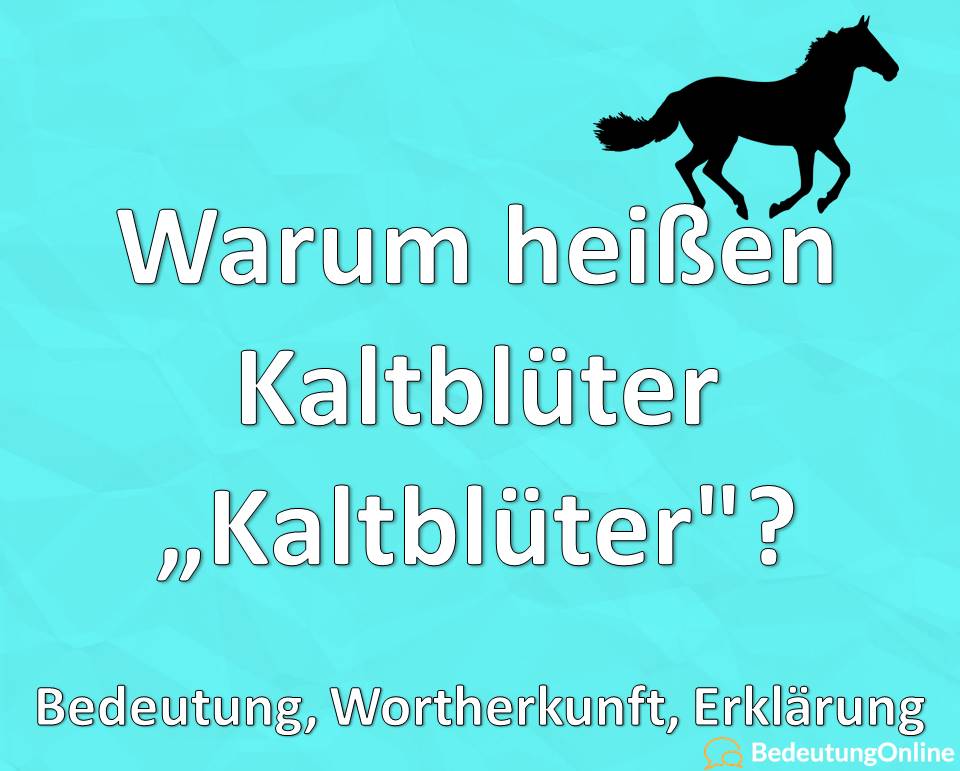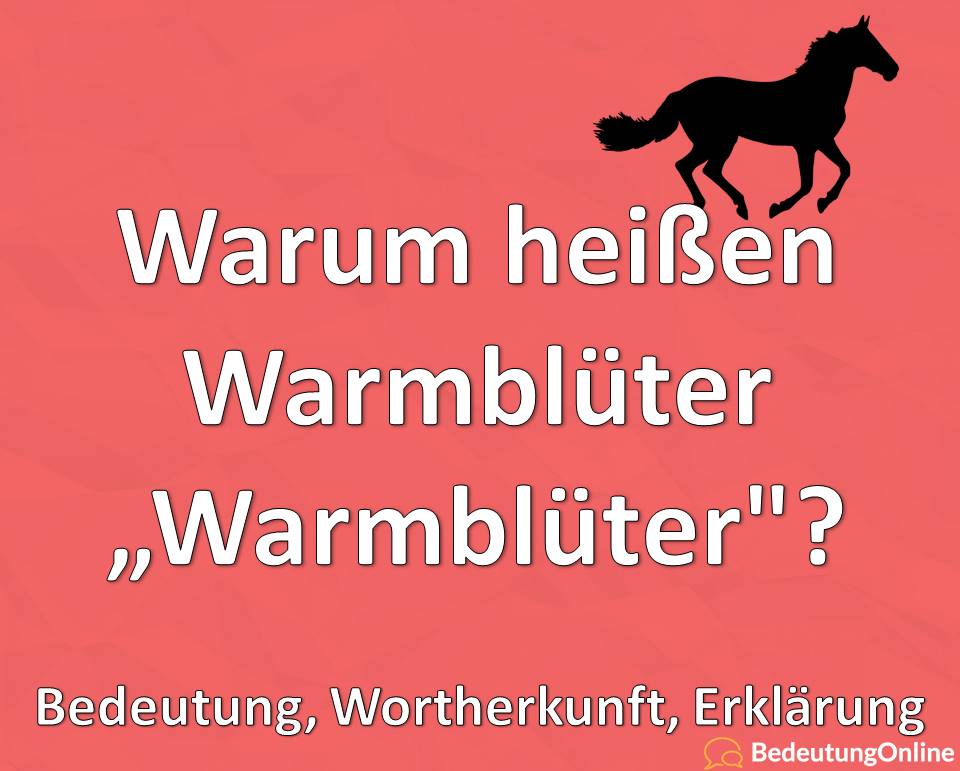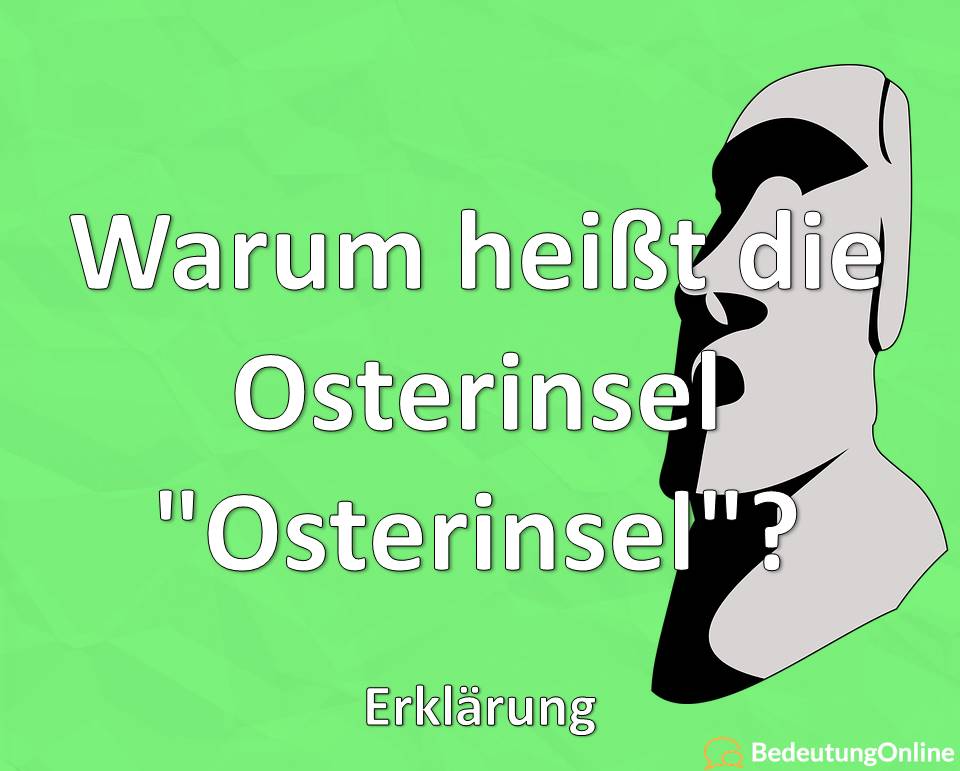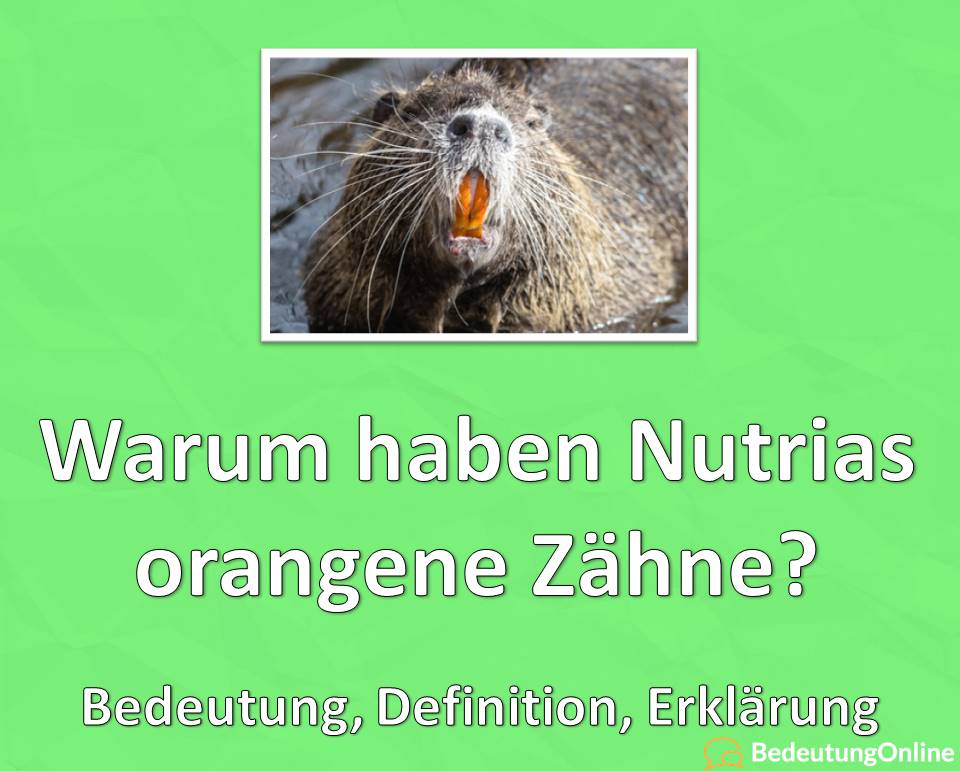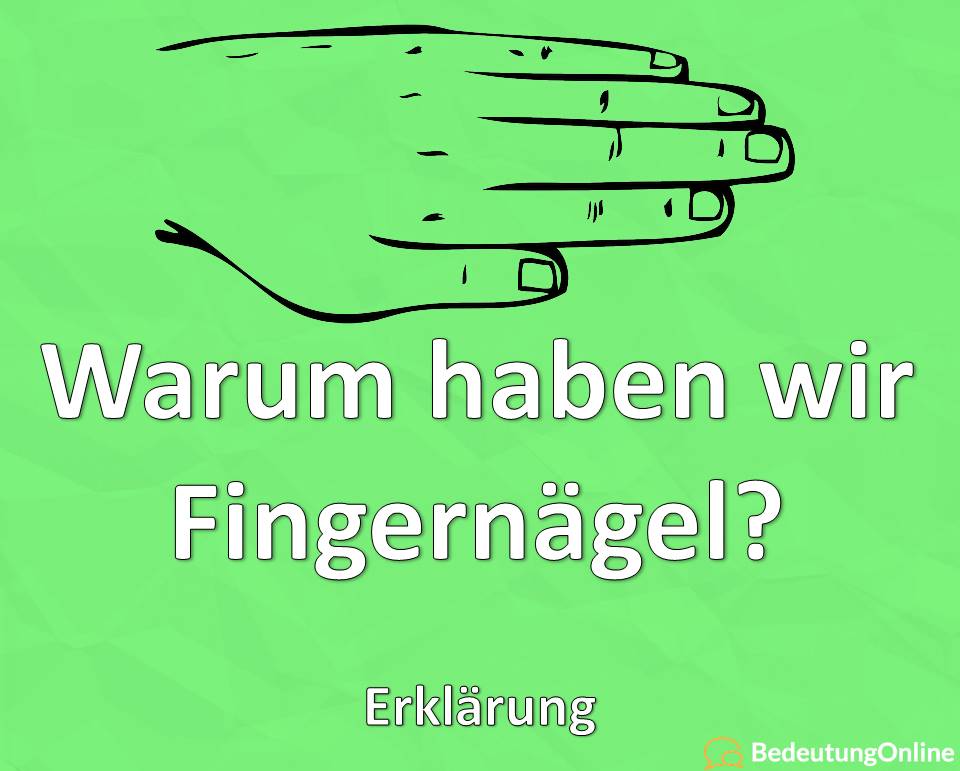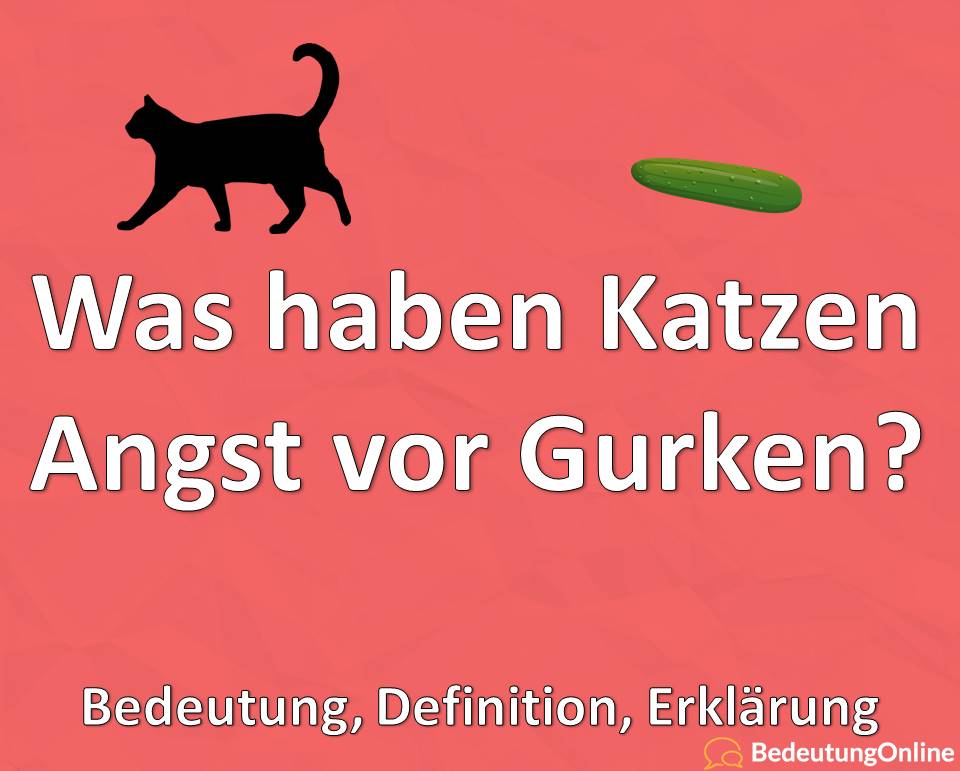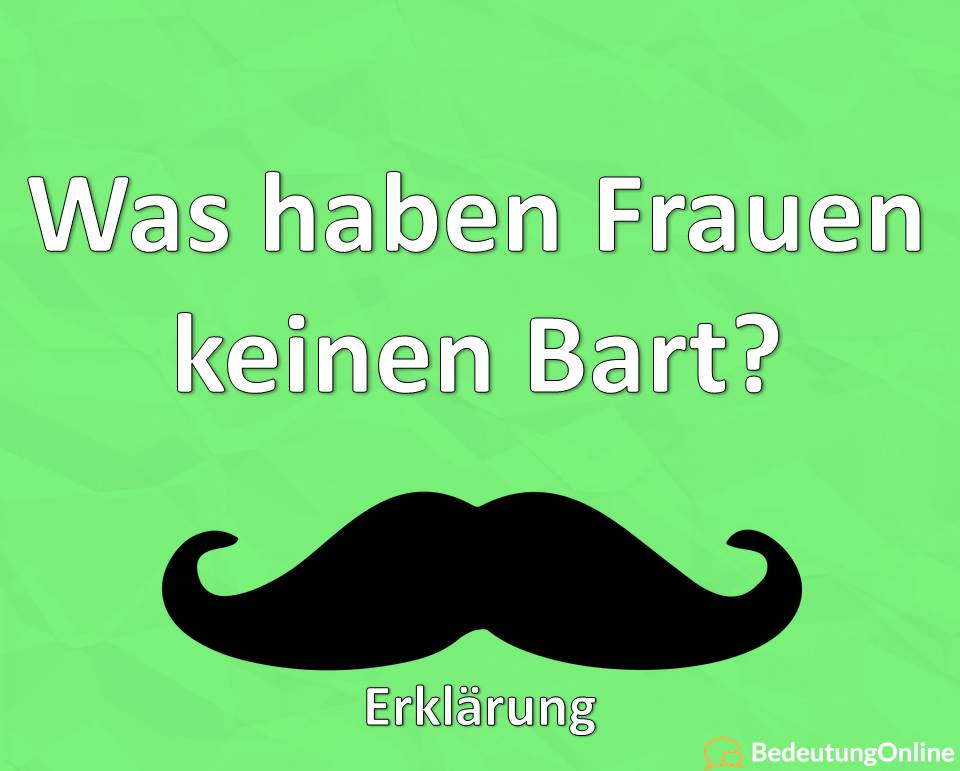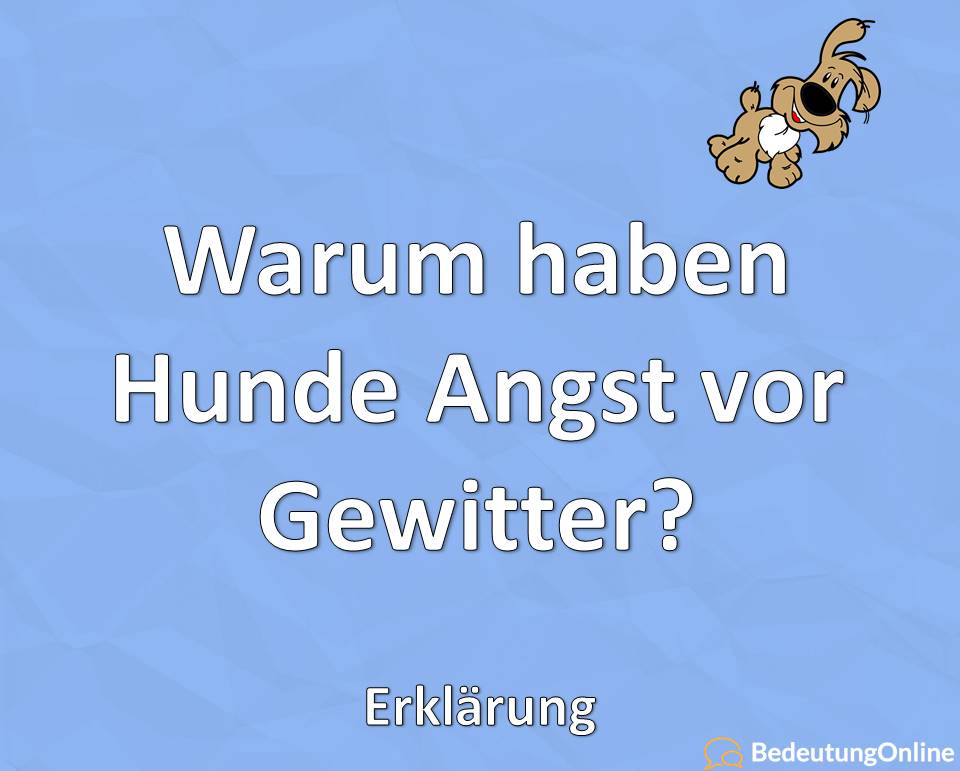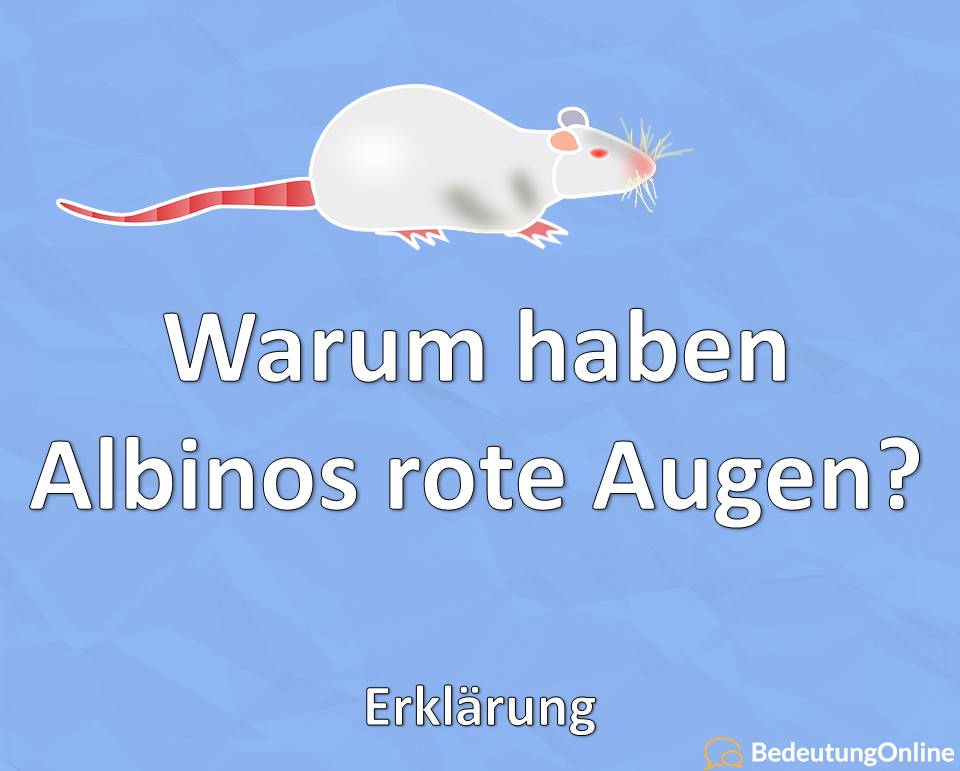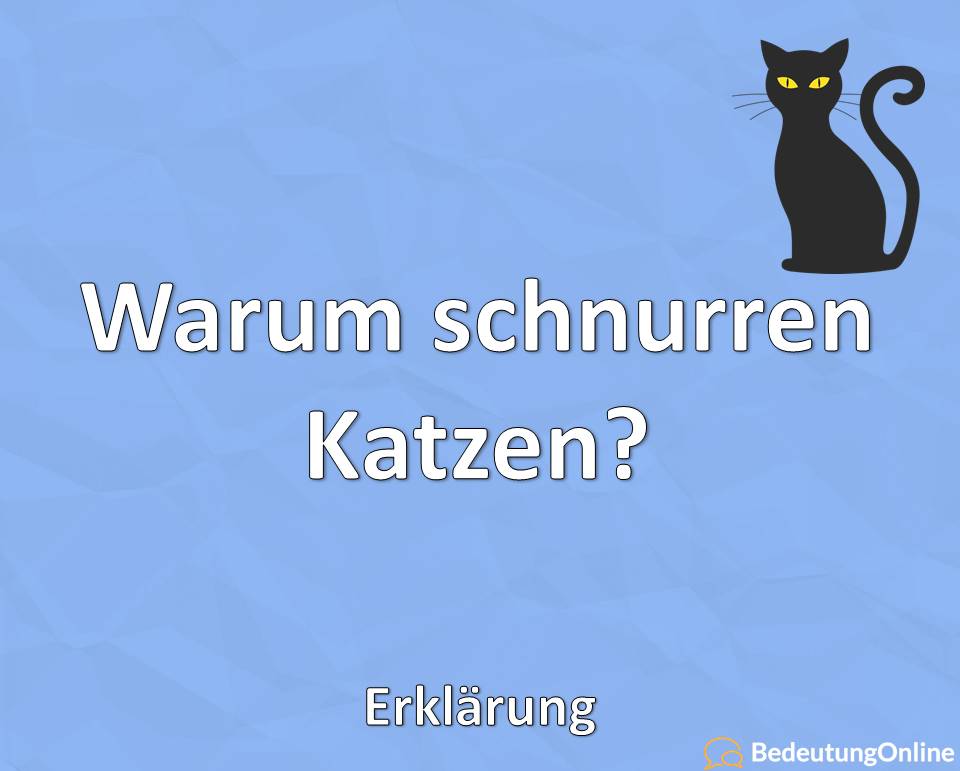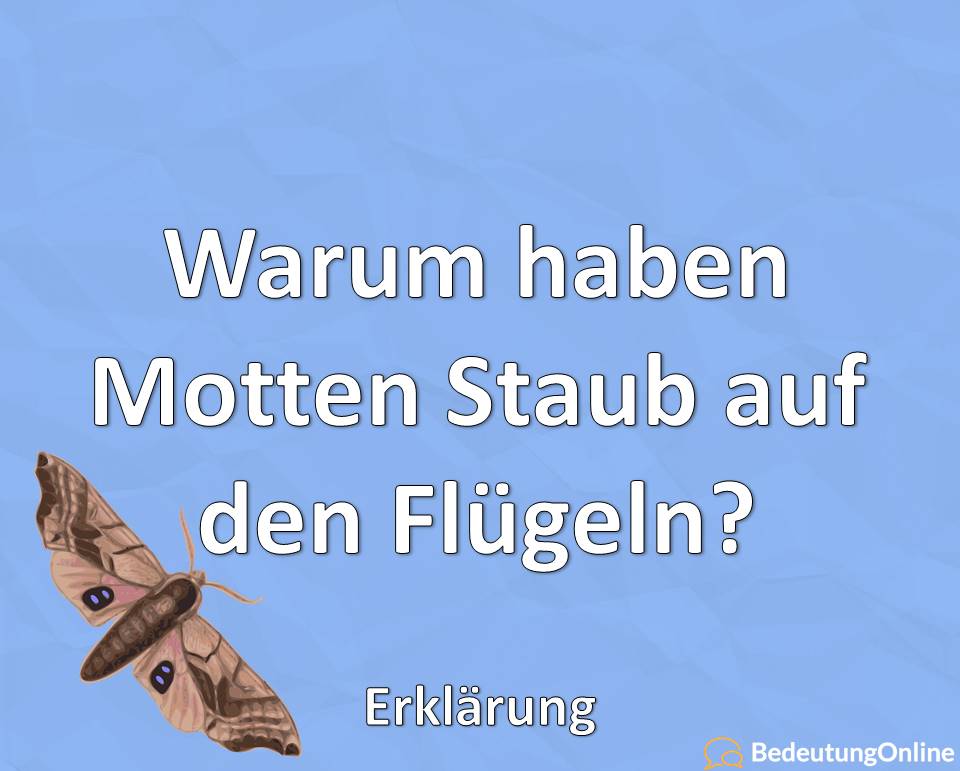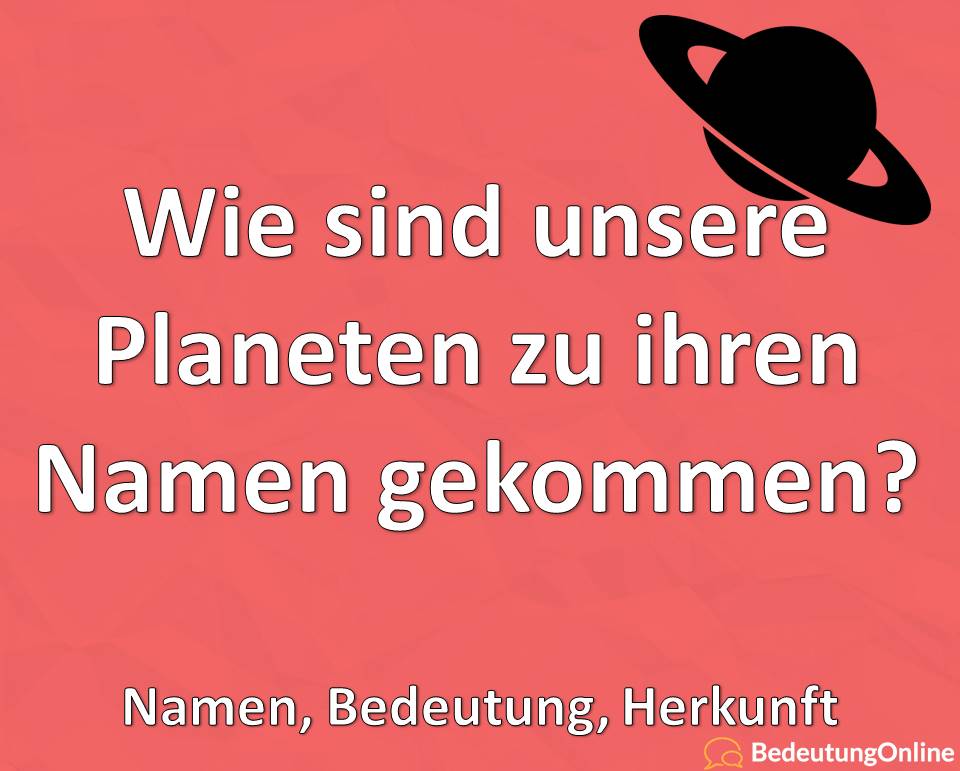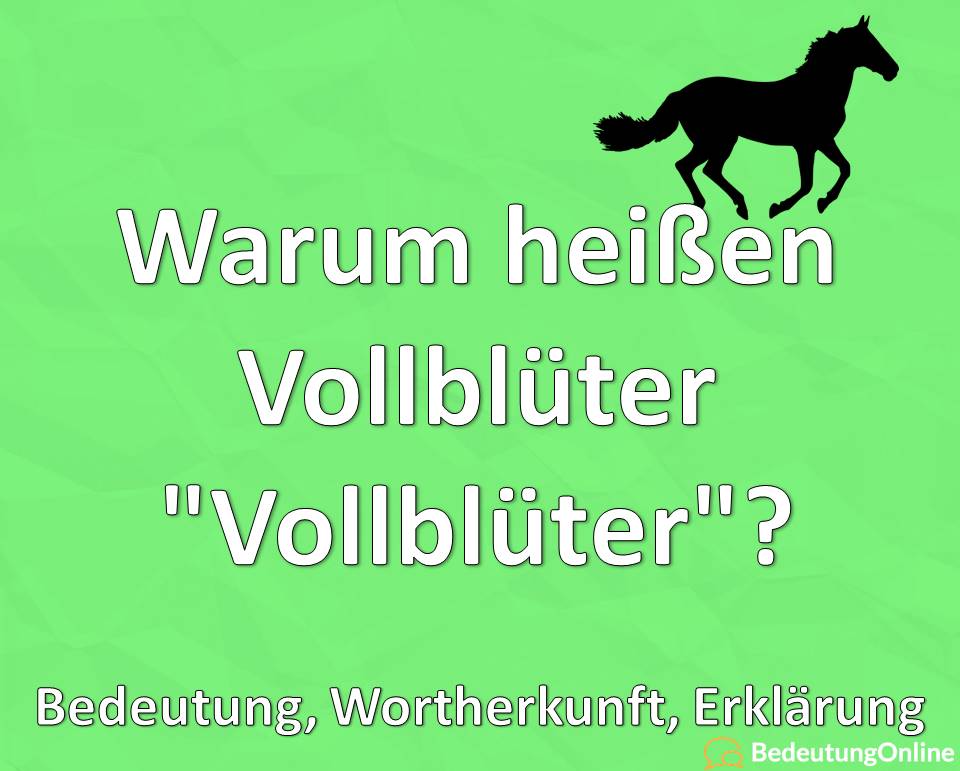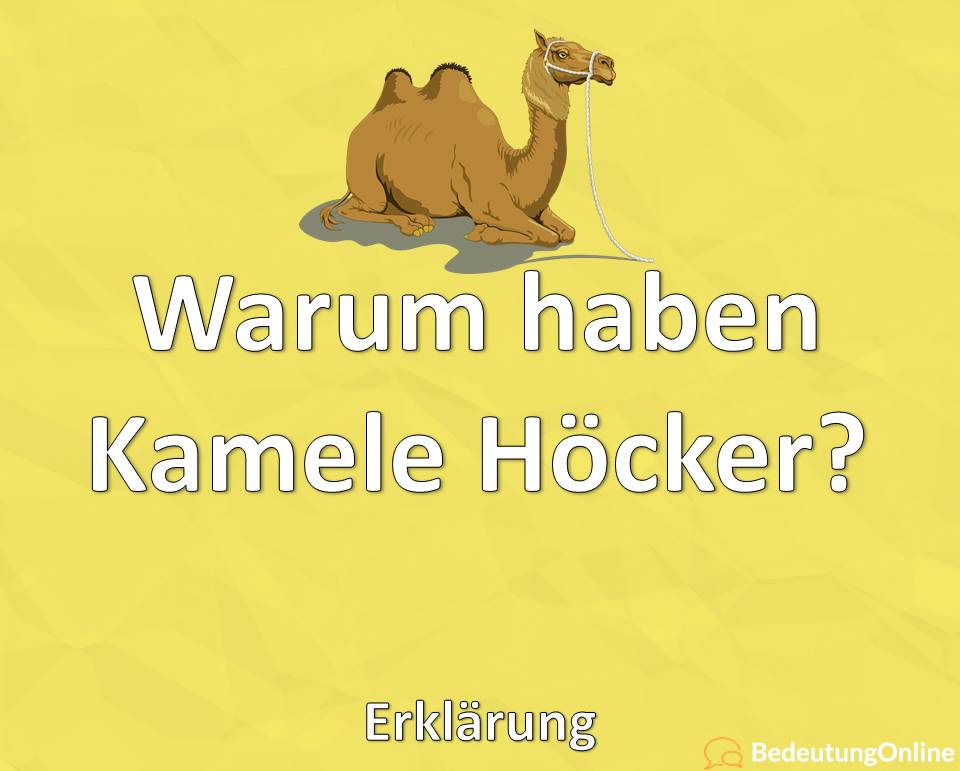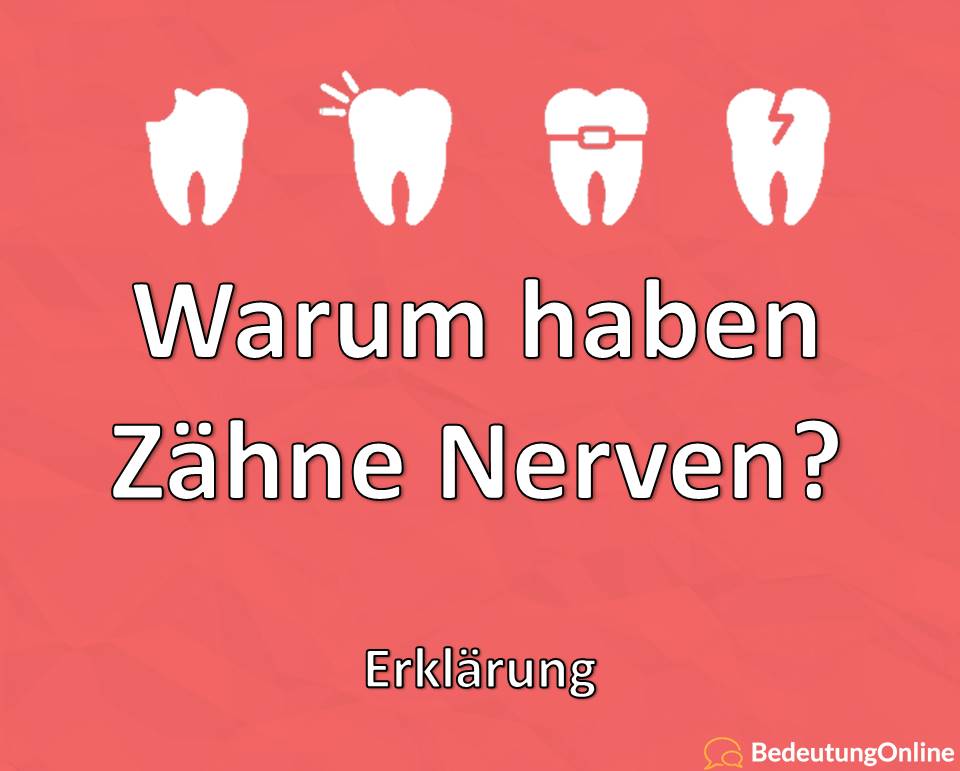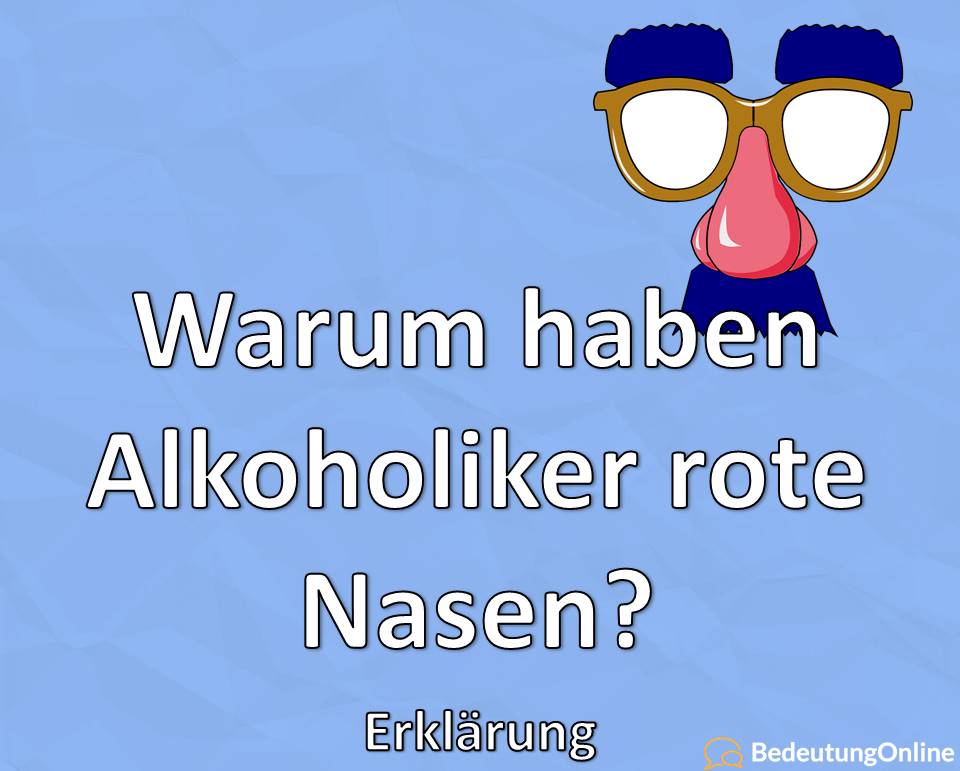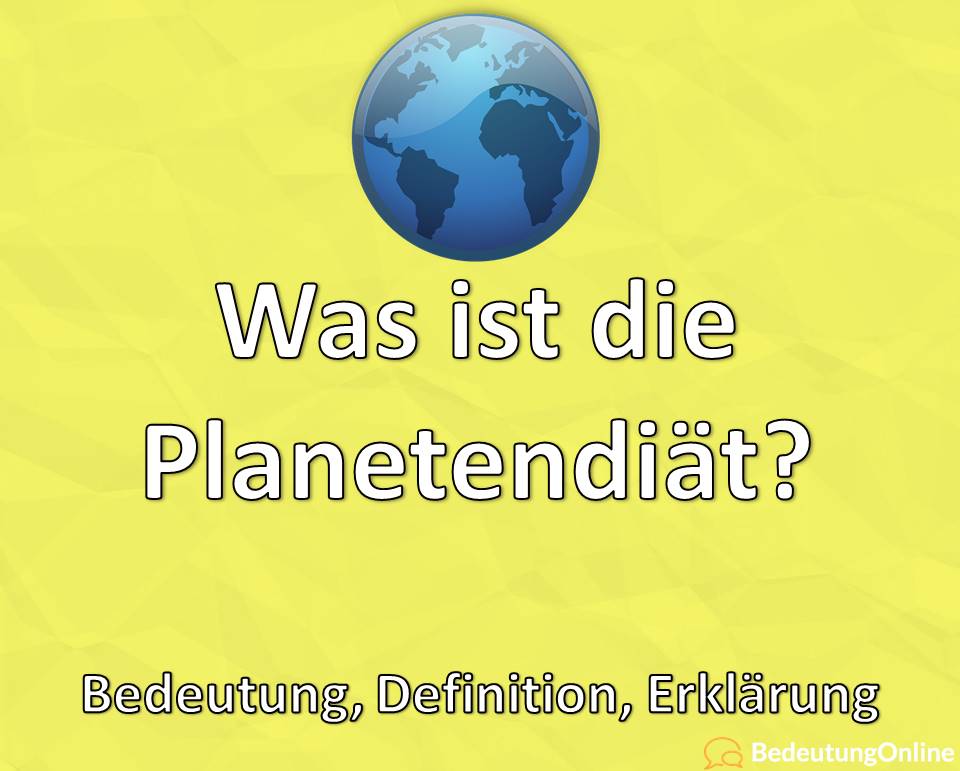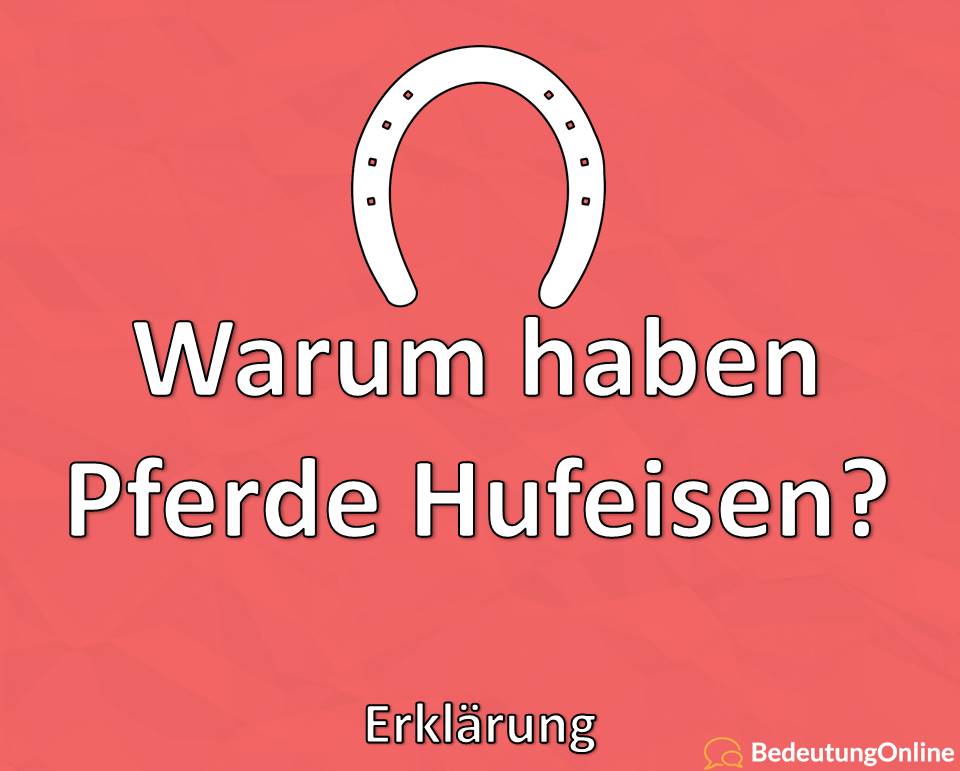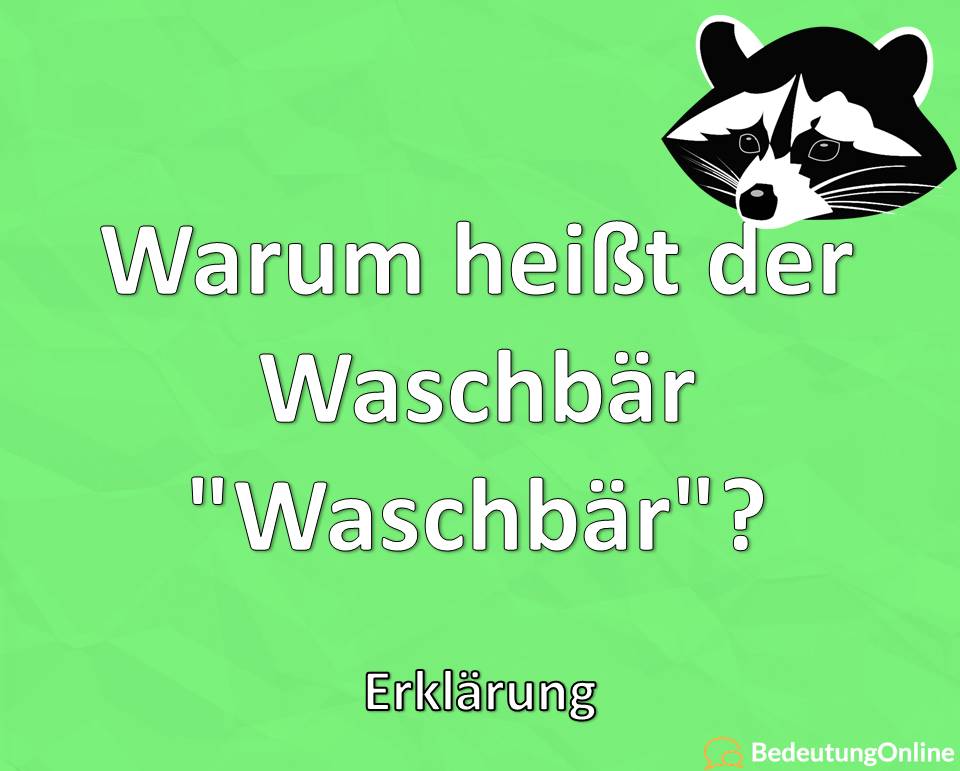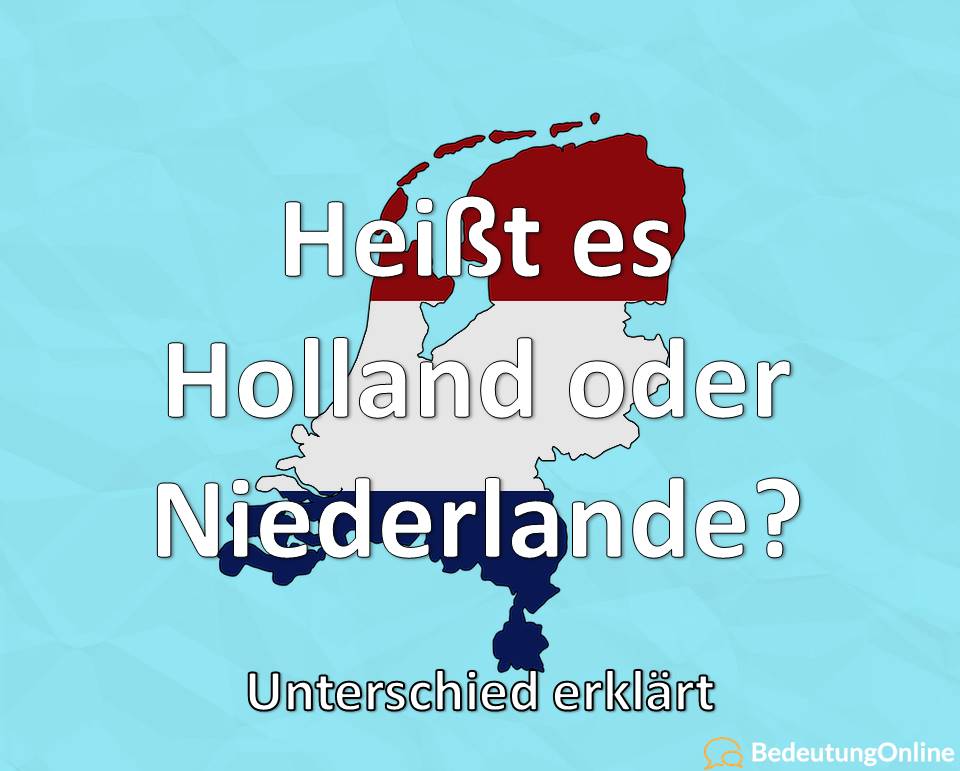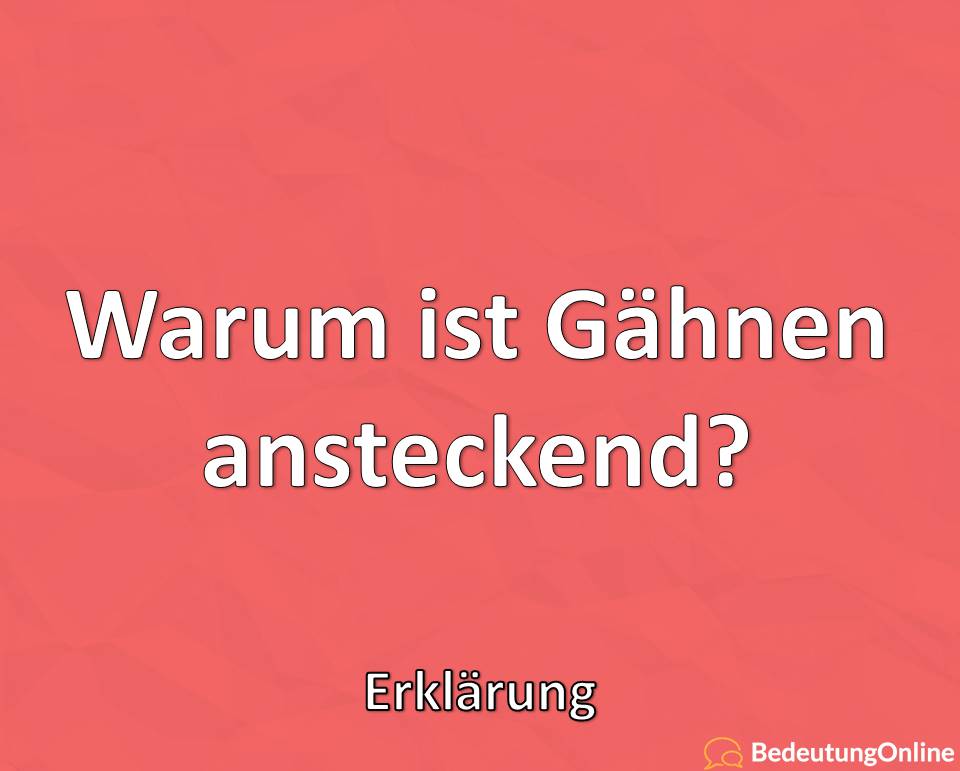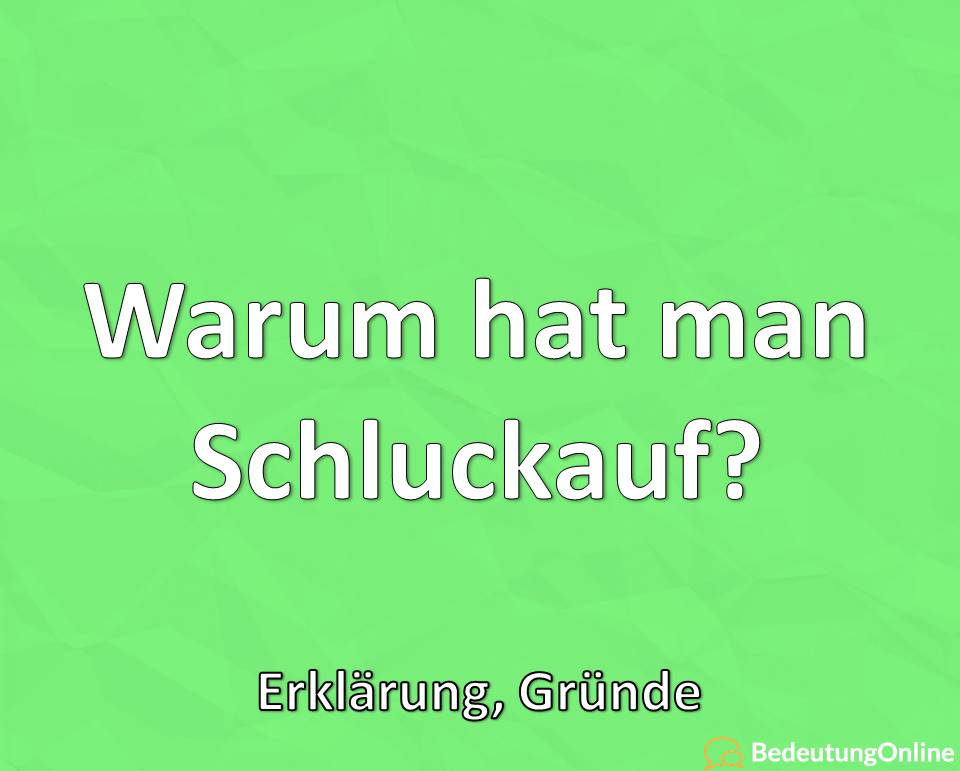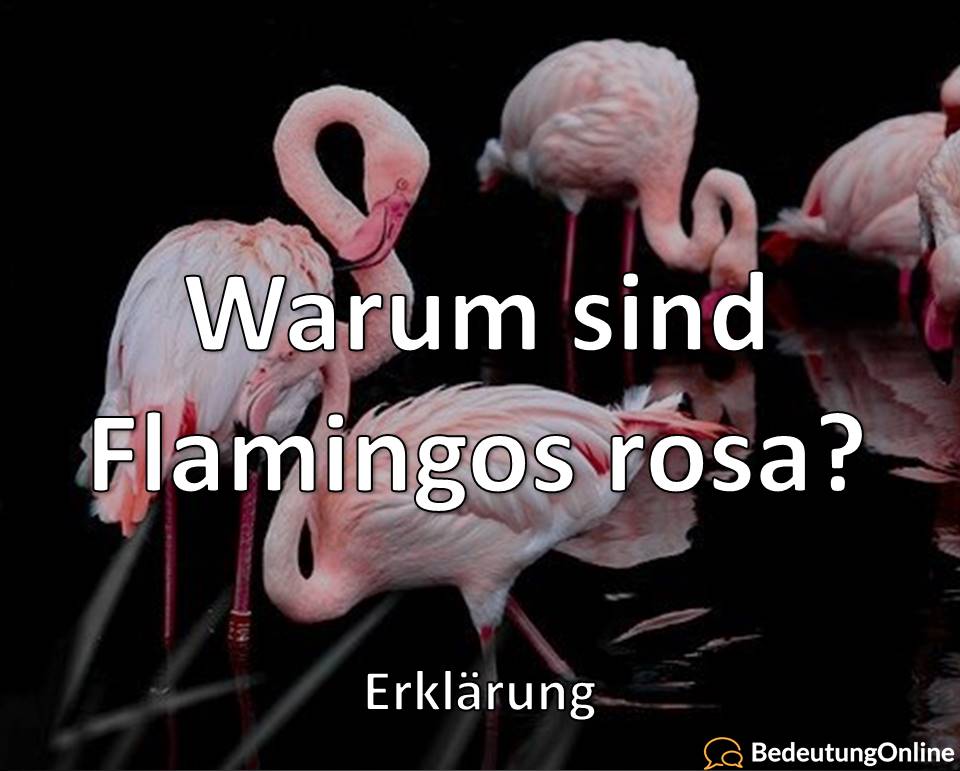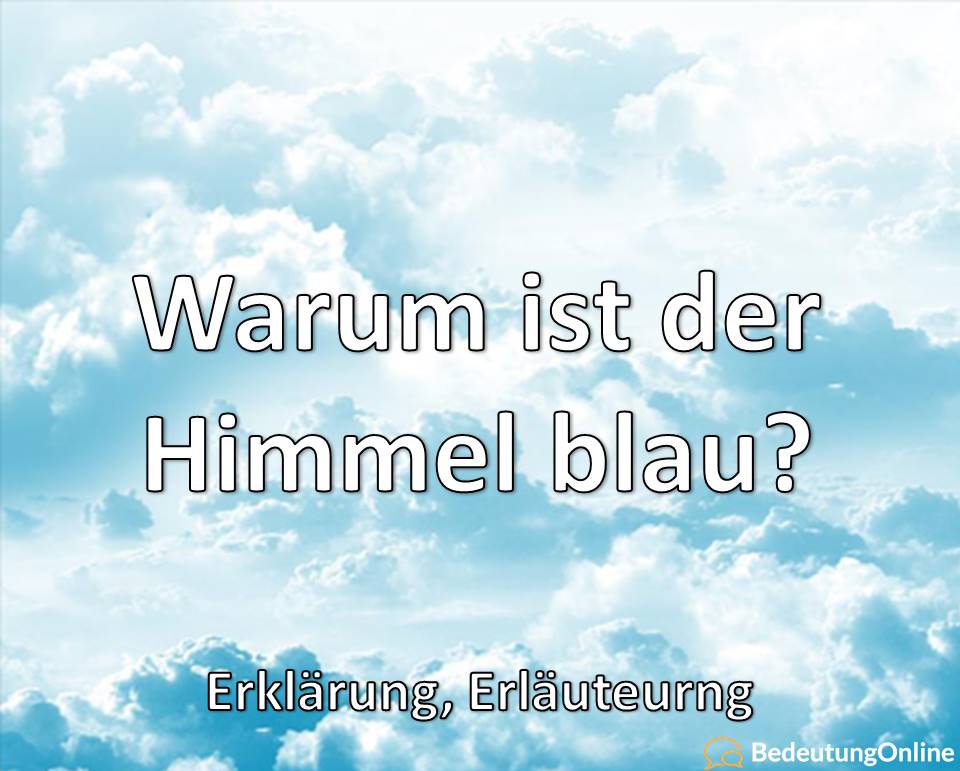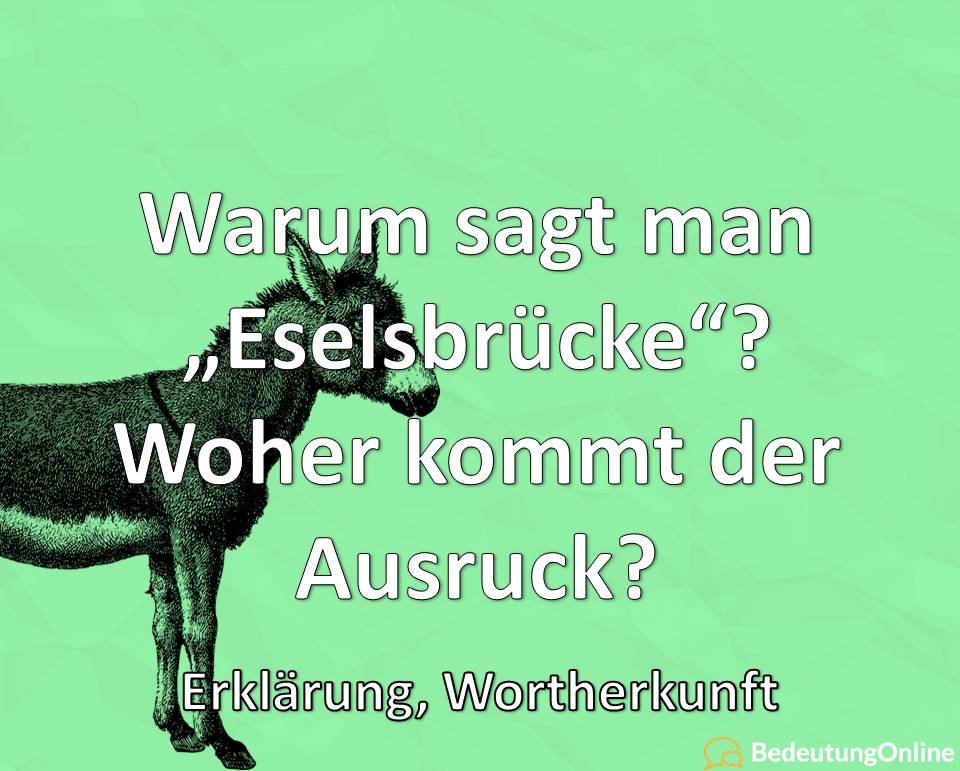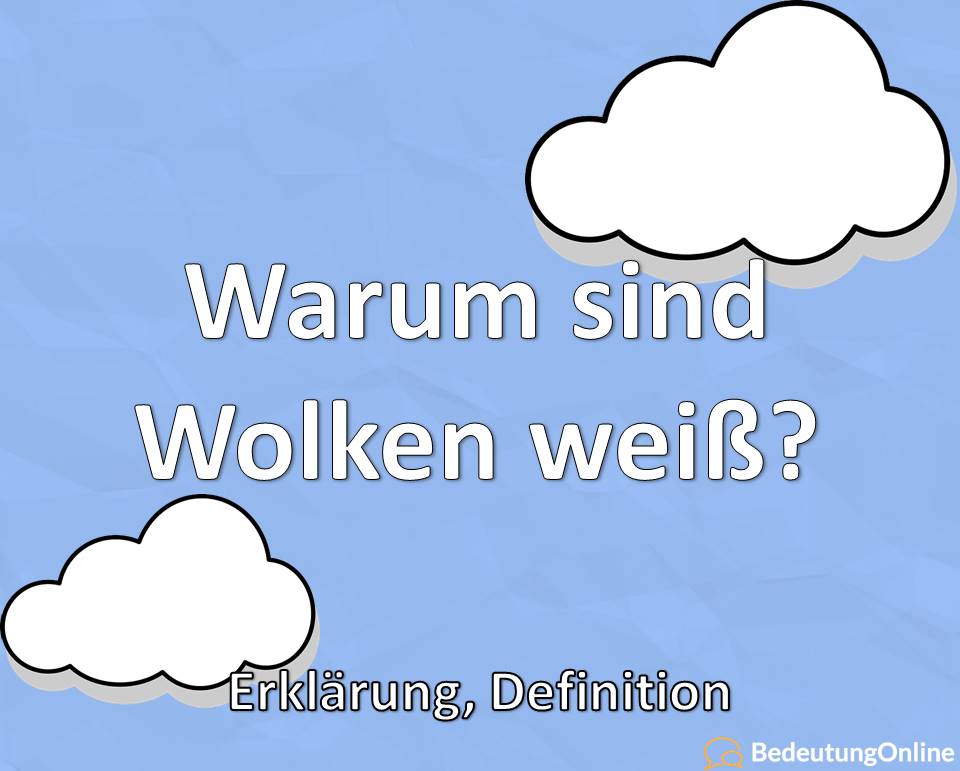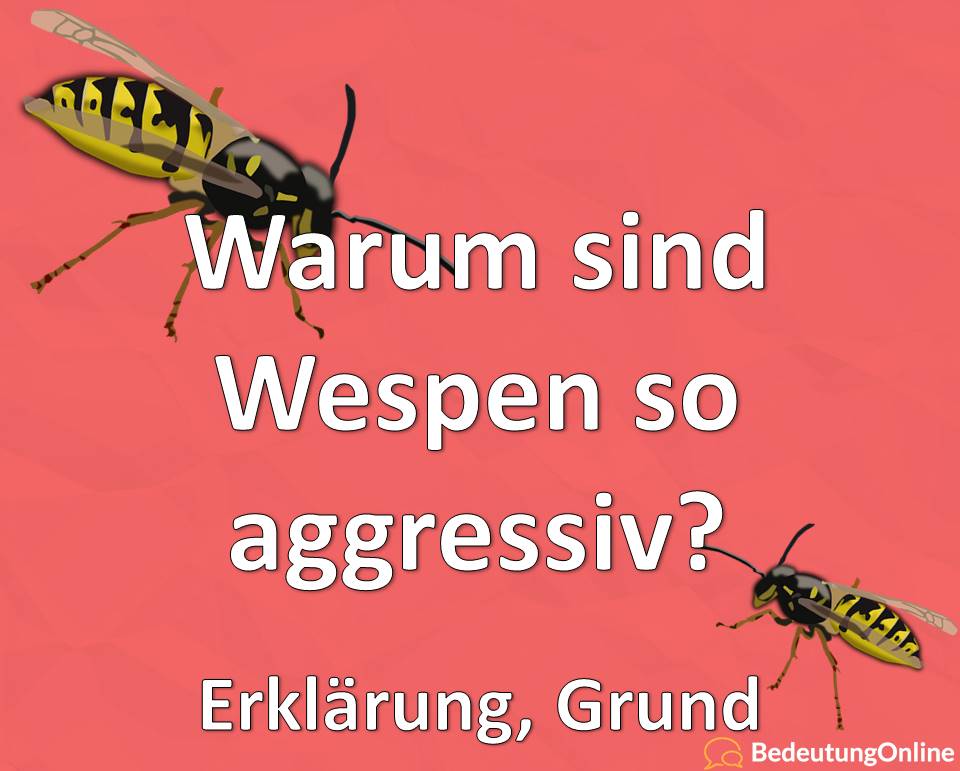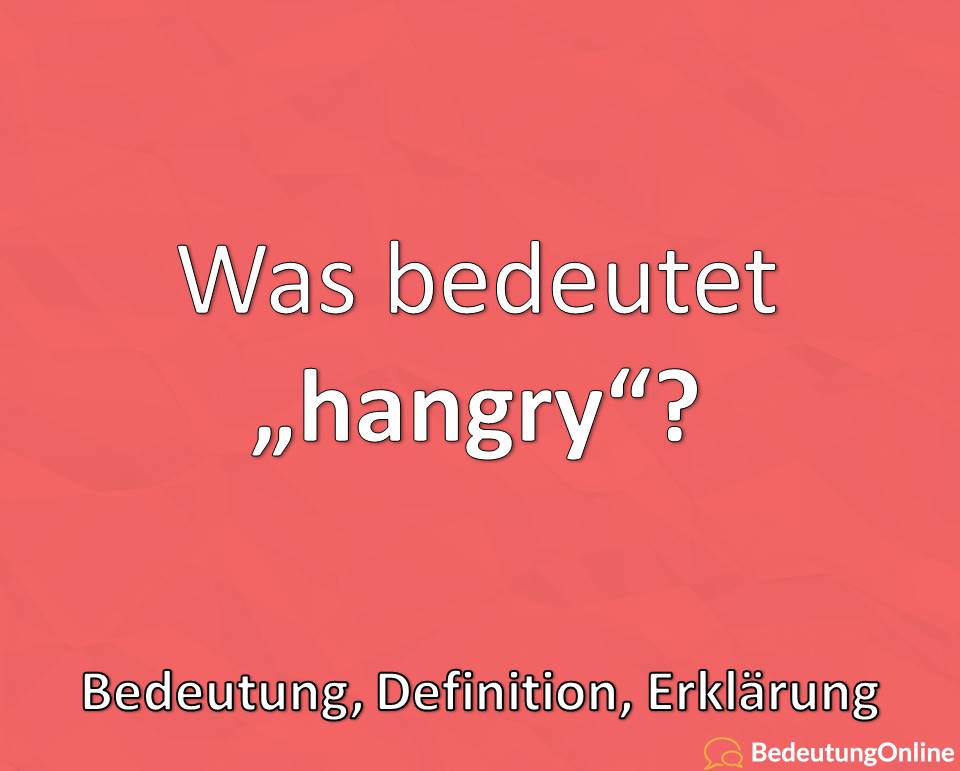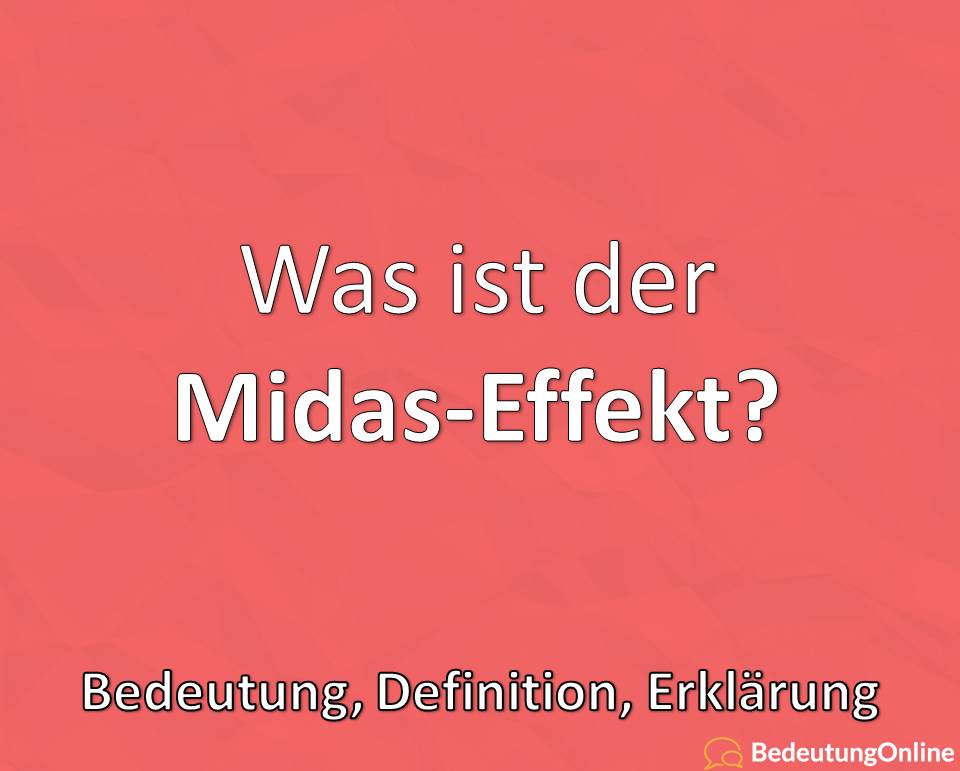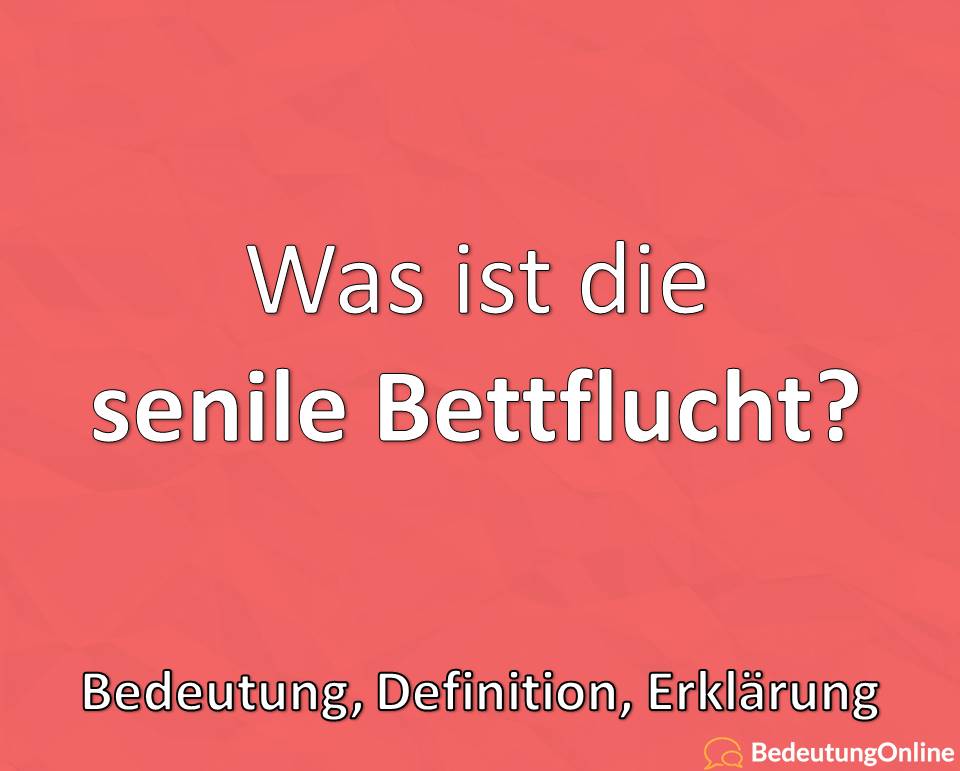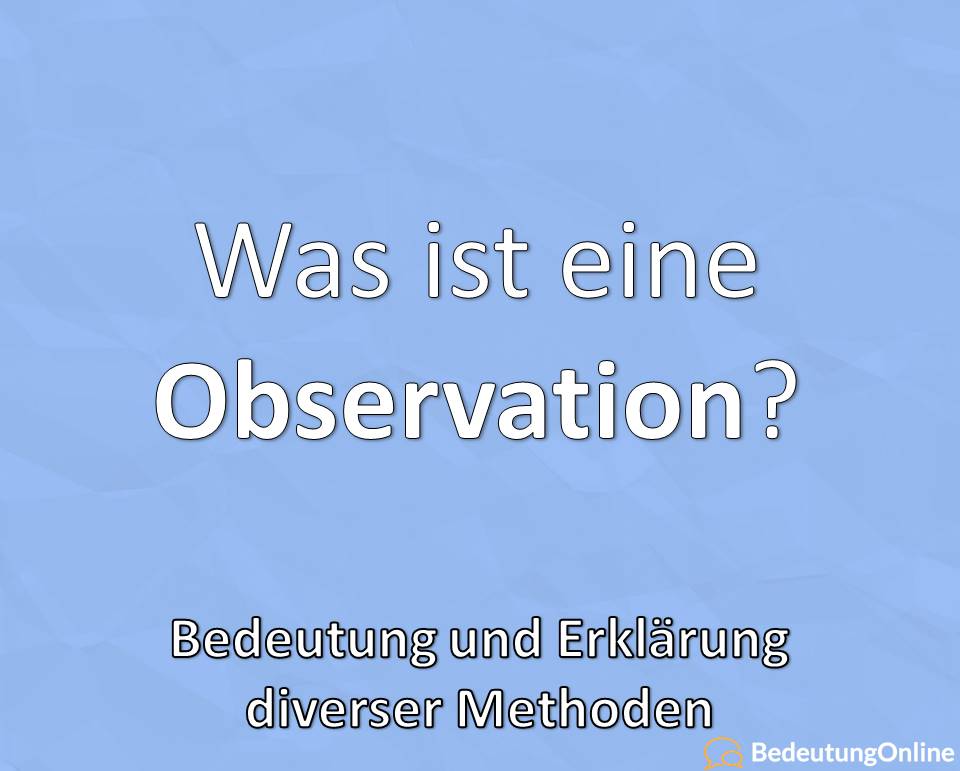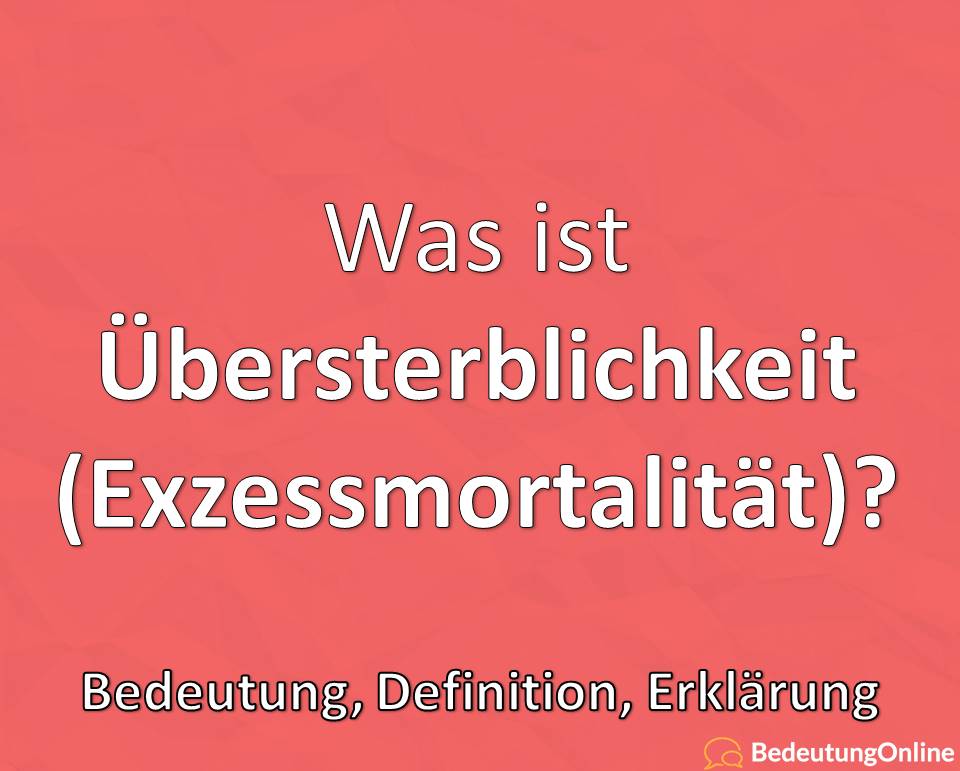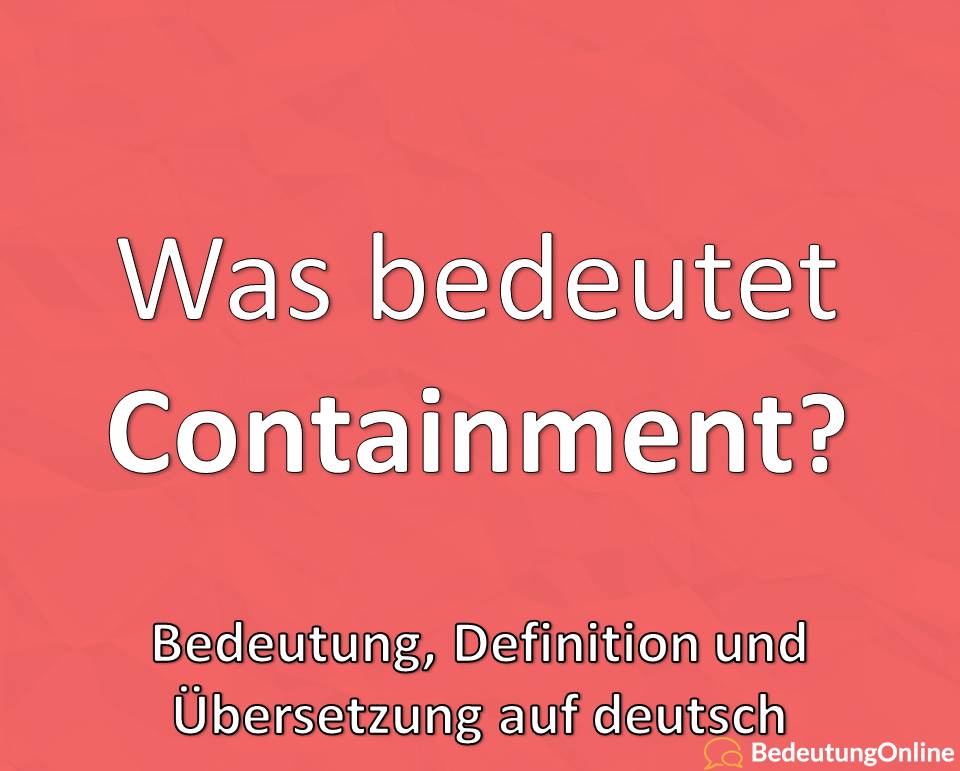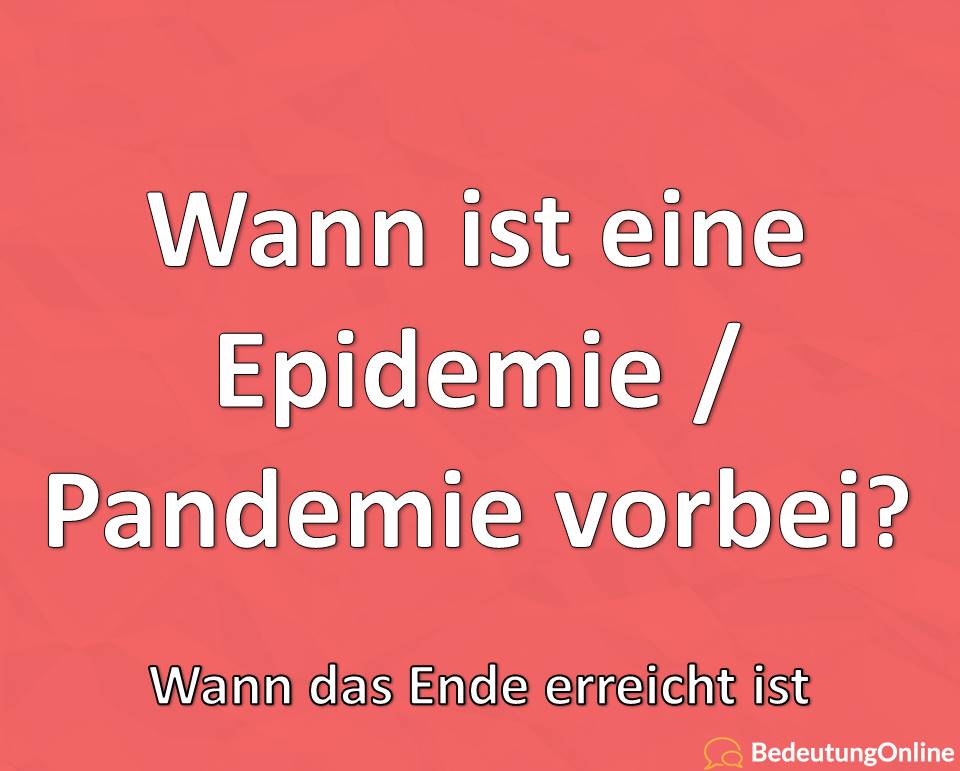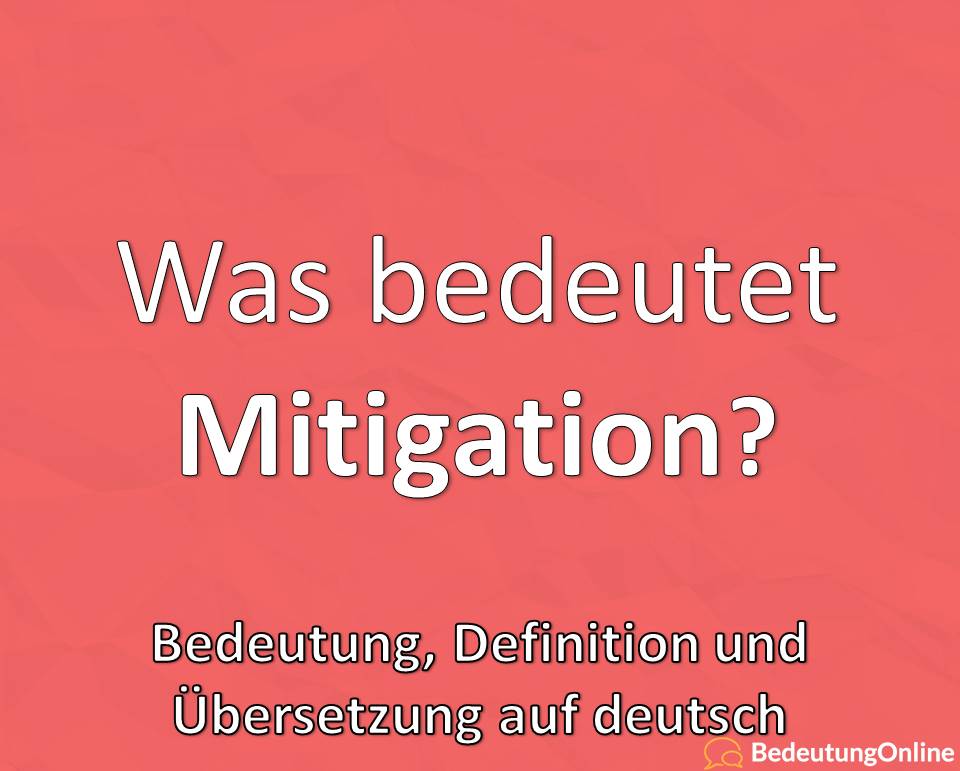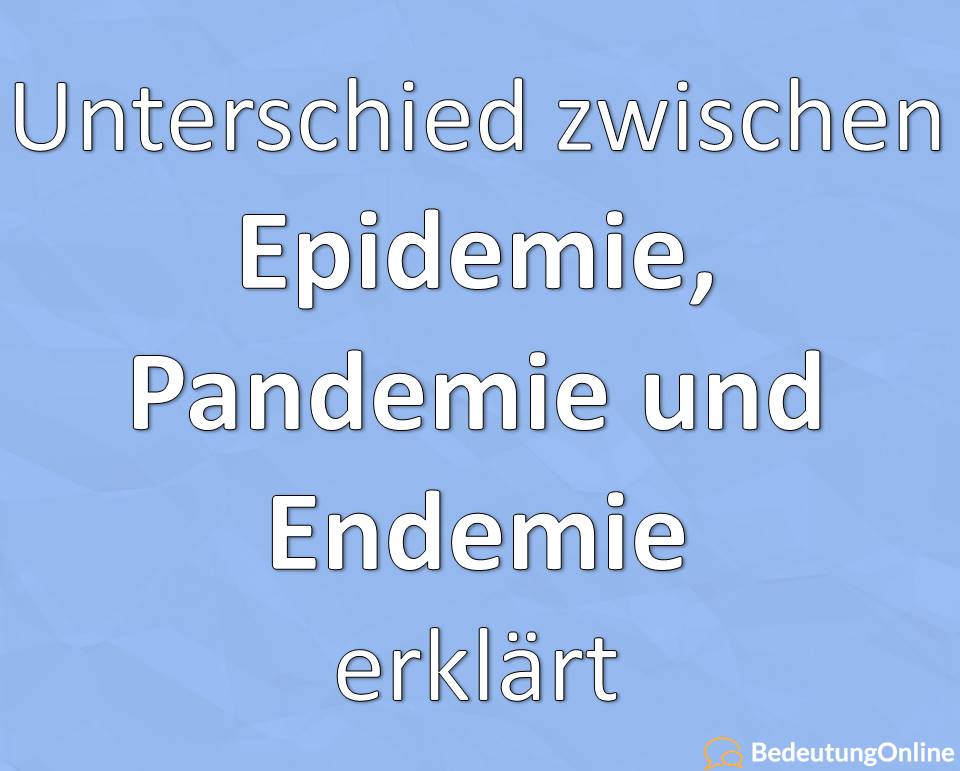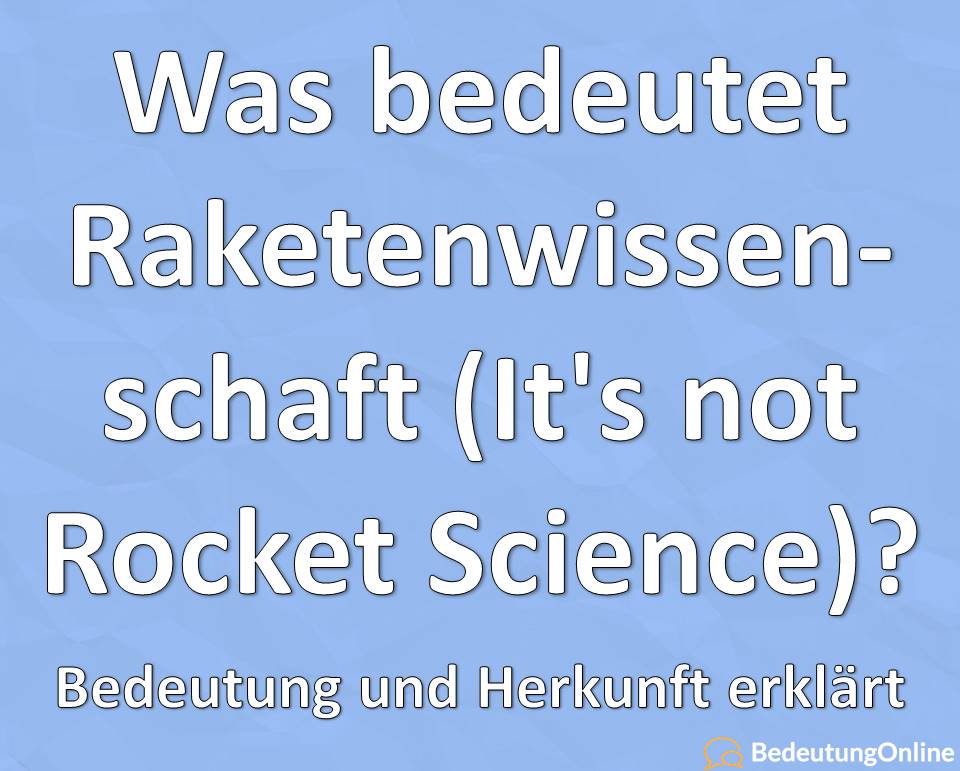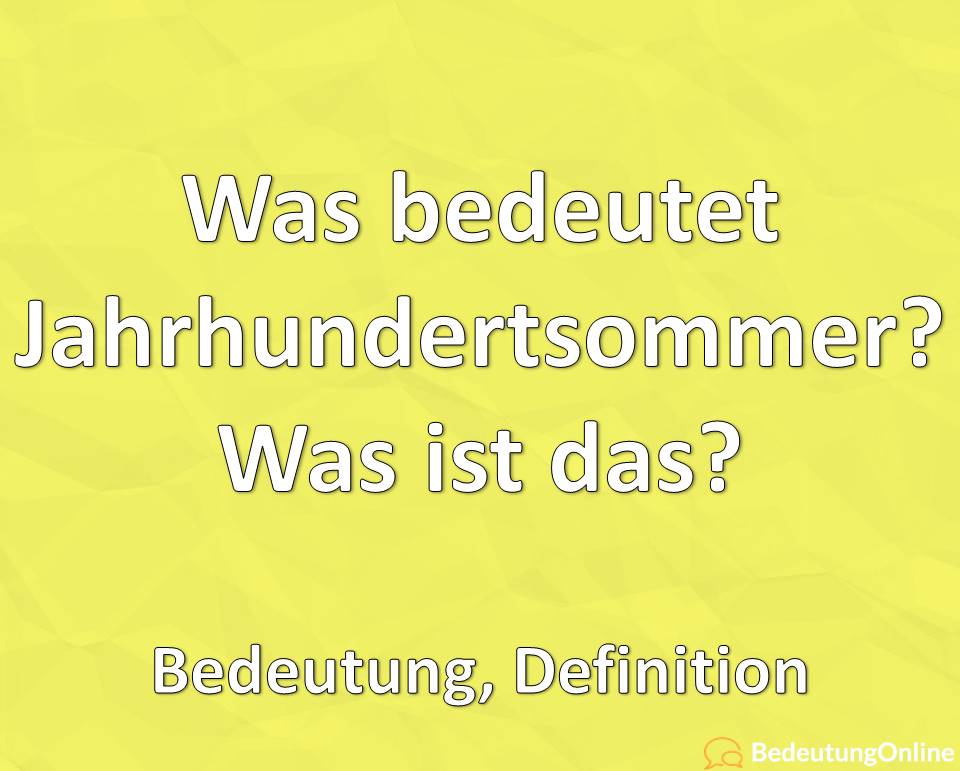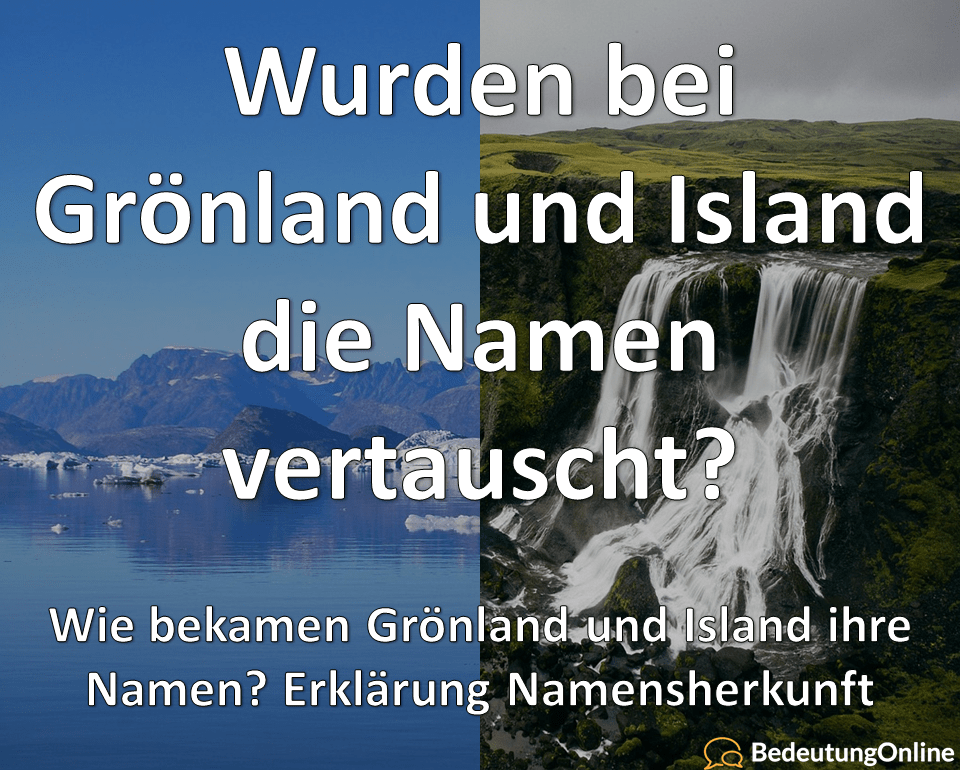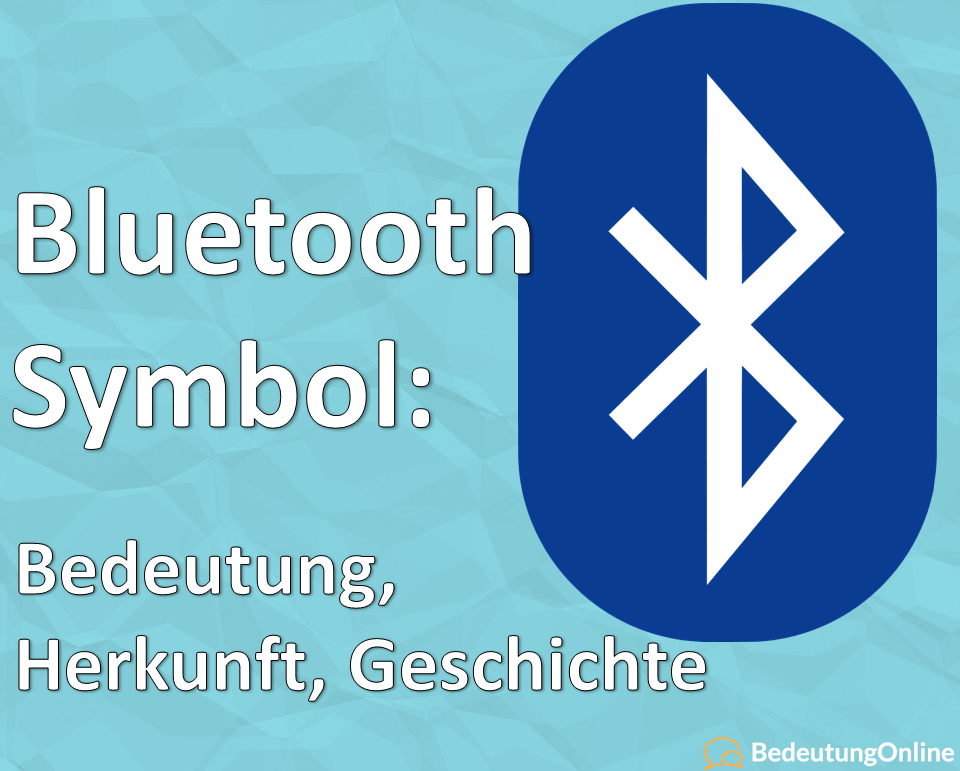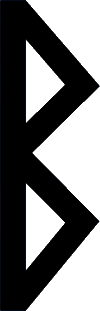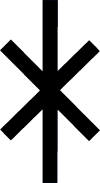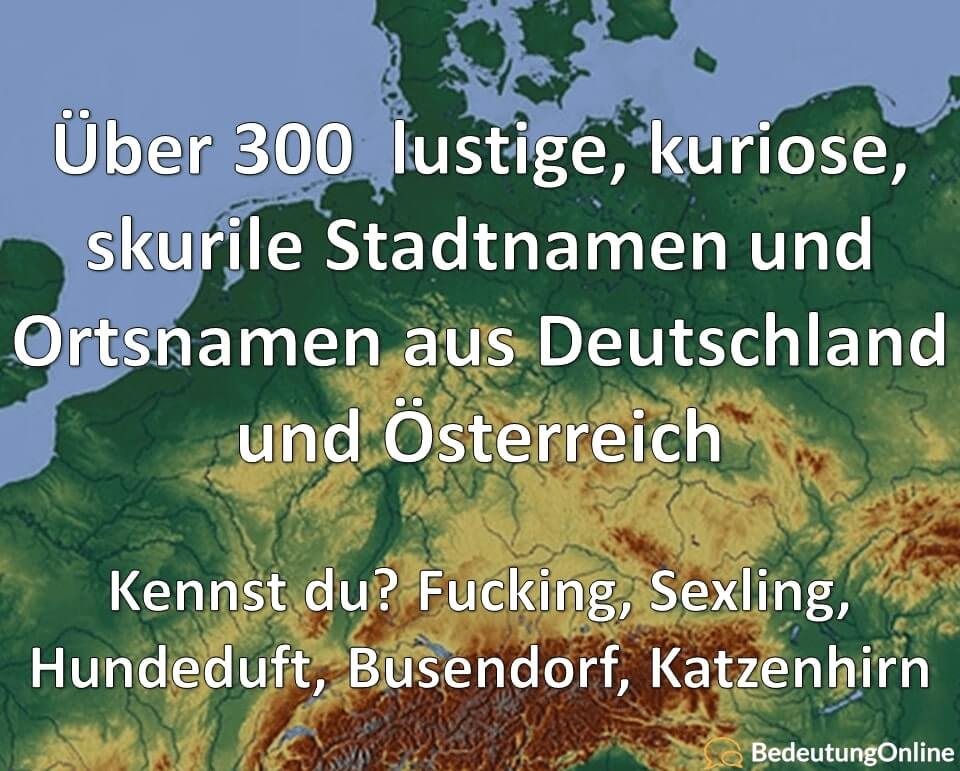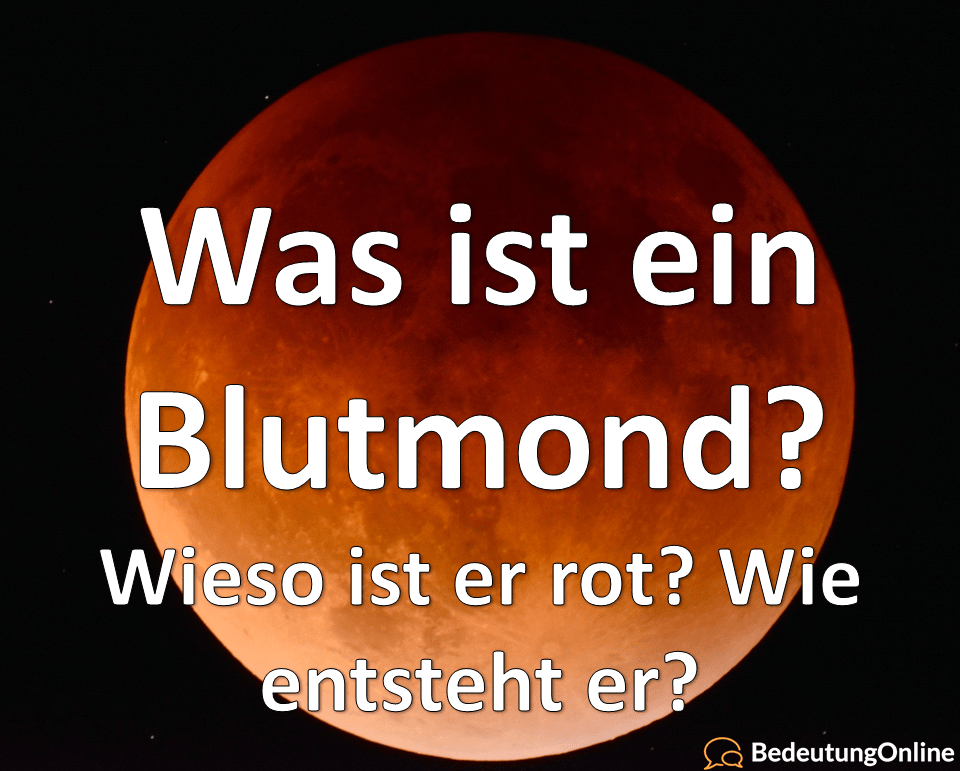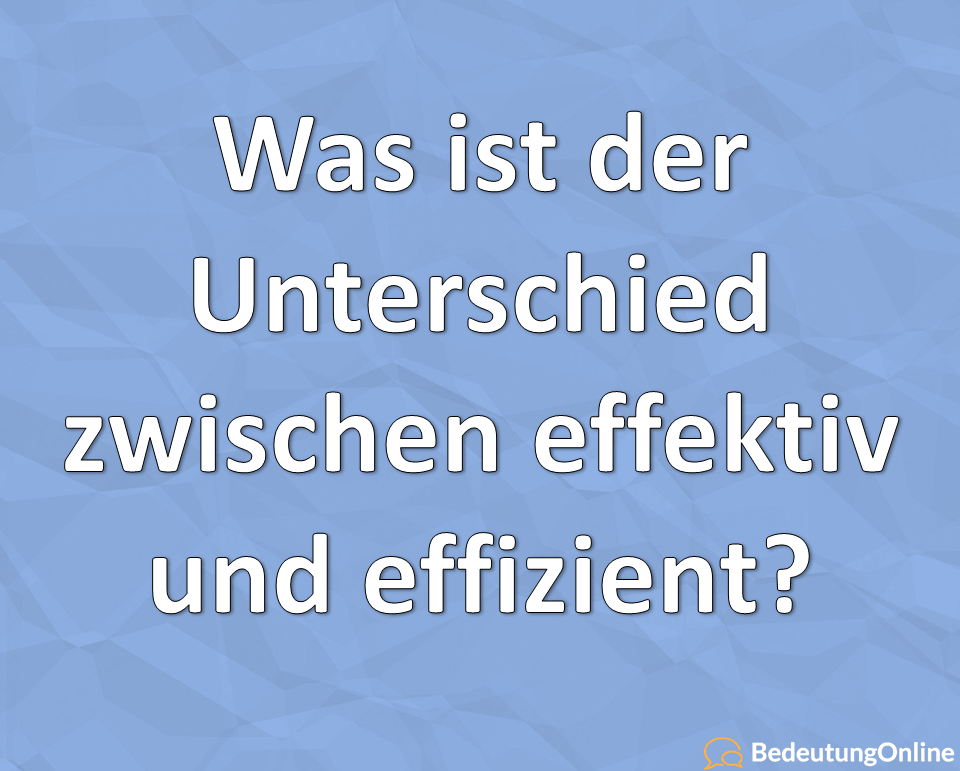Annahmen, die nicht auf überprüfbaren und falsifizierbaren Fakten beruhen, sind keine Theorien. Sie sind erst einmal nur Behauptungen, ohne wissenschaftliche Grundlage. Erst, wenn überprüfbare Fakten eine Behauptung belegen, wird diese zur Theorie.
Deswegen wurde der Begriff „Verschwörungstheorie“ in der öffentlichen Debatte durch Begriffe wie „Verschwörungserzählung“, „Verschwörungsmystik“, „Verschwörungsmythen“, „Verschwörungsideologie“ oder „Verschwörungsglaube“ ersetzt. Denn jede „Theorie“ hat einen Anspruch auf Wahrheit.
Kritik am Begriff „Verschwörungstheorie“
Theorien basieren auf Fakten und sind ein wissenschaftliches Konzept. Das bedeutet, dass Theorien durch andere Menschen (z.B. Wissenschaftler) überprüfbar (falsifizierbar) sein müssen und dass widersprüchliche Fakten oder Ergebnisse dafür sorgen, dass eine Theorie widerlegt, aufgegeben oder angepasst wird. (Eine Theorie, die andere nicht überprüfen können, ist keine Theorie und auch keine Wissenschaft!)
Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen basieren auf subjektiven Behauptungen. Sie können zwar auf einzelnen Fakten beruhen, aber wenn die gezogenen Schlussfolgerungen und Annahmen nicht falsifizierbar oder belegbar sind, sind die Behauptungen keine Theorie, sondern eine Geschichte oder ein Narrativ. Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen haben keine wissenschaftliche Grundlage, sondern sie sind eben eine Erzählung, Mythos oder nur ein Glaube wie die Welt sein könnte.
Der Begriffsteil „Theorie“ im Wort „Verschwörungstheorie“ gibt den verbreiteten Behautpungen eine gewisse Glaubwürdigkeit und suggeriert, dass diese auf Wissenschaft fußen und einen Anspruch auf Wahrheit haben. Da keine Überprüfbarkeit möglich ist, sind Verschwörungstheorien auch keine wissenschaftliche Theorien. (Umgekehrt gilt, dass eine Theorie erst zur Theorie (und damit Wissenschaft) wird, wenn sie auf überprüfbaren Fakten aufbaut.)
Unterschied: Wissen – Glauben
Um den Unterschied zwischen „Theorie“ und „Glaube“ oder „Geschichte“ zu verstehen, ist es wichtig den Unterschied zwischen Wissen und Glauben zu kennen.
„Wissen“ und „Glauben“ sind beides Annahmen über die Welt.
Was ist Wissen? Kurzerklärung, Bedeutung
„Wissen“ ist wahre gerechtfertige Auffasung. Wissen beruht auf überprüfbaren Fakten. Für Wissen gilt, dass es durch eigene Erfahrung oder durch Dritte erworben werden kann.
Für Wissen gilt – und das ist am wichtigsten -, dass es falsifizibar und widerlegbar ist. Dass heißt Wissen kann sich (immer) als falsch herausstellen. Dies passiert, wenn eine Theorie durch widersprüchliche Fakten widerlegt wird.
Für Wissen gilt, dass andere Menschen Wissen und Theorien überprüfen können.
Was ist Glaube? Kurzerklärung, Bedeutung
„Glaube“ ist eine Überzeugung darüber wie die Welt ist. Diese Überzeugung ist nicht durch Fakten überprüfbar. (z.B. der Glaube an Gott) Für „Glaube“ gilt, dass er nicht widerlegbar ist.
„Glaube“ geht meist mit der Überzeugung einher, dass dieser Glaube richtig ist.
„Glaube“ kann nicht durch widersprüchliche Fakten oder Widersprüche widerlegt werden.
„Glaube“ existiert jenseits von Überprüfbarkeit und Widerlegbarkeit.
Fazit: Unterschied Glauben – Wissen
Die Überprüfbarkeit (Falsifizierbarkeit) ist eine der wichtigsten Unterscheidungen zwischen „Wissen“ und „Glauben“.
Während Glaube als absolut und immer wahr gilt, ist Wissen immer relativ.
Zurück zu den Verschwörungserzählungen und den einzelnen Begriffen. Im nachfolgenden werden die Ausdrücke „Verschwörungserzählung“, „Verschwörungsmystik“, „Verschwörungsmythen“, „Verschwörungsideologie“ und „Verschwörungsglaube“ erklärt.
Was bedeutet „Verschwörungserzählung“? Bedeutung, Erklärung
Im Sinne des Begriffes ist eine „Verschwörungserzählung“ die Erzählung eines Planes, um Machtverhältnisse zu ändern.
Eine „Erzählung“ ist keine Wissenschaft, da sie eben nur einen Bericht oder eine Darstellung von einem Ereignis oder Geschehen darstellt. Eine Erzählung ist immer subjektiv, da ein Erzähler (oder eine Erzählerin) die Erzählung erzählt.
Wer eine Verschwörungserzählung erzählt, ist ein Verschwörungserzähler.
Was bedeutet „Verschwörungsmystik“? Bedeutung, Erklärung
Als „Mystik“ werden göttliche, übersinnliche oder übernatürliche Erfahrungen bezeichnet. Die Mystik gibt es in vielen Religionen. Ein Mystiker will – im Sinne des Begriffs – Gott, etwas Übersinnliches oder etwas Übernatürliches erfahren.
Der Begriff „Verschwörungsmystik“ kann im Kontext des Begriffs „Mystik“ so verstanden werden, dass die Verschwörungsmystik dazu dient besondere persönliche und subjektive Erfahrungen wiederzugeben. Es kann vermutet werden, dass ein Verschwörungsmystiker oder eine Verschwörungsmystikerin die Überzeugung hat, dass er oder sie besondere (und erschütternde) Einblicke in das Geschehen der Welt gewonnen hat und diese nun unbedingt mitteilen will.
Wer Verschwörungsmystik verbreitet oder glaubt, ist ein Verschwörungsmystiker.
Was bedeutet „Verschwörungsmythen“? Bedeutung, Erklärung
Ein Mythos ist in der Regel eine Geschichte über die Herkunft oder den Ursprung der Menschen. Die meisten Mythen berichten über eine Zeit bevor es Menschen gab und sie berichten darüber wie die Welt erschaffen wurde. In Mythen wird über Götter, Geister und Vorwelten erzählt. Mythen dienen dazu den Menschen mit dem Übernatürlichen und dem Kosmos zu verbinden.
In Religionen spielen und im antiken Griechenland spielten Mythen eine wichtige Rolle.
Der Begriff „Verschwörungsmythen“ kann im Sinne des Begriffs so verstanden werden, dass ein Erzähler seine Annahme verbreitet, wie die Welt zusammenhängt und funktioniert.
Der Singular ist „Verschwörungsmythos“. Der Plural ist „Verschwörungsmythen“.
Was bedeutet „Verschwörungsideologie „? Bedeutung, Erklärung
Eine „Ideologie“ ist eine Weltanschauung, die dazu dient Menschen in (und außerhalb) einer Gesellschaft einzuordnen, Lösungen für gesellschaftliche Probleme festzulegen und Handlungen zu rechtfertigen.
In der Praxis führt eine „Ideologie“ dazu, dass Herrschende eine Gesellschaft nach ihren Ansichten und Vorstellungen formen. Dies bedeutet, dass Einfluss auf Menschen innerhalb der Gesellschaft durch staatliche Organisationen genommen wird. In einer Ideologie wird die Unterordnung der Bürger gefordert und durch staatliche Gewalt erzwungen. Menschen, die den Ansichten und Vorstellungen der Herrschenden in einer Ideologie widersprachen oder nicht entsprachen, wurden bestraft, verfolgt oder ermordet.
Der Begriff „Verschwörungsideologie“ kann im Kontext des Begriffs „Ideologie“ so verstanden werden, dass Verschwörungsideologen glauben, dass eine Verschwörung zur Um- oder Neuordnung der Gesellschaft stattfindet.
Wer „Verschwörungsideologien“ verbreitet oder anhängt, ist ein Verschwörungsideologe.
Was bedeutet „Verschwörungsglaube „? Bedeutung, Erklärung
Ein Glaube ist eine Überzeugung oder Annahme über die Welt, die nicht überprüft werden kann. Wer glaubt, ist von der Richtigkeit des Glaubens überzeugt.
Der Begriff „Verschwörungsglaube“ bedeutet im Kontext des Begriffs „Glaubens“, dass jemand Annahmen über die Welt hat oder verbreitet, die nicht durch Fakten überprüfbar oder falsifizierbar sind.
Wer „Verschwörungsglauben“ verbreitet oder anhängt, ist ein Verschwörungsgläubiger.