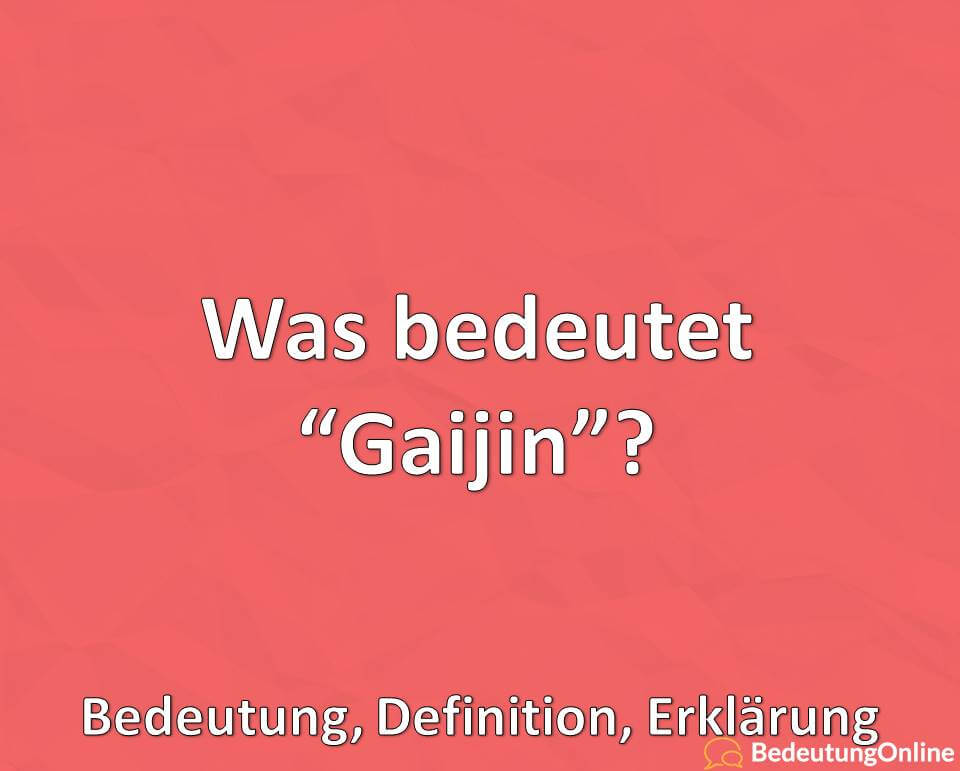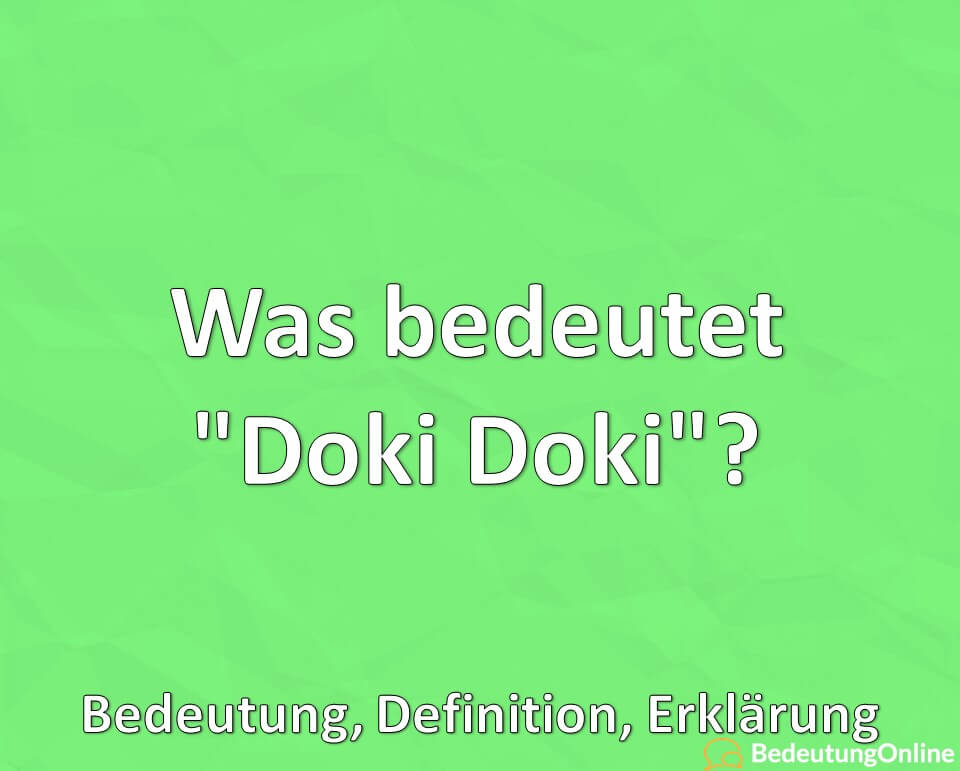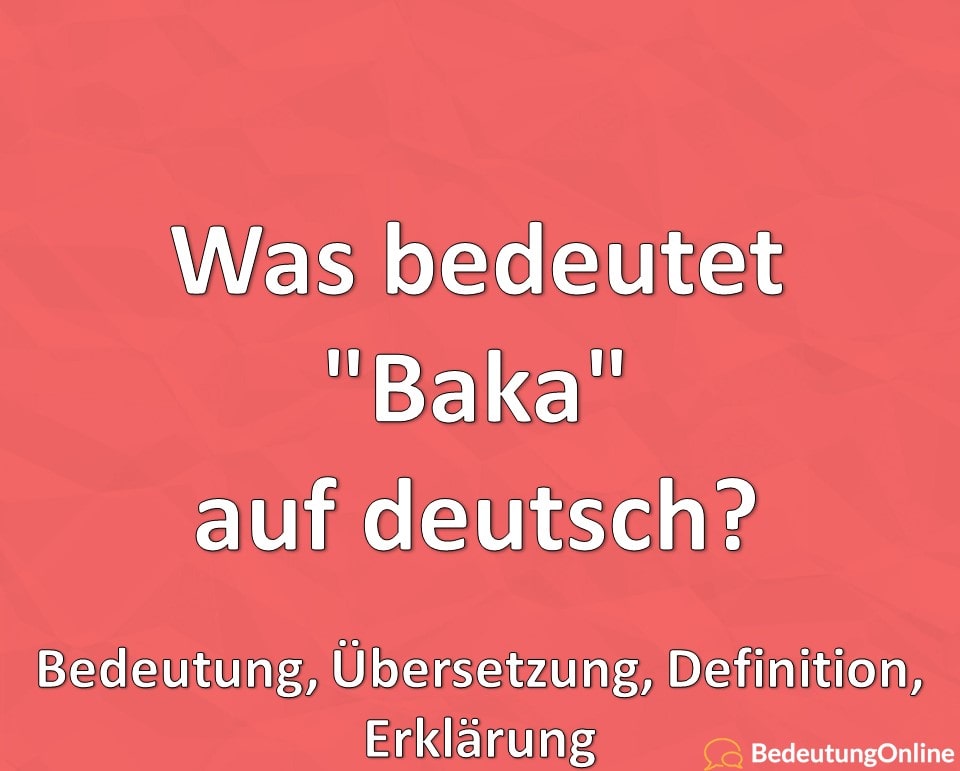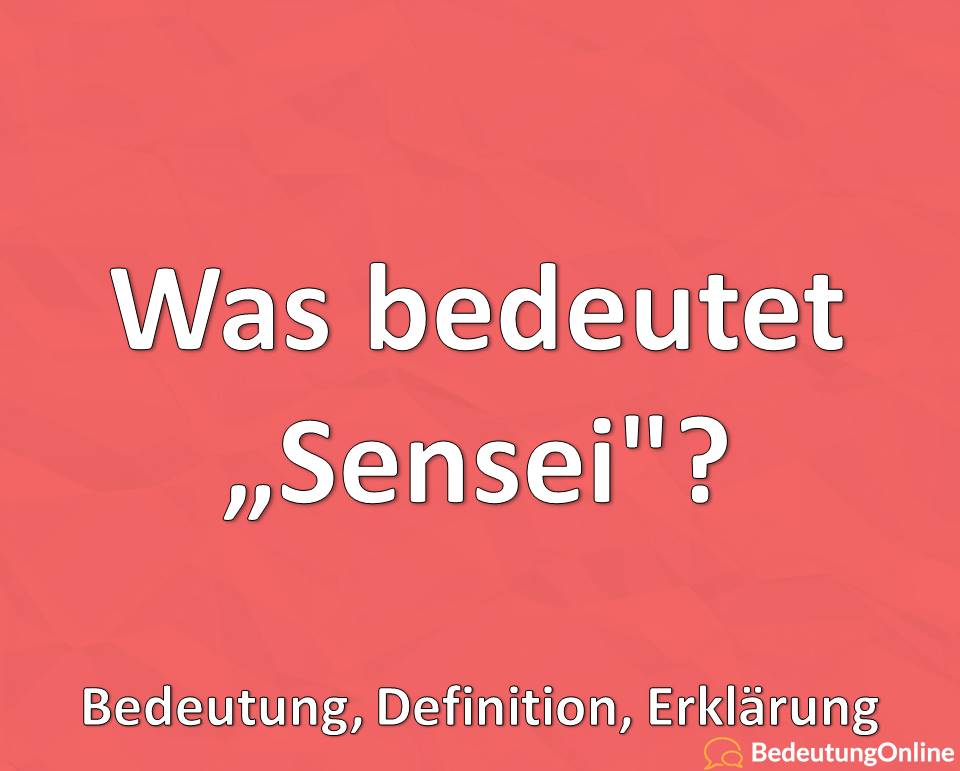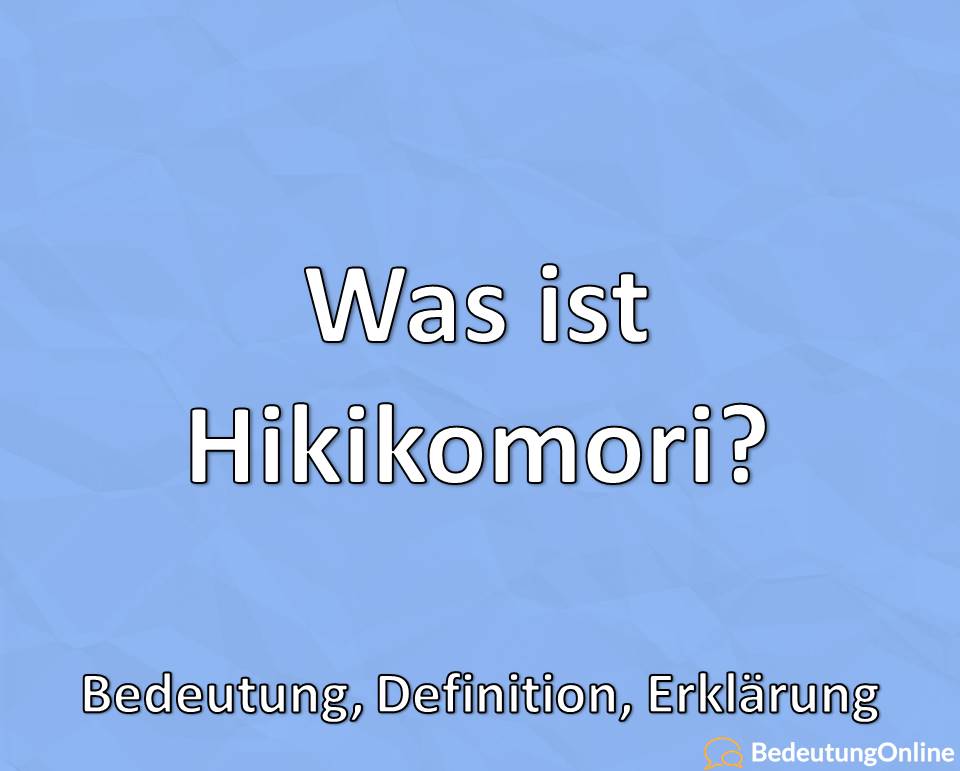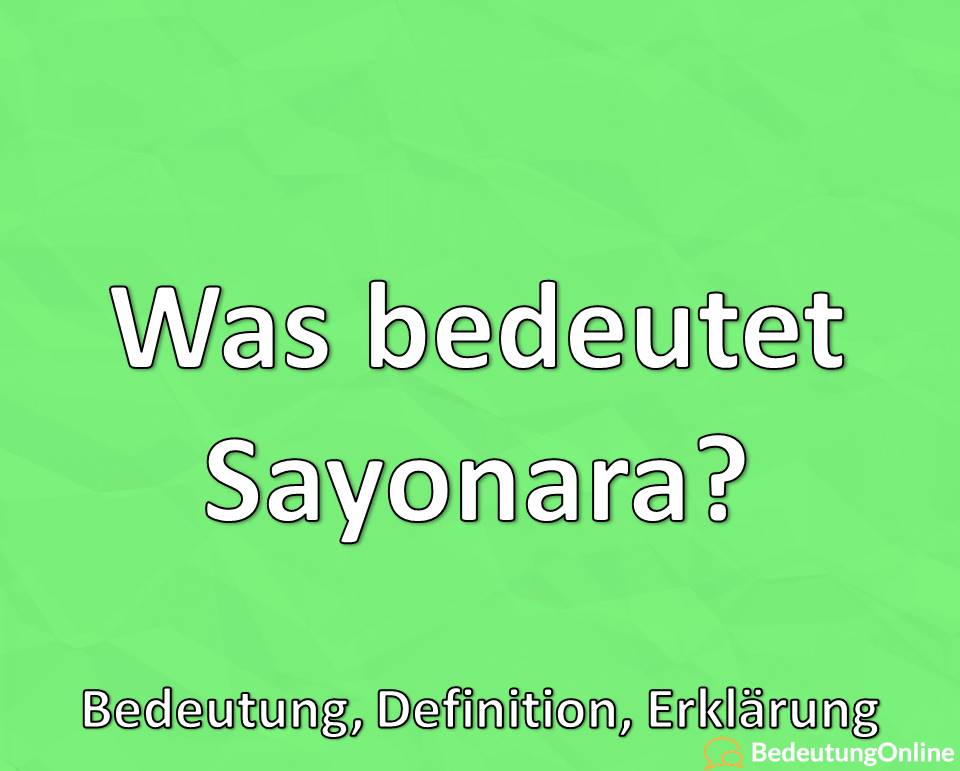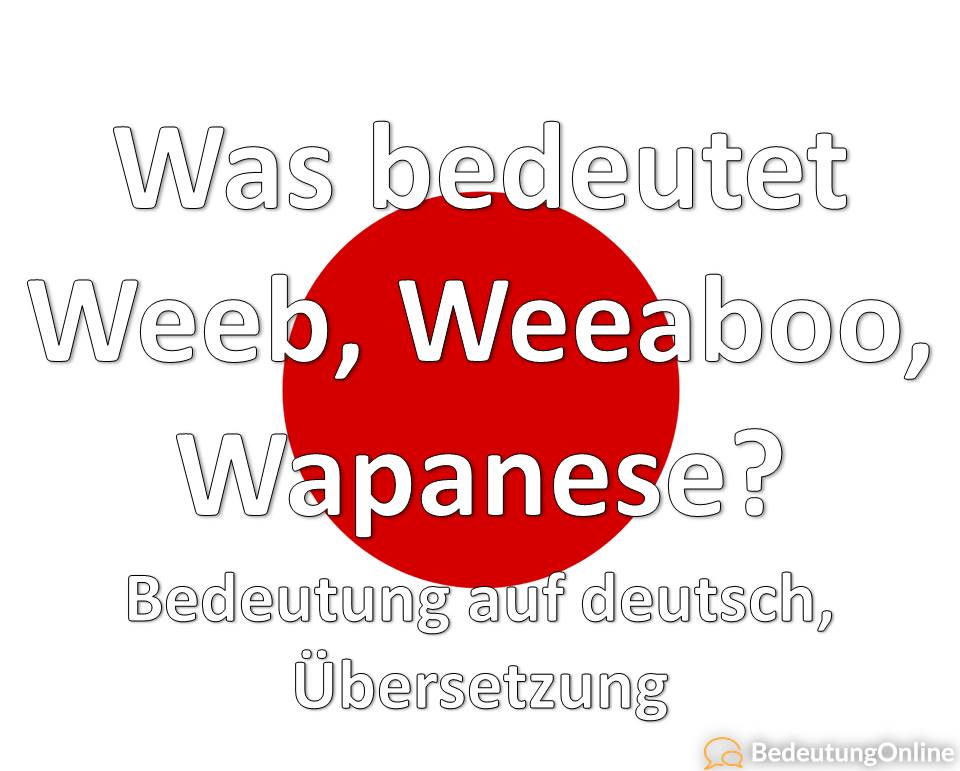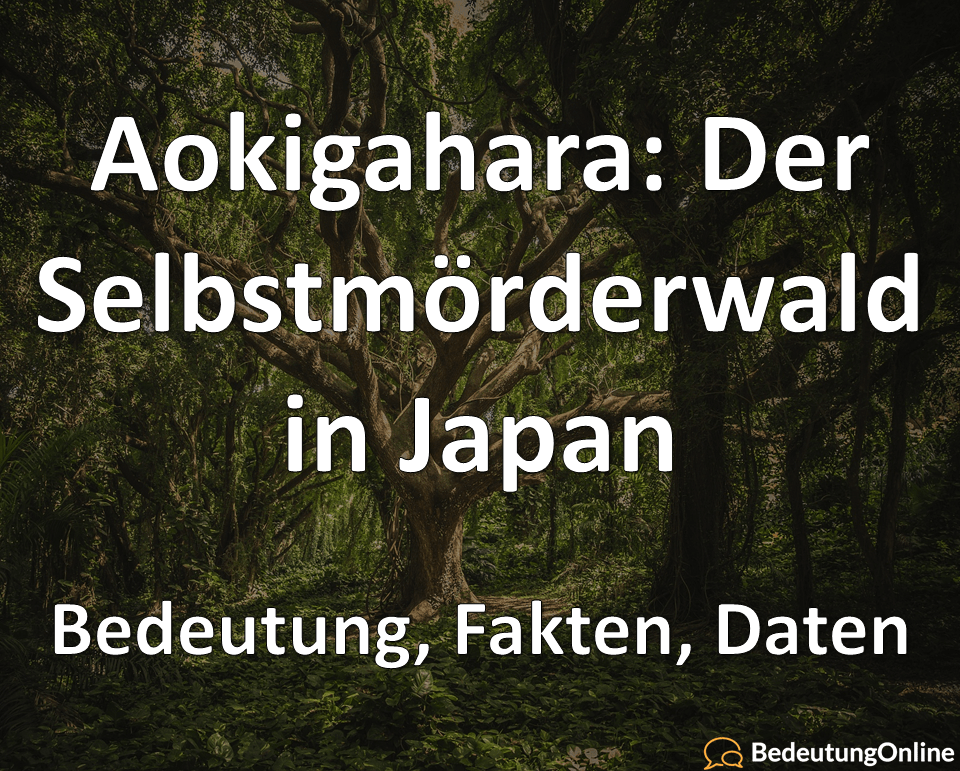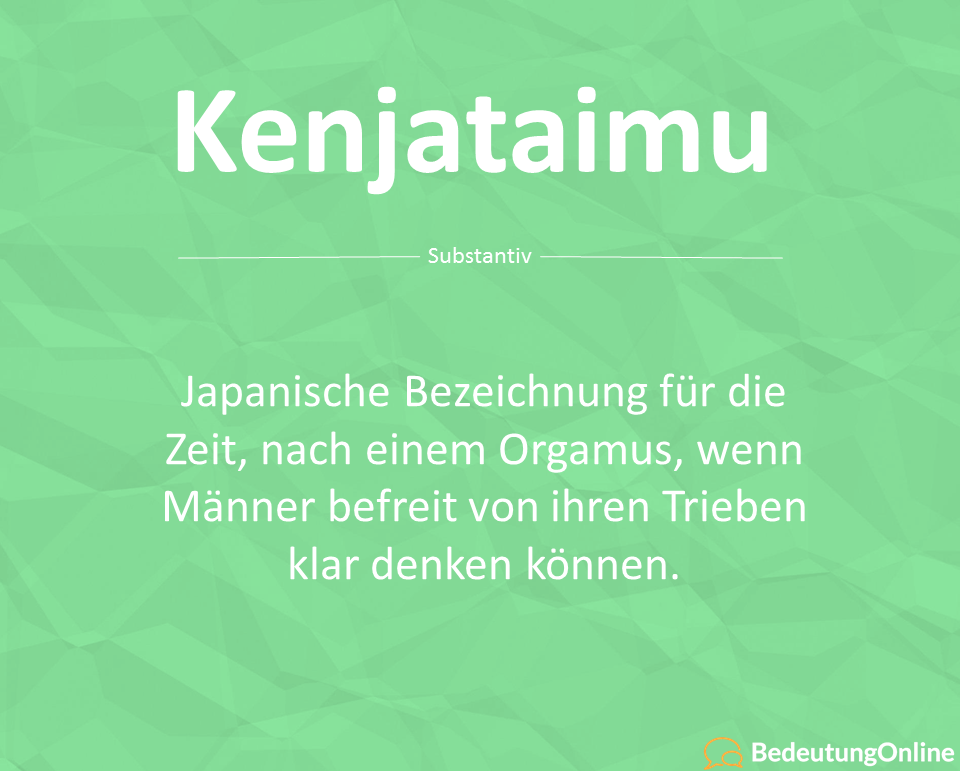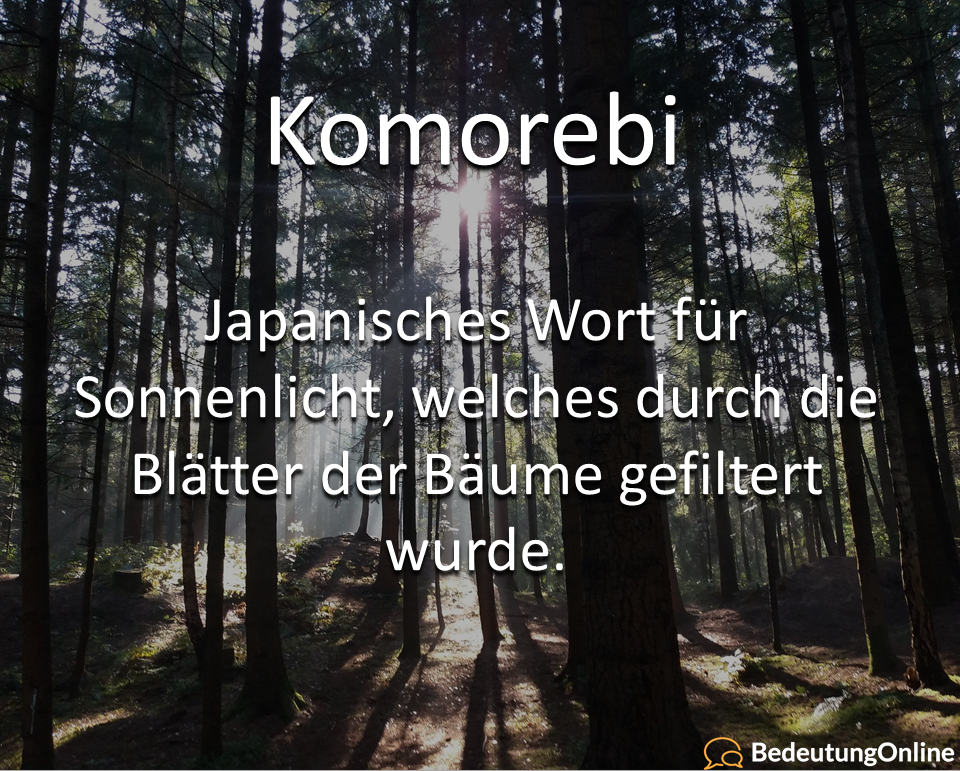Besonders Japanreisenden dürfte das Wort Gaijin ein Begriff sein. In Japan gilt dieses Wort als herablassender Begriff für Ausländer. Es sagt aus, dass der Betitelte im Land fremd ist und nicht zur Gesellschaft gehört. Solche Begriffe zu vermeiden, nennt man übrigens Kotobagari.
Wer Japanisch lernen möchte, der sollte unbedingt darauf achten, politisch nicht korrekte Begriffe zu vermeiden. Aber nicht nur in Japan selbst hört man das Wort Gaijin, sondern auch in der Popkultur und in den Medien trifft man immer wieder auf diesen Begriff.
Gaijin und Gaikokujin: Bedeutung, Definition, Erklärung
Das Wort Gaijin verblasste schon in der Nachkriegszeit immer mehr und wurde schließlich durch das Wort Gaikokujin abgelöst. Der Begriff „Koku“ steht für „Land“. Zusammen in der Wortkombination Gaikokujin ist dieser Begriff der politisch korrekte für einen Ausländer. Doch heutzutage hört man in Japan immer noch hier und dort das Wort Gaijin. Das kann durchaus zwei Gründe haben. Einer der Gründe kann sein, dass einem unerfahrenen Japaner, der noch keine Erfahrungen im Ausland gesammelt hat, der Begriff Gaijin einmal versehentlich herausrutscht. Der andere Grund kann sein, dass ein Japaner das Wort absichtlich benutzt, um es höchstwahrscheinlich als Beleidigung zu nutzen.
Untersucht man den politisch korrekten Begriff Gaikokujin etwas genauer, bezeichnet dieser Begriff ausländische Staatsbürger, ausländische Personen, Personen, die nicht aus dem Land stammen und sogar Außerirdische. Doch was genau bedeutet eigentlich Alien? Im Englischen nimmt der Begriff „Alien“ nicht ausschließlich Bezug auf Außerirdische. Wird das Wort in seine Einzelteile zerlegt, ist ein Außerirdischer eine Person außerhalb des Landes, der Erde oder eben auch der Galaxie.
Zudem ist es in der japanischen Sprache üblich, mehrere Begriffe für ein und dieselbe Sache zu haben. Auch besitzen die Synonyme oftmals verschiedene Bedeutungen. Beispielsweise steht das japanische Wort Yasumi für Urlaub. Es kann sich aber genauso gut auch auf eine nächtliche Ruhe oder einfach nur einen freien Tag beziehen.
Deshalb kann auch das Wort Gaijin, welches oftmals von den Japanern als Abkürzung verwendet wird, so gedeutet werden, dass etwas über das Fremde hinausgeht. Das Wort Gaijin steht im englischen Wörterbuch beispielsweise auch für einen Außenseiter. Des Weiteren bedeutet das englische Wort auch Eindringling, Fremder, Profan und Laie. Im Wörterbuch selbst wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich um ein veraltetes, nicht mehr verwendetes Wort handelt.
Verwendung des Wortes Gaijin
In Japan werden viele verschiedene Ausdrücke auch in formellen Gesprächen, Medien oder Magazinen verwendet, die den Ausdruck Gaijin nutzen. Selbst, wenn über ausländische Sportler berichtet wird, wird oftmals das Wort Gaijinsenshu verwendet.
Nahezu alle abgewandelten Formen des Wortes Gaijin bedeuten zusammengefasst Außenseiter oder Ausländer. Allerdings finden die beiden Wörter Gaikokujin und Gaijin in der Praxis häufig Anwendung, um einen Menschen zu bezeichnen, der nicht aus der asiatischen Region stammt. Beispielsweise werden in Japan lebende ethnische Koreaner und Chinesen üblicherweise nicht als Gaijin bezeichnet. Dies hängt mit ihrer Nationalität zusammen, wohingegen diese Personengruppen eher als Zainichi oder Kakyō (spezieller Begriff, der einen ethnischen Chinesen symbolisiert) bezeichnet werden. Kakyō wird wiederum manchmal auch durch das Wort Wajin ersetzt, welches für Personen steht, die in einem anderen Land geboren und herangewachsen sind.
Bei japanischen Sportevents – beispielsweise beim Baseball oder Wrestling – ist der Begriff Gaijin sehr oft zu hören. Hierbei wird sich hauptsächlich auf die nicht japanischen Spieler bezogen, die aufgrund des Sportevents das Land bereisen.